Die bürgerbewegten Initiativen, die im Herbst 1989 in der DDR entstanden, nannten sich "Aufbruch 90", "Bewegung 'Wissen für das Volk'" oder "Forum für direkte Demokratie". Sie produzierten massenhaft Flugblätter, Konzeptpapiere und Briefe. In dieser Zeit und in den Wochen danach blühten vielfältige Ideen auf, wie das Staatswesen - sei es als fortbestehende DDR, sei es als vereintes Deutschland - durch aktive Bürgerbeteiligung reformiert, wie die "wahre" Demokratie geschaffen werden könnte. Es war, wie die Historikerin Christina Morina konstatiert, eine "unbändige, demokratiehungrige Fantasie", die sich da auslebte. So viel Aufbruch war nie.
Und dann das: Drei Jahrzehnte später erlebt derselbe Landstrich, wo einst eine friedliche demokratische Revolution stattgefunden hatte, dass eine in Teilen rechtsextreme Partei überdurchschnittlich hohen Zulauf erhält. Umfragen sehen die " Alternative für Deutschland" (AfD) derzeit in fast allen ostdeutschen Bundesländern als stärkste Partei. "Wie konnte aus der demokratischen Mobilisierung einer sich selbst befreienden Gesellschaft der Nährboden für eine antidemokratische Revolte entstehen?", fragt die 1976 in Frankfurt/Oder geborene, jetzt in Bielefeld lehrende Geschichtsprofessorin.
Unterschiedliches Staatsverständnis in Ost und West
Auf der Suche nach einer Antwort folgt Morina nicht den gängigen Ost-West-Debatten "entlang den gewohnten Erregungs- und Zuschreibungslogiken", den Schuldzuweisungen an den Westen wegen der Verwerfungen in der sogenannten Nachwendezeit. Vielmehr wählt sie einen anderen Ansatz: Sie beschreibt "das Wesen und den Wandel des Demokratie- und Bürgerselbstverständnisses der Deutschen in Ost und West sowohl vor als auch nach der Zäsur von 1989", also in vergleichender Perspektive und zurückreichend in die Zeit der Zweistaatlichkeit.

Dabei gilt ihr Interesse "den demokratischen Vorstellungs-, Erwartungs- und Erfahrungswelten 'ganz normaler' Bürgerinnen und Bürger". Zu diesem Zweck sichtete und analysierte Morina schriftliche Zeugnisse aus zwei Jahrzehnten, aus der Dekade vor und der nach der Wiedervereinigung. Sie nutzt weitgehend unerforschte Quellenbestände: im Bundesarchiv überlieferte Briefe an die Bundespräsidenten Karl Carstens und Richard von Weizsäcker sowie vom DDR-Ministerium für Staatssicherheit abgefangene oder dorthin übergebene Bürgerpost, die an die Staats- und Parteiführung, an Ministerien und Medien der DDR adressiert war; ferner einschlägige Petitionen, Flugschriften, Unterschriftensammlungen und Privatbriefe an die Bürgerbewegung "Neues Forum" und etablierte oder im Umbruch neu entstandene Zeitungen in Berliner und Leipziger Oppositionsarchiven; schließlich Tausende von Bürgerschreiben an die 1992/93 tagende, aus dem Einigungsvertrag hervorgegangene Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat, in denen es vor allem um die Ausgestaltung der Verfassung des vereinten Deutschland ging.
Mit dieser "verflochtenen Perspektive" spürt Morina der Frage nach, wie sich "die Deutschen in Ost und West als Bürgerinnen und Bürger verstanden und verstehen und inwiefern sich ihr Staats- und Demokratieverständnis unterschied und unterscheidet". Aus dem Arsenal an Ideen, Konzepten, Projekten und Initiativen erzählt Morina eine historisch einzigartige Demokratiegeschichte von unten.
Identifikation mit der "sozialistischen Heimat"
Die Divergenzen sind erheblich, wie sich anhand der Schriftsammlungen zeigt. Eine Erkenntnis Morinas: Westdeutsche Briefeschreiber wandten sich, trotz gelegentlicher Fundamentalkritik, "nicht grundsätzlich vom Staat insgesamt" ab - im deutlichen Unterschied zur DDR-Bürgerpost, die "in Ton und Inhalt viel stärker konfrontativ und nicht selten geradezu feindselig formuliert" war. Dennoch engagierten sich DDR-Bürger in viel stärkerem Maß als Westdeutsche in gesellschaftlichen Gremien. Denn die DDR-Verfassung formulierte die Grundrechte ihrer Bürger als Teilhaberechte. Hingegen definiert das Grundgesetz die Grundrechte als Abwehrrechte, die die Bürger primär vor staatlichen Ein- und Übergriffen schützen.

Die DDR war ein Mitmach-Staat, eine "partizipatorische Diktatur", wie die britische Historikerin Mary Fulbrook es nannte. Der Slogan "Plane mit, arbeite mit, regiere mit!" stand nicht nur in Artikel 21 der Verfassung, er zierte auch unzählige Betriebswandzeitungen. Mit dem sozialistischen Mitbestimmungsprinzip verfügte die SED über ein wirksames Mittel zur Disziplinierung jedes Einzelnen. Zugleich bildete sich, so Morina, "im Laufe der Jahrzehnte vielerorts auf lokaler und regionaler Ebene ein starkes Gemeinschaftsgefühl heraus, ein bürgerschaftlicher Verantwortlichkeitssinn für die eigene Lebenswelt und die unmittelbare Umgebung". Denn für die "sozialistische Heimat" konnte man sich "auch jenseits oder sogar gegen die Gängelungen lokaler Parteifunktionäre engagieren". Die Kehrseite dieses "eigentümlichen, provinziell-utopischen Bürgersinns" habe darin bestanden, "dass sich die meisten Bewohner der DDR zwar mit ihrem Land und dessen sozialen bis sozialistischen Idealen, aber kaum mit dem Staat und dessen Institutionen identifizierten".
Zehntausende Eingaben an Erich Honecker persönlich
Eine eigenartige Ausprägung im Verhältnis von Bürger und Staat war das von der SED erfundene Eingabewesen, das die 1952 abgeschaffte unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit ersetzte. DDR-Bürger hatten keine Möglichkeit, individuelle Rechte gegenüber staatlichen Institutionen einzuklagen. Stattdessen durften die DDR-Deutschen, wie weiland die preußischen Untertanen an ihren König, Bittschriften an Landesvater Erich Honecker persönlich richten. Allein 1988, in seinem letzten vollen Amtsjahr, wandten sich fast 29 000 DDR-Bürger mit ihren Anliegen direkt an den Staatsratsvorsitzenden, viele bekamen das begehrte "Einverstanden" zurück. Diesem vom Staat vorgezeichneten Weg, Wünsche an die Obrigkeit heranzutragen, schenkt Morina leider zu wenig Beachtung. Denn die von der Staatssicherheit konfiszierten Beschwerdebriefe, die sie für ihren Ost-West-Vergleich heranzieht, bilden nur die, wie es im Stasi-Jargon hieß, "feindlich-negative" Spitze der Bürgerpost.
Fundamental anders als in der DDR entwickelten sich die Staats- und Staatsbürgervorstellungen im Westen. "Im Zuge von '1968'", stellt Morina fest, "hatte sich die bundesrepublikanische Gesellschaft ... nachhaltig geöffnet, liberalisiert und pluralisiert." Eine vergleichbare Zeitenwende gab es in der DDR nicht. So deuten denn die Stimmen aus dem Osten "auf eine nicht zu unterschätzende weltanschaulich-normative Grundhaltung hin, die die ostdeutsche politische Kultur bis in die Gegenwart hinein prägt: eine Nähe zu den Normalisierungsdiskursen und autoritären Führungsvorstellungen der Neuen Rechten, ein Fremdeln mit Meinungspluralismus und streitbarer Demokratie, eine geo- beziehungsweise großmachtpolitisch begründete Äquidistanz zum Westen und zum Osten, namentlich Russland, und nicht zuletzt ein von den NS-Verbrechen relativ unbeeindrucktes Geschichtsbild."
"Volkssouveränität statt Parteiherrschaft"
Gerade das Erbe des staatlich verordneten DDR-Antifaschismus, die "weitgehend versäumte beziehungsweise ideologisch verzerrte Vergangenheitsbefragung", dürfte "langfristig zur Stärke von Rechtspopulismus und -radikalismus im Osten beigetragen haben", vermutet Morina. Die im Westen ursprünglich als nationalliberales Projekt gegründete AfD habe hier angesichts "strukturell höherer Zustimmung zu autoritären und rassistischen Einstellungen" günstige Bedingungen für ihren Aufstieg und ihre Radikalisierung vorgefunden.

Der ostdeutsch-postsozialistische Demokratiediskurs der 1990er-Jahre war bestimmt von der Angst vor erneutem Machtmissbrauch und vor Korruption in Staat und Verwaltung, von einem Grundmisstrauen gegenüber Parteien und Parlamenten und daraus abgeleitet von der Forderung nach "Volkssouveränität statt Parteiherrschaft", wie eine ostdeutsche Briefschreiberin formulierte.
Die meisten programmatischen Entwürfe der Umbruchszeit in der DDR kreisten denn auch um basisdemokratische Vorstellungen, als Ergänzung oder Gegenentwurf zum parlamentarischen System der Bundesrepublik. Gleichwohl stimmte bei der Volkskammerwahl im März 1990 eine breite Mehrheit der ostdeutschen Wähler für die Parteien, die den Weg in die repräsentative Demokratie vorzeichneten. Das konkrete Versprechen rascher Einheit und DM-Einführung wog in diesem Moment schwerer als abstrakte Verfassungsdiskussionen.
Eine neue Verfassung kam nicht zustande
Alle mittelfristigen Versuche, direktdemokratische und plebiszitäre Elemente ins Grundgesetz aufzunehmen, scheiterten 1994, als die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat ihre Arbeit einstellte, an den politischen Mehrheitsverhältnissen im Parlament. Vergebens hatte der ostdeutsche Kulturwissenschaftler Wolfgang Thierse, nun SPD-Abgeordneter, daran erinnert, dass die "positive Erfahrung" des demokratischen Aufbruchs im Herbst 1989 "auf eine überraschende Weise mit einem Schwächezustand der Parteiendemokratie in der alten Bundesrepublik" korrespondiert habe. Auch der Vorstoß prominenter Intellektueller, Künstler und Publizisten aus Ost und West für eine per Volksabstimmung herbeigeführte neue Verfassung verpuffte trotz eines beachtlichen Medienechos. Immerhin werden in jüngster Zeit direktdemokratische Praktiken auf Bundesebene diskutiert und ausprobiert, etwa mit sogenannten Bürgerräten.
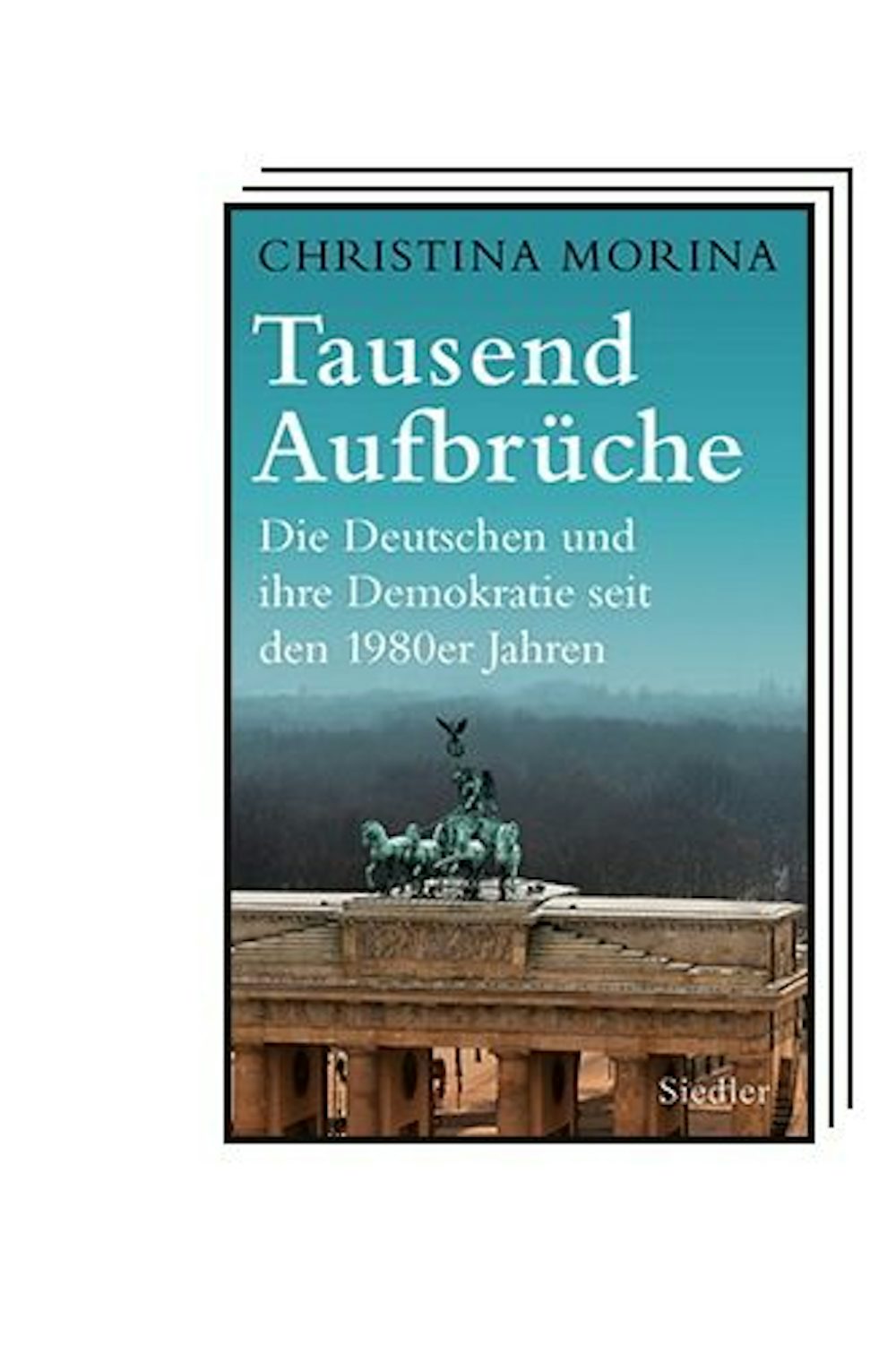
Ob mehr Bürgerbeteiligung allerdings zu größerer Akzeptanz des demokratischen Systems führen würde, ist dennoch fraglich. Zwar wurden in allen fünf ostdeutschen Landesverfassungen Volksgesetzgebungsverfahren verankert, aber die Demokratiezufriedenheit liegt dort bei Umfragen stets um 15 bis 20 Prozentpunkte unter den westdeutschen Werten.
Christina Morinas ostwestlich perspektivische Geschichte der Deutschen und ihrer Demokratie seit den 1980er-Jahren zeigt, dass es für die teilweise eigensinnige politische Entwicklung in Ostdeutschland nachvollziehbare Gründe gibt. Daraus schlüssige Folgerungen zu ziehen, bleibt eine staatspolitische Aufgabe.
Norbert F. Pötzl ist Publizist. Er hat unter anderem Biografien über Erich Honecker und Wolfgang Vogel sowie das Buch "Der Treuhand-Komplex" verfasst.

