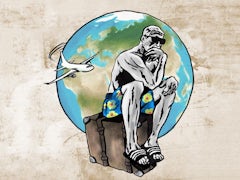Herden wilder Trampeltiere könnten in Städten kaum ärger wüten als Touristen, behaupten manche. So sei etwa Barcelonas Zentrum kein Ort zum Leben mehr, eher ein außer Kontrolle geratener Vergnügungspark - dieses Gefühl beschreiben Bewohner in Eduardo Chibas Dokumentation "Bye bye Barcelona". In Venedig sehen sich 56 000 Altstadtbewohner überwältigenden 30 Millionen Gästen pro Jahr gegenüber, und das in einer Umgebung, die fast völlig an den Tourismus angepasst worden ist. Schlagzeilen häufen sich international: "Warum manche Städte keine Touristen mögen", "Es ist möglich, als Stadt zu viele Touristen zu haben" oder gar "Die Schlacht von Barcelona: Stinksaure Einheimische vs. betrunkene, nackte Touristen".
Fakt ist: Städtetrips sind laut World Travel Trends Report der internationale Reisetrend schlechthin, allein die Europäer unternahmen zuletzt 60 Prozent mehr Citytrips als noch 2007. Nicht nur in den Klassikern wie Paris, London und Rom, sondern auch an Orten wie Dubrovnik, Riga oder Tallinn ist es besonders durch Billigflieger und Schiffe mit der Ruhe vorbei.

So schön, so voll: Die Anzahl der Touristen, die die Altstadt von Dubrovnik sehen wollen, steigt von Jahr zu Jahr - mit zum Teil kuriosen Folgen.
Alle wollen ihr Stück vom Kuchen - Reiseveranstalter, Kreuzfahrtunternehmen, Ladenbesitzer, Hoteliers, private Wohnungsvermieter und natürlich die Gäste selbst. Doch was ist mit den anderen, die das vermeintliche Glück haben, da zu leben, wo andere Urlaub machen? Gilt auch für sie: je mehr Besucher, desto mehr Geld, desto besser?
Die Rechnung ist komplizierter, sogar an Orten, die auch dank der Reisebranche aus Wirtschaftskrisen finden. Denn nicht alle Betroffenen profitieren gleich von den Urlaubern. Und Gast ist nicht gleich Gast: Gerade von Kreuzfahrttouristen auf Landgang heißt es, sie würden in einer Stadt eher Schäden und Müll hinterlassen als Geld, wenn sie auf durchgetakteten Routen zu zwei oder drei "Highlights" geschleust werden und danach wieder abdampfen.

Zugangsbeschränkungen, Eintrittsgebühren, Verbannung der großen Kreuzfahrtschiffe: Venedig wählt nicht nur einen neuen Bürgermeister, sondern auch, wie die Lagunenstadt mit den Touristenmassen fertigwerden soll.
Die Klagen der Bewohner ähneln sich an vielen Orten: Der Laden in der Nachbarschaft gibt auf. Nachfolger: ein Souvenirshop. Durch die Nächte hallt das Rattern von Rollkoffern. Ein Leben in der Altstadt wird zum alltäglichen Hindernislauf zwischen Selfiesticks, vor sich hin trödelnden Reisegruppen und johlenden Junggesellenabschieden. Zudem können Touristen Preise hochtreiben, wenn Lokale und Läden von allen verlangen, was nur Urlauber auszugeben bereit sind. Andererseits: Dieses Problem erledigt sich teils von selbst, wenn die Wohnkosten so steigen, dass ganze Straßenzüge sich von Nachbarschaften in Unterhaltungsviertel verwandeln.
Derlei Entwicklungen werden auch unter dem Schlagwort Touristifizierung diskutiert. Das erinnert nicht zufällig an Gentrifizierung - an den Prozess also, der das soziale Gefüge so umkrempelt, dass betroffene Gegenden kaum mehr wiederzuerkennen sind. Auch in diesem Kontext müssen Vorbehalte Einheimischer gegen den Tourismus verstanden werden. "Der Tourist", ohnehin ein Klischee oft am Rande der Lächerlichkeit, wird schlimmstenfalls zum Feindbild.
Die Konflikte führen immer wieder zu aufsehenerregenden Aktionen: In Barcelonas Viertel Gràcia besetzten Aktivisten 2015 drei Monate lang ein im Bau befindliches Hotel (Slogan: "Gràcia is not for sale"), oft gibt es Demonstrationen. Im Berliner Wedding übernahm eine Gruppe im Januar 2016 ganz legal eine private Ferienwohnung, um auf die wachsende Wohnungsnot hinzuweisen. In Lissabon, das ebenfalls einen Tourismusboom erlebt, haben sich in Ausgehvierteln Initiativen wie "Aqui mora gente" ("Hier wohnen Menschen") gegründet. Tagsüber lebe man in einer Wüste, nachts in einem Dschungel, schreibt ein erboster Hauptstädter im Netz - in Anspielung an den Partytourismus mit seinen völlig verschobenen Rhythmen.

Nie war Spanien beliebter bei Touristen. Das freut nicht alle: In Barcelona oder auf Mallorca wollen immer mehr Einheimische ihre Ruhe zurück.
Touristen sind aber doch immer die anderen? Auch diejenigen, die mit besten Absichten reisen, sollten sich Fragen stellen. Etwa ob sie, indem sie ihr Ziel von einer "echten" Wohnung in einem der angesagtesten Viertel aus entdecken, nicht im schlimmsten Fall genau den Menschen schaden, die diese zum Leben bräuchten. Gerade für junge Leute sei es immer schwieriger, eine Wohnung in Lissabon zu finden, sagt Isabel Sá da Bandeira von "Aqui mora gente", und fügt hinzu: "Das große Problem ist, dass Touristen hier bald nur noch andere Touristen sehen werden, wenn alle Einheimischen verdrängt worden sind."
Experten wie der Stadtforscher Johannes Novy verweisen zur Lösung in erster Linie auf die Verantwortung der Stadtplaner und Politiker. Diese haben bislang meist klar auf reines Wachstum gesetzt. Die Debatte um die berühmte Nachhaltigkeit, sie bezog sich lange nur auf Umweltschutz und Fernreisen. Dass auch Städte nicht alles aushalten, scheint sich erst nach und nach als Erkenntnis durchzusetzen. Konsequenzen auf politischer Ebene gehen nun von teils strenger Regulierung der Vermietung privater Wohnungen über Eintrittsgeld für besonders begehrte Orte bis hin zur Ankündigung von Tagesobergrenzen für Besucher, wie im italienischen Küstenstreifen Cinque Terre westlich von La Spezia. Venedig diskutiert seit Jahren - noch ergebnislos - über Kontingente und Verbote, Barcelona hat mit Ada Colau seit Sommer 2015 eine Bürgermeisterin, die in der Initiative "Lasst uns Barcelona zurückgewinnen" besonders als Aktivistin gegen Massentourismus bekannt wurde.
Doch es sind auch die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Auf die Frage, was einzelne Touristen dem von ihnen so heißgeliebten Lissabon Gutes tun können, nennt die Anwohneraktivistin Sá da Bandeira nur scheinbar Banales. Etwa, doch bitte keinen Lärm mit Trolleys zu machen, Müll korrekt zu entsorgen und die Tausenden Tuk-Tuks, die binnen kürzester Zeit aus dem Nichts gekommen seien, nicht als typisch misszuverstehen, sondern als echte Belästigung für die Einwohner zu erkennen. Die Stadt habe außerdem viel mehr zu bieten als das überlaufene historische Zentrum.
Damit wiederum liegt Sá da Bandeira ganz auf der Linie von Experten. Diese weisen darauf hin, dass die Probleme nie ganze Städte betreffen, sondern einzelne Viertel wie eine Altstadt oder das Umfeld von Szenemeilen. Das Projekt "Besucherandrang in Städten managen" des niederländischen Thinktanks CELTH etwa kommt zu dem Schluss, dass sich Destinationen auch selbst helfen können: Sie müssen aktiv den Ansturm entzerren. Zeitlich, indem zum Beispiel Eintrittspreise am frühen Morgen günstiger werden, und räumlich, etwa indem das Besichtigen weniger bekannter, weniger zentraler Sehenswürdigkeiten durch verbesserte Infrastruktur erleichtert wird. Dies ist auch im Sinne der Gäste, deren Obsession mit den sogenannten "Must-sees" sich als Bumerang erweist, spätestens wenn sie im Gedränge Gleichgesinnter kaum etwas erkennen können.
Auf der Suche nach der besonderen Stadterfahrung
Johannes Novy, der sich seit zehn Jahren mit dem Phänomen Städtetourismus befasst, ist zudem der Ansicht: Manch problematische Entwicklung beruht auf falschen Annahmen. Vieles werde gerade im Massentourismus von Verantwortlichen damit gerechtfertigt, "dass die Touristen das eben wollen". Doch wer sind überhaupt "die Touristen", und was wollen sie wirklich? Novy sieht am Beispiel Berlin eine gewisse Ironie darin, dass viele Gäste Bewohner ausgerechnet in solchen Gegenden gegen sich aufbringen, in denen sie eine Stadterfahrung suchen, die sie im Zentrum nicht mehr zu finden hoffen.

"Mauer-Specials" mit Russisch Ei, Mauersegmente zum Selbermeißeln und Disney-DDR am Checkpoint Charlie: Der Berliner Tourismus kreist im Jubiläumsjahr völlig um das einstige Hassobjekt. Nur müssen die Besucher dessen Reste erst einmal finden.
Wie entkommen Reisende, die Städte nicht kaputtbesuchen möchten und das Besondere, das Typische suchen, also dem Dilemma? Novy nennt gleich mehrere Möglichkeiten: Zum Beispiel bei der Buchung der Unterkunft genau hinzusehen, um nicht bei der professionellen Zweckentfremdung von Privatwohnungen mitzumachen. Und stattdessen entweder echte " sharing economy" oder aber nachhaltig geführte Pensionen und Hotels zu unterstützen. Schwierig, das vorab zu beurteilen? Der Wissenschaftler verweist darauf, dass manche Städte bereits Informationen zu nachhaltigem Tourismus bereitstellen. Falls das fragliche Ziel dies noch nicht tue, könne man durch Nachfrage zeigen, dass Bedarf besteht.
Zudem gebe es immer mehr Angebote, durch die Reisende die lokale Kultur kennenlernen und unterstützen können. In Berlin-Kreuzberg zum Beispiel habe das alternative Projekt "Regenbogenfabrik" beschlossen, den Tourismus nicht völlig anderen zu überlassen, sondern selbst ein Hostel zu betreiben. Mit diesem werden wiederum Nachbarschaftsprojekte finanziert. Das FHXB Museum von Friedrichshain-Kreuzberg beschäftige einheimische Jugendliche als Stadtteilführer. Auch solche Nischenangebote hält Novy für relevant, allzu lange hätte man sich im Tourismus auf den "vermeintlich klassischen Städtereisenden" konzentriert.
Inwiefern sich ein verträglicherer Städtetourismus entwickeln kann, wird sich also nicht nur an Regulierungsmaßnahmen entscheiden, sondern auch am Verhalten der einzelnen Gäste. Wie viele werden bereit sein, extra Abgaben für Touristen zu akzeptieren oder notfalls auch unbequeme Maßnahmen wie Kontingente? Wie viele werden kleine Geschäfte, Lokale und Unterkünfte bevorzugen und so ein Gegengewicht zum Erfolg der großen Ketten schaffen? Und vor allem: Wie viele werden ohne die berüchtigte "der Gast ist König"-Einstellung Städte besuchen, die eben mehr sind als Ferienorte zum bloßen Vergnügen ihrer Besucher?
"Fragen Sie uns einfach vorher"
Ob und wann es überhaupt möglich sein wird, die Altstadt etwa von Prag oder Venedig wieder zu lebendigen Nachbarschaften zu machen, ist fraglich. Wie ein sanfterer Städtetourismus aussehen könnte, lässt sich aber an Orten erahnen, die bislang weniger von der globalen Reiseindustrie verändert worden sind. Das baskische San Sébastian etwa hat als europäische Kulturhauptstadt 2016 einen "Dekalog des verantwortungsvollen Tourismus" formuliert.
Darin werden ganz konkret die Gäste angesprochen, mit freundlichen Bitten wie: "Wenn Sie abends durch die Bars ziehen, denken Sie daran, dass Menschen direkt über dem Ort schlafen, an dem Sie sich amüsieren. Wenn Sie ihre Ruhezeiten respektieren, werden sie es Ihnen danken." Oder: "Wahrscheinlich lieben Sie es, Erinnerungsfotos zu schießen, um sie Ihren Freunden zu zeigen, wenn Sie nach Hause kommen. Denken Sie daran, dass wir nicht Teil der Landschaft sind. Wenn Sie uns fotografieren möchten, fragen Sie uns einfach vorher. Wir werden bestimmt gern für Sie posieren!"
Einheimische und Touristen als Gegensätze zu verstehen oder gegeneinander auszuspielen, hält Stadtforscher Novy für falsch. Das "Recht auf Stadt" dürfe nicht vom Meldestatus abhängen.
Der Respekt für eine Stadt sollte das aber auch nicht.
Dies ist der zweite Teil unserer Serie "Gute Reise - Wie wir Urlaub machen wollen". Darin widmen wir uns ethischen Fragen des Reisens. Hier die erste Folge: