Schon die erste Anekdote, mit der der Sinologe Frank Dikötter seine Reise durch vier Jahrzehnte des chinesischen Aufstiegs beginnt, fasziniert: Als er 1985 für sein Chinesisch-Studium nach China zog, adressierte ein Freund eine Postkarte an ihn mit "Frank aus Holland, Tianjin, China". Das reichte, zu jener Zeit lebten in der Hafenstadt nur achtzig Ausländer, unter ihnen sieben Niederländer und ein Frank, wie er schreibt.
Diese Zeiten sind längst vorbei: Vierzig Jahre nach Beginn der Reform- und Öffnungspolitik ist China die zweitgrößte Wirtschaft, historische Viertel sind Glastürmen und Hochstraßen gewichen. Postkarten verschickt schon lange niemand mehr, stattdessen dominieren digitale Kommunikationsgiganten. International stehen sich China und die USA als Rivalen gegenüber, Peking gilt als technologische Supermacht mit guten Chancen, das 21. Jahrhundert zu lenken, wie es der Kommunistischen Partei Chinas gefällt.
Immobilienkrise und Strukturprobleme kommen nicht von ungefähr
Umso überraschender wirken die Fragen, die Dikötter in seinem neuen Buch "China nach Mao" zu stellen wagt: Kann man bei diesem Aufstieg wirklich von einem Wunder sprechen? Und hat es eine Zeit der "Reform und Öffnung" überhaupt gegeben, deren Jubiläum Peking gerade groß gefeiert hat?
Doch jetzt ist vielleicht der richtige Moment, um genau diese Fragen zu diskutieren: Zu Hause sieht sich Chinas Regierung mit einer gewaltigen Immobilienkrise konfrontiert, Städte stehen leer, ganze Häuserviertel werden abgerissen, in denen nie jemand gewohnt hat. Das Land ist überschuldet und entwicklungspolitisch in Ost und West zerrissen. Dikötter zeigt, wie viele dieser Strukturprobleme bereits in den 1980ern ihren Anfang nahmen. Derweil propagiert die Kommunistische Partei ihr System weiter als dem Kapitalismus nach amerikanischem Vorbild überlegen. Und gerade im globalen Süden wächst die Zahl der Unterstützer.
Wie kommt das, fragt Dikötter an einer Stelle nun, dass nach vierzig Jahren von "Reform und Öffnung" nicht einmal eine Million Ausländer in China leben, gerade einmal 0,07 Prozent der Gesamtbevölkerung, weniger als in jedem anderen Land und nicht einmal die Hälfte des Anteils von Nordkorea? "Fertige Produkte dürfen in enormen Mengen China verlassen, aber vergleichsweise wenige dürfen tatsächlich importiert werden", beobachtet er. Ein Fünftel der Menschheit dürfe gerade mal 36 ausländische Filme im Jahr ansehen, mehr erlauben die Behörden nicht. Und: "Kapital kann ins Land kommen, aber es ist schwierig, es wieder abzuziehen."
Hunderte Dokumente aus Stadt- und Provinzarchiven
Dikötter hält nichts von chinesischer Kreml-Deutung. Den Versuchen also, Worte und Gesten chinesischer Führer zu deuten, um herauszufinden, was in Peking gedacht und getan wurde. Er orientiert sich lieber an Fakten. Und wie bei seiner Trilogie über das Leben der Chinesen unter Mao, die heute längst zu den Standardwerken über die Kulturrevolution und den "Großen Sprung" gehören, hat er auch für diese Untersuchung chinesische Archive besucht und Originaldokumente ausgegraben. Insgesamt stützt er sich bei seinem Buch auf grob 600 Dokumente aus gut einem Dutzend von Stadt- und Provinzarchiven, aber auch auf unveröffentlichte Memoiren. Allen voran die geheimen Tagebücher von Li Rui, Maos einstigem Privatsekretär.
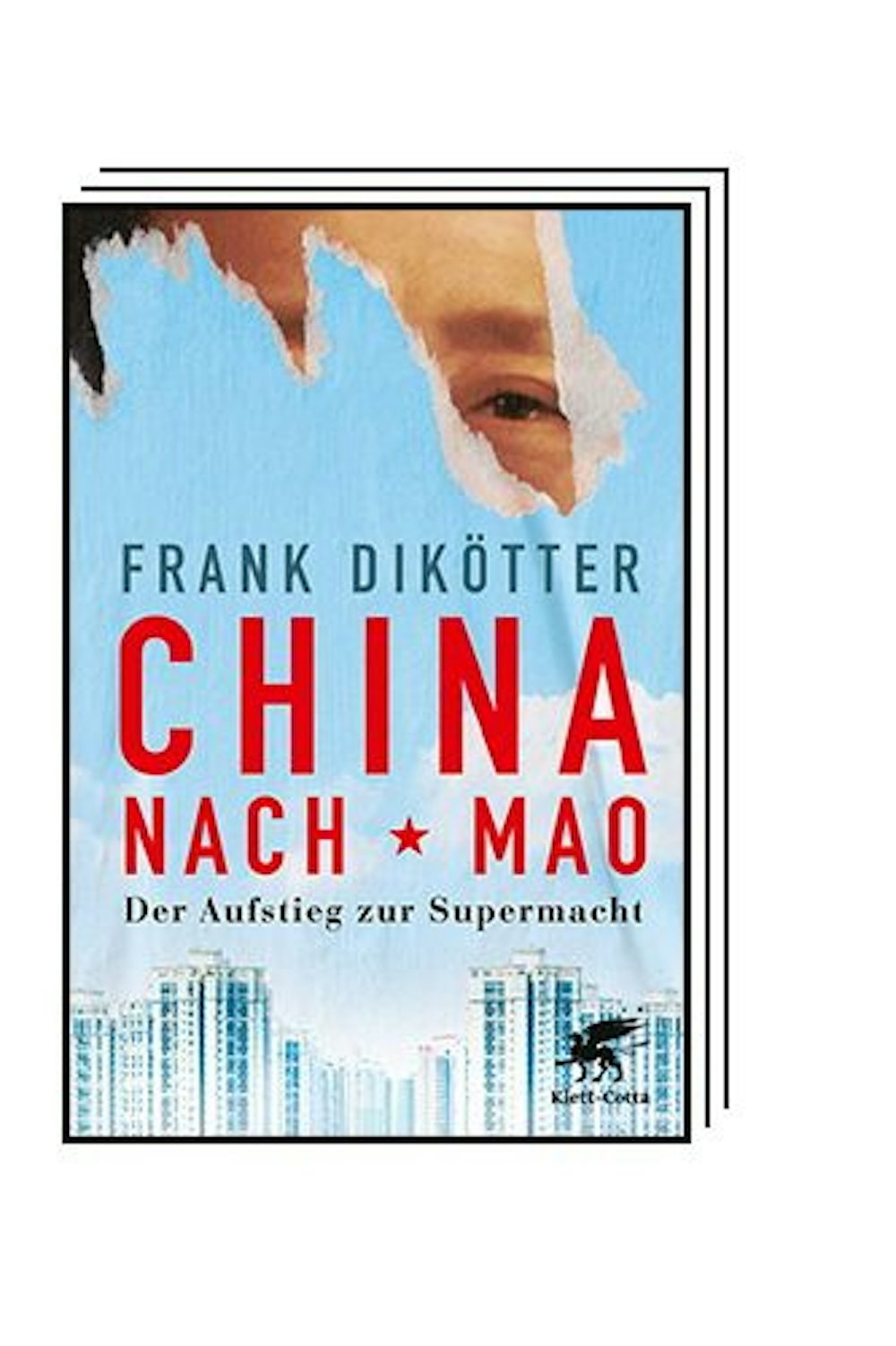
Das Ergebnis ist eine detaillierte, kenntnisreiche Erzählung über einen Aufstieg zwischen Kontrolle, Willkür, Unwissenheit und Chaos, anstelle eines großen Plans sieht er eine Regierung gefangen in "Machtkämpfen zwischen endlos wechselnden Fraktionen", geführt von Funktionären, die meist " keine Ahnung von den Grundlagen der Wirtschaft" haben. Und so seien sie besessen von einer einzigen Kennziffer, die jeder versteht: "Wachstum, häufig auf Kosten der Entwicklung. Das Ergebnis ist Verschwendung in einem gigantischen Ausmaß."
Pekings Leistungen kommen nicht vor
Wenn man an diesem klugen, wahnsinnig sachkundigen Buch einen Mangel sehen wollte, dann liegt er genau hier: Denn Dikötter, der sich sein halbes Leben mit den Verbrechen der Kommunistischen Partei beschäftigt hat, kommt aus dieser Rolle nur schwer heraus: Auf den etwa 400 Seiten arbeitet er sich ab an der Partei und ihren skrupellosen Führern, ihrem absoluten Willen, die eigene Macht zu schützen, im Zweifel auch mit Panzern.
Das ist alles richtig, lässt aber nur wenig Platz für Pekings Visionen, und ja, auch das, für seine Leistungen. Oder anders gesagt: Wären alle Beamten in China nur faul, unfähig und/oder bösartig, stünde China sicher nicht an dem Punkt, an dem es heute ist. Aller berechtigten Kritik an der Natur des Regimes zum Trotz, hätte es dem Buch gut getan, auch Platz für diese Zweifel zu lassen.

