Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Bis zum Dezember 1941 hatte sie das Baltikum, Weißrussland und die Ukraine unterworfen. Die Besatzer kamen mit perfiden Plänen. Ihr Konzept war, so hatte es Hitler bereits in "Mein Kampf" unverhohlen prophezeit, die Gewinnung von "Lebensraum im Osten". Und das hieß, die eroberten Gebiete wirtschaftlich zu ruinieren, die Bevölkerung auszuhungern, zu vertreiben oder in Zwangsarbeit zu bringen. Die jüdische Bevölkerung sollte ermordet werden.
Grete Rebstock hat für ihre Dissertation über die "NS-Zwangsarbeit aus sowjetischer Perspektive" 56 Männer und Frauen interviewt, die im hohen Alter bereit und mutig waren, Erinnerungen an ihre Zwangsarbeit in NS-Deutschland preiszugeben. Das Ergebnis ist eine opulente, quellengesättigte, mit 1446 Anmerkungen versehene Untersuchung. Hier kommen resiliente Menschen zu Wort, die großes Unrecht der beiden totalitärsten Systeme des 20. Jahrhunderts erfahren haben. Rebstock macht gleich zu Anfang ihrer Forschungsarbeit deutlich, dass ihre Studie, die sie im April 2021, lange genug vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fertigstellte, "von der Geschichte eingeholt" wurde. Die gegenwärtigen Zeitläufte wollen es, dass sie die befragten Menschen aus Sicherheitsgründen nicht namentlich nennt.
Brutaler Zwang der Besatzer und Sanktionen aus Moskau
Von der Verpflichtung, Arbeiten für die Besatzer zu verrichten, waren Männer bis zum Alter von 65 und Frauen zwischen 15 und 45 Jahren betroffen. Um die verfügten Kontingente zu erfüllen, wurden selbst Passanten auf offener Straße, Teilnehmer von Festen und Gottesdienstbesucher ergriffen und zu den Sammelstellen gebracht. All diese Maßnahmen hatten die deutschen Besatzer bereits im Ersten Weltkrieg im russischen Okkupationsgebiet praktiziert und infrastrukturelle und logistische Erfahrungen gesammelt, auf die man beim Angriffskrieg gegen die Sowjetunion zurückgreifen konnte.
Wer für die Besatzer arbeitete, wurde vom Obersten Staatsanwalt der Sowjetunion unter den Tatbestand des Landesverrats gestellt und mit der Höchststrafe, der Todesstrafe, belangt. So waren die Menschen in einem Dilemma gefangen: Einerseits hatten sie den brutalen Zwang der Besatzer zu gewärtigen und andererseits hatten sie Sanktionen ihrer eigenen Regierung zu befürchten.
Im Herbst 1944 wurden im Reichsgebiet etwa 13,5 Millionen ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene zwangsweise zur Arbeit eingesetzt, von denen 4,7 Millionen aus der Sowjetunion stammten, die weitaus größte Gruppe, davon fast die Hälfte Frauen.
Schlechte Ernährung und Unterbringung, Angst vor systematischen Misshandlungen sowie sexualisierter Gewalt, Angst vor Luftangriffen, wobei ihnen die Benutzung der Luftschutzkeller verwehrt war, kennzeichneten das Leben der Zwangsrekrutierten in Deutschland. Geschlechtsverkehr mit Deutschen wurde mit der Todesstrafe geahndet. Bei Fluchtversuchen drohte das Konzentrationslager. Es galten maximale Ausbeutung und schärfste Strafmaße.

Die "Ostarbeiter" mussten sich äußerlich kenntlich machen: Auf der linken Brustseite hatten sie ein angenähtes Rechteck mit der weißen Aufschrift "OST" zu tragen. Diese stigmatisierende Kennzeichnung machte für jedermann ihre Minderwertigkeit und Rechtlosigkeit sichtbar. Nach den Kriterien der NS-Ideologie auf der Stufe der Ausländerhierarchie weit unten stehend und als "Untermenschen" tituliert, rangierten nur noch die Juden des Ostens und die "Sinti:zze" und "Roma:nja" unter ihnen. Die "Ostarbeiter" wurden abgesondert von den anderen Fremdarbeitern in eigenen mit Stacheldraht umzäunten Lagern untergebracht.
Verdächtig der Kollaboration und der Spionage
Nach 1945 in die sowjetische Heimat zurückgekehrt, stießen die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter auf Misstrauen und offene Feindseligkeit. Zwangsarbeit für den Feind entsprach nicht dem "im Schatten des Stalinkultes geborenen Ideal von Heroismus und Patriotismus". Wegen des Sprechverbots zogen viele es vor, über ihre schrecklichen Erfahrungen zu schweigen.
In der UdSSR wurden viele von ihnen in das Lagersystem des Gulag verschleppt, weil man sie wegen ihres Aufenthalts im deutschen Machtbereich der Kollaboration mit dem Feind und der Spionage beschuldigte. Nicht wenige wurden hingerichtet. Die sowjetischen Behörden entledigten sich, indem sie ein solches Klima der Verdächtigung und Ausgrenzung förderten, zugleich der Verantwortung für deren Schicksal. Und da war noch etwas anderes: eine allgegenwärtige Angst bei jedem Interviewten, eine Angst, die bis in Gegenwart spürbar ist, Angst vor der engmaschigen Kontrolle des Staates. Denn die Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter hatten, allen Widrigkeiten zum Trotz, mit eigenen Augen die besseren Bedingungen in Deutschland gesehen, etwa den hohen Lebensstandard oder den technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand. Das erklärt, warum ein Teil der "Ostarbeiter" nicht in die Heimat zurückwollte.
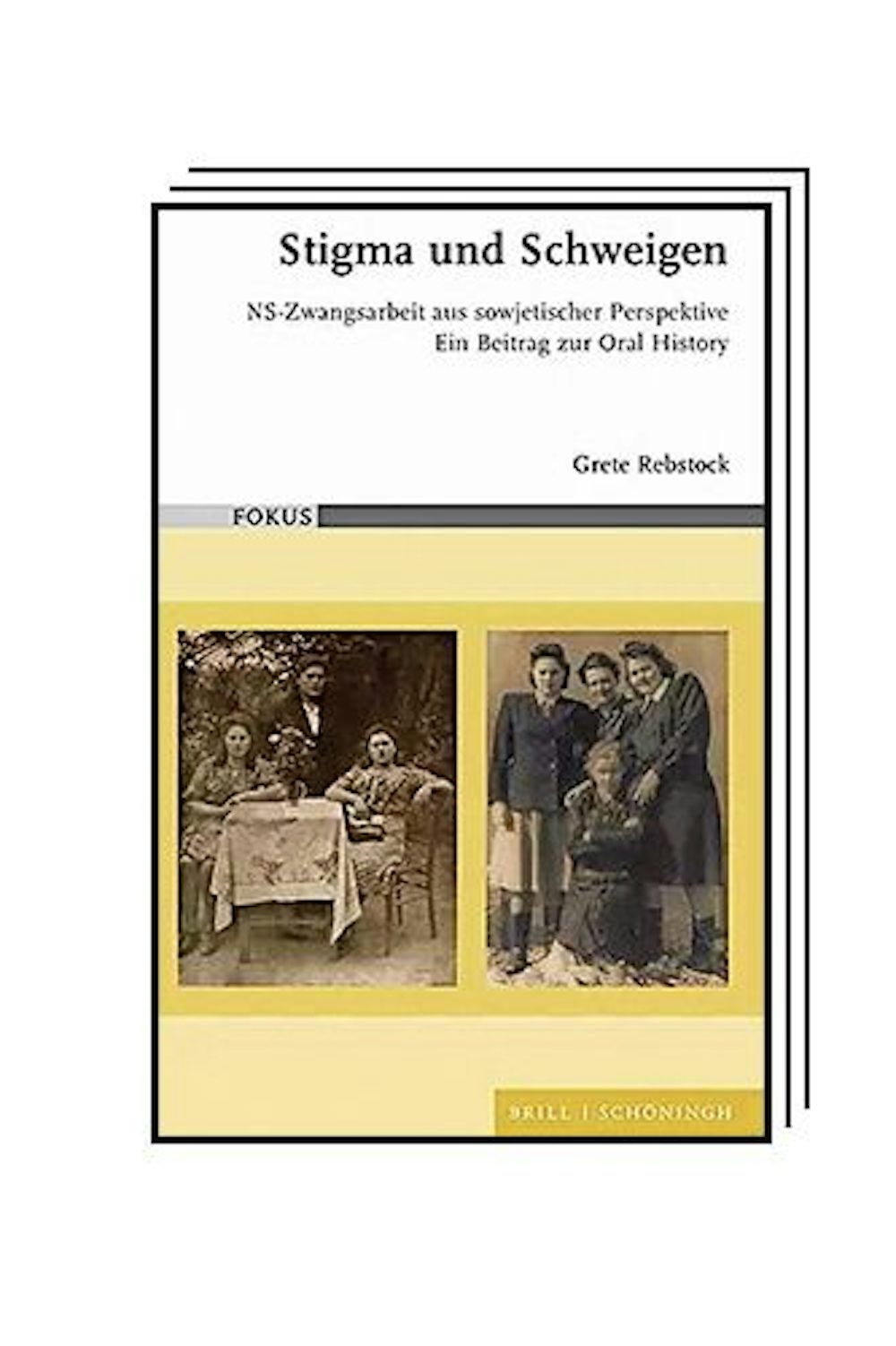
Ein Befragter berichtet über seine vergebliche Suche, nach seiner Rückkehr Arbeit zu finden. Er wollte deswegen nicht mehr weiterleben und sinnierte: "Dort (in Deutschland) konnte mich die SS gebrauchen, man steckte mich ins KZ, aber hier (in der UdSSR) bin ich meiner eigenen Regierung unangenehm, man nimmt mich nicht auf Arbeit." Im historischen Bewusstsein der Menschen in Russland ist die Geschichtspolitik, diese Gruppe zu stigmatisieren, bis in die Gegenwart zu finden. Eine tragische Kontinuität: Eine Anerkennung als eine Opfergruppe ist den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern in ihrer Heimat - auch nach dem Zerfall der Sowjetunion - nie zuteilgeworden.
Auch in Deutschland waren die "Ostarbeiter" lange Zeit vergessen
Marija V. sagte, die Bedingungen in Deutschland seien besser gewesen als im sowjetischen Lager: "Zu gerne hätte ich diese 10 Jahre (im Gulag) in Deutschland im Lager abgesessen." Die Verfolgung durch die "eigenen Leute" nach der Repatriierung wurde als krasse Ungerechtigkeit wahrgenommen. Diese Erfahrungen werfen ein bedrückendes Schlaglicht auf die real existierenden stalinistischen Unterdrückungsmechanismen vor und nach dem Krieg.
Im deutschen Erinnerungsdiskurs hat das Thema "Fremdarbeiter" lange Zeit historiografisch wenig Beachtung gefunden. Erst in den 1990er-Jahren vollzog sich mit den Debatten um das Thema "Sklavenarbeit in NS-Deutschland" ein Paradigmenwechsel, der mit der Einrichtung der Stiftung " Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) im Jahre 2000 und die Auszahlung humanitärer Ausgleichsleistungen an ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter des NS-Regimes ihren Abschluss fand. Bis zum Jahr 2007 wurden 4,37 Milliarden Euro an 1,7 Millionen ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ausgezahlt. Die Stiftung pflegt seitdem einen erinnerungs- und bildungspolitischen Auftrag.
Historische Aufarbeitung ist dem Putin-Regime verhasst
Während Grete Rebstock ihr Manuskript abgeschlossen hatte und auf das Erscheinen ihres Buches wartete, wurde "Memorial", der zentrale russische Kooperationspartner im Rahmen des mit Deutschland ausgehandelten Entschädigungsprogramms, das sich mit den stalinistischen Repressionen und deren historischer Aufarbeitung befasste, vom Obersten Gericht Russlands aufgelöst. Und damit war mit einem Schlag die Arbeit von "Memorial" als Projektpartner des internationalen Interviewprojekts zu NS-Zwangsarbeit faktisch unterbunden.
Das Ergebnis der Rebstock'schen Befragungen sind eigener Einschätzung nach "Raritäten, Ausnahmeerscheinungen und Fundstücke" für die Gesellschaftswissenschaften. Sie sind zugleich eine Fundgrube für die Erforschung der russisch-sowjetischen Zeitgeschichte, für sozialpsychologische Untersuchungen und auch für die politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichtspolitik Wladimir Putins. Ähnliches ließe sich auch auf die deutsche Geschichtsschreibung übertragen, die das in Rede stehende Thema allzu lange hartnäckig beschwiegen hat.
"Stigma und Schweigen" - Grete Rebstocks Titel verweist auf ein zentrales Ergebnis ihrer anspruchsvollen Studie, das eine erschreckende Kontinuität von Sowjetzeiten bis in die Gegenwart Russlands mit seinem real existierenden Angriffskrieg gegen die Ukraine aufscheinen lässt.
Ludger Heid ist Zeithistoriker. Er lebt in Duisburg.

