Paul Nolte, Jahrgang 1963, ist Professor am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der deutschen, amerikanischen und vergleichenden Politik- und Sozialgeschichte der vergangenen 300 Jahre. Nolte ist Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Beiträge, zuletzt erschien "Lebens Werk. Thomas Nipperdeys 'Deutsche Geschichte'. Biographie eines Buches" (C.H.Beck, München 2018).
SZ: In Deutschland rumort es derzeit: Rassismus wird ungeniert zur Schau gestellt, verschiedene Formen von Antisemitismus treten verstärkt in Erscheinung, autoritäre Politiker wie Wladimir Putin werden immer populärer. Erleben wir ein Déjà-vu der Weimarer Instabilität?
Paul Nolte: Mit dem Vergleich zur Weimarer Republik muss man vorsichtig sein, erst recht im Blick auf ihr Ende und den Nationalsozialismus. Das ist nicht unser Szenario. Aber es gibt Parallelen, politisch ebenso wie in Gesellschaft und Kultur.
Was ist denn heute anders als damals?
Ein wichtiger Punkt: Anders als zur Weimarer Zeit gibt es keine Straßenkämpfe. Die Gewaltbereitschaft der real ebenso wie mental militarisierten Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg war immens - vor allem auf der extremen Rechten, aber auch ganz links. Die Friedfertigkeit der bundesdeutschen Gesellschaft, ihre Zivilität, ihre Toleranz ist eine Errungenschaft, ebenso wie die Demokratisierung der Eliten. Das schafft eine ganz andere Stabilität als damals.
Und welche Gemeinsamkeiten sehen Sie zwischen dem heutigen Deutschland und der ersten deutschen Republik?
Zunächst politisch: Das heutige Parteiensystem ähnelt mehr und mehr dem der Weimarer Schlussphase. Wir haben auf der linken Seite zwei Parteien, die fast gleichstark sind und nicht miteinander können. Wir haben eine radikalisierte Rechte. Und schrumpfende Volksparteien, die zusammen eben noch die parlamentarische Mehrheit schaffen. Das sind schon frappierende Ähnlichkeiten in der politischen Mechanik, die man kritisch beobachten muss. Aber wichtiger sind die Parallelen in der politischen Kultur: Populismus und Demokratieverachtung kennen wir von damals, ebenso den Kulturpessimismus und die Angst vor dem Heimatverlust.

Damals hatten die Deutschen gerade einen Weltkrieg verloren - das ist doch eine andere Ausgangslage.
Stimmt, aber im rapiden Wandel und den Reaktionen darauf liegt die Ähnlichkeit. In den Jahrzehnten um 1900 veränderte sich die Welt rasant - technologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich; bis in alle Poren von Alltag und Lebenswelt. Die Industrielle Revolution, mit Bildern von Zechen und Hochöfen und Textilfabriken, vollzog sich zunächst nur inselhaft. Am Anfang des 20. Jahrhunderts folgte eine zweite Welle der Modernisierung: der Kommunikation, der Mobilität, auch der sozialen Hierarchien - eigentlich hat sich das ganze Leben revolutioniert.
Ein kompletter Umbruch der Lebenswelt, so wie er auch durch die Digitalisierung geschieht.
Ja, und das bedeutet natürlich Zumutungen. Ein Beispiel: Ein Berliner, der 1913, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, in die U-Bahn stieg, der würde sich auch heute noch in deren Netz auskennen. Aber für die Landbevölkerung, die noch mit Pferden lebte und wirtschaftete, wurde der Abstand riesig. Dazu kamen die gesellschaftlichen Veränderungen in den zwanziger Jahren, die manche verstörten, allen voran die begonnene Emanzipation der Frauen: Die trugen jetzt Hosen und die Haare kurz, sie zündeten sich auf der Straße eine Zigarette an und durften wählen. Einen ähnlichen Schock löst es heute bei manchen Menschen aus, wenn sich in Berlin-Schöneberg zwei Männer küssen.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte vor einiger Zeit eine "konservative Revolution". Können Sie erklären, welchen historischen Bezug er damit herstellen will?
Das kann man vielleicht historisch erklären, aber kaum politisch verstehen. Der Begriff trägt keine Problemlösung in sich, aber er schillert und provoziert - das ist ja auch seine Absicht. Als Reizwort, das in den zwanziger Jahren in der Weimarer Republik entstand und in den fünfziger Jahren aufgegriffen wurde, signalisiert der Begriff "konservative Revolution" ein Unbehagen in der Demokratie. Er zitiert eine Haltung, die mit dem Feuer spielt.
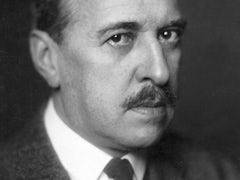
Der CSU-Landesgruppenchef stößt eine fragwürdige Debatte an. Die Begriffe, die er verwendet, entspringen rechtem Gedankengut.
Worauf zielten die Forderungen nach einer "konservativen Revolution" damals?
Es ging nicht nur um den Kampf gegen links, sondern auch die Abgrenzung zum traditionellen Konservatismus. Der schwelgte in Nostalgie für das Kaiserreich, sehnte sich nach der Monarchie, nach der agrarischen und patriarchalischen Welt. Die Verfechter einer "konservativen Revolution" dagegen wollten die Demokratie nach vorne überwinden.
Und welche Staatsform wartete "vorne"?
Etwas Neues, für das damals erst Begrifflichkeiten entstanden: eine Führerherrschaft, eine Expertenherrschaft, eine autoritäre Präsidialherrschaft. Die Vorstellung einer "konservativen Revolution" ruhte auf der festen Überzeugung, dass das Ende der liberaldemokratischen Bürgerlichkeit gekommen sei.
So meint Alexander Dobrindt das sicherlich nicht, oder?
Das wollen wir annehmen; vielleicht war er schlecht beraten. Gleichwohl: Ein Ausrutscher ist das nicht. Der Begriff signalisiert einen Aktionismus, der zum Selbstzweck wird; einen kalkulierten Ausbruch aus einer Ordnung, die als ungenügend empfunden wird - also eigentlich gerade das Gegenteil von "konservativ". Diese Haltung beobachte ich mit Sorge auch in anderen politischen Lagern. Etwa bei Christian Lindner, als er die Jamaika-Gespräche scheitern ließ: Er meinte, irgendwelche dringenden Veränderungen nicht durchsetzen zu können. Aber was daran so dringlich sein sollte, blieb unklar.
Manche verklären heute die Zustände vor 1968, andere vermissen die DDR. Gab es solche Phänomene auch in den zwanziger Jahren?
Nostalgie gab es immer. Aber ein entscheidender Unterschied, wenn Sie 1968 und die DDR ansprechen, ist doch: Auf der Linken gab es damals keine Bezugspunkte dafür. Im Gegenteil, die wollten, jedenfalls links von der SPD, emphatisch nach vorn, die bürgerliche Welt überwinden, vorwärts zum sozialistischen Menschen und zur sozialistischen Gesellschaft. Und die rapiden technischen Veränderungen schienen ihnen recht zu geben: Die Welt ist im Wandel, und alles ist möglich, alles ist machbar. Die radikale Rechte teilte damals viele dieser Impulse: die Überwindung der bürgerlichen Welt, die freilich anders definiert wurde, als verweichlicht, ohne Führung, und nicht zuletzt als national und ethnisch gefährdet. Da sind wir beim radikalen Antisemitismus und der Vision einer homogenen Volksgemeinschaft.
Der Boden, auf dem die Gewaltherrschaft der Nazis wuchs.
Ja, aber unter anderen Vorzeichen auch der buchstäblich rücksichtslose Kommunismus Lenins und der Stalinismus.
Der Weg zu den vermeintlich besseren Zuständen führte doch zwangsläufig über Leichen. War das den Leuten damals nicht klar?
Menschenleben spielten in diesen Vorstellungen tatsächlich keine Rolle. Das Ziel war die große Reinigung der Gesellschaft, die kollektive Katharsis. Solche Utopien sehe ich heute nicht. Die Erfahrungen mit faschistischen Diktaturen, aber auch mit dem Kommunismus haben die Menschen ernüchtert. Das Individuum, seine Würde und seine Rechte stehen an erster Stelle. Das muss, wo es erreicht ist, verteidigt und nicht überwunden werden. Auch deshalb ist der Begriff Revolution, von dem früher Nationalisten und Sozialisten schwärmten, heute negativ besetzt, und selbst die "Reform" ist anrüchig geworden.

Überspitzt könnte man Deutschland heute eine Heidenrepublik nennen - historisch gesehen ging es in Europa ohnehin seit jeher recht morgenländisch zu.
Illiberale Tendenzen finden aber verstärkt Anklang - Donald Trumps Politik und Viktor Orbáns Kampagnen sind aktuelle Beispiele. Erleben wir gerade ein gesellschaftspolitisches Rollback?
Ja, absolut. Damit sind wir wieder bei den Parallelen zur Zwischenkriegszeit. Das Rollback ist eine Reaktion auf die liberalen Zumutungen, die man nicht ertragen kann. Das gilt im umfassenden Sinne: Die verschiedenen Ausformungen von Illiberalität - politisch, gesellschaftlich-kulturell und auch wirtschaftlich, etwa im nationalen Protektionismus - sind alle miteinander verbunden. Besonders frappierend ist die alt-neue Frauenfeindlichkeit; sie ist ein heimlicher Kern und Klebstoff illiberaler Bewegungen.
Sie denken da an Trump und seine Tiraden gegen Frauen?
Während seines Wahlkampfes hat man das etwas zu anekdotisch gesehen. Aber Trumps Verhalten hat wohl etwas Konstitutives: Es sendet seiner Klientel ein Signal, dass man es mit der gesellschaftlichen Liberalisierung seit 1968 doch wohl etwas übertrieben habe. Auch jenseits der USA sehen wir diesen Antifeminismus in nationalistischen und populistischen Bewegungen. Das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit zum Kaiserreich.
Die AfD beklagt einen "Feminismus- und Genderwahn", Björn Höcke behauptet sogar, Deutschland habe seine Männlichkeit verloren. Warum verfangen solche Äußerungen bei manchen Menschen nach wie vor?
Das ist verblüffend, nicht wahr? Ich bin 1963 geboren und in der Gewissheit erwachsen geworden, die Gleichstellung von Mann und Frau sei jetzt selbstverständlich.
Zeit genug war eigentlich, die Zäsur von 1968 ist nun 50 Jahre her.
Aber offensichtlich war dieser Umbruch viel fundamentaler und jenseits liberal-akademischer Milieus eine viel größere Herausforderung als bislang gedacht. Ein Teil der Gesellschaft knabbert immer noch daran. Natürlich führt kein Weg hinter die Frauenemanzipation zurück und auch nicht hinter die Homoehe. Im Gegenteil, da liegen noch Wegstrecken vor uns. Aber wir müssen den Kritikern und den Zweiflern mehr Zeit geben, die Veränderungen zu verdauen, müssen vielleicht besser erklären und Ängste zu entkräften versuchen. Also übrigens: das Gegenteil von "konservativer Revolution".
Haben wir ein Deutschland ein besonderes Problem mit Identität?
Wir haben eine besonders schwierige, eine komplizierte Identität wegen der NS-Diktatur und dem Holocaust. Aber das Arrangement, das wir in langen Konflikten dazu gefunden haben, ist durchaus beeindruckend und trägt: Aus Schuld wächst Verantwortung für die Zukunft einer liberalen Gesellschaft und demokratischen politischen Ordnung.
Von Rechtsaußen wird ein angeblicher "Schuldkult" beklagt.
Für die Mehrheit der Deutschen gehört es mühelos zur Identität, reflektiert, wach und ehrlich mit der Vergangenheit umzugehen. Und es bedeutet ja nicht, dass man gebückt durch die Welt geht. Wenn das Leute wie Björn Höcke anders empfinden, zeugt das davon, wie unsicher ihr Selbstverständnis ist. Höcke und seine Leute sind von Angst getrieben, und sie kalkulieren mit Ängsten.
Werden Populisten wie Höcke künftig den öffentlichen Diskurs dominieren?
Ich bin nicht so pessimistisch, was die aktuelle Diskurshoheit angeht - das zeigt auch die überwältigende Zurückweisung des neuen Antisemitismus, wie schwer dessen Bekämpfung dann auch immer ist. Manche Debatten müssen wir offenbar neu führen. Das ist sogar wichtig, um die Argumente wachzuhalten: Warum ist das Holocaust-Mahnmal in der Mitte Berlins richtig und wichtig? Wie fängt Ausgrenzung an, und was kann man dagegenhalten? Aber wir müssen nicht mehr über jedes Stöckchen springen, das die AfD hinhält.
Was für ein Deutschland propagiert diese Partei eigentlich?
Das weiß sie wohl selber nicht so genau. Das Frauenwahlrecht würde wohl nicht angetastet. Viele Forderungen würden an der Realität zerschellen, gerade in der Europapolitik. Aber klar ist doch: Nationalismus, Protektionismus, Abwehr gegenüber "Fremdem" stehen im Vordergrund, also ein Deutschland nach dem Vorbild Viktor Orbáns, eine "illiberale Demokratie". Vor allem aber: Es ist ein Weltbild des Ressentiments, mit immer neuen Verschwörungstheorien und Sündenböcken. Im Prinzip ist das ein Weltbild des permanenten Betrogenwerdens. Das Problem ist: Diese Vorstellung hat sich schon stark in die Gesellschaft eingefressen.
Das erinnert an die Behauptung, nach der "Politiker ja sowieso lügen" würden.
Diese Art von Verschwörungstheorien haben wir zu lange wuchern lassen, wir haben nicht entschieden genug widersprochen. Der politische Populismus kam erst später, aber fand in dieser Suggestion einen fruchtbaren Boden. Die Welt ist falsch, eine Verschwörung der Eliten, der Medien, der Linken, der Liberalen. So sind wir in eine Krise des Weltvertrauens geschlittert, die zugleich eine Krise des Selbstvertrauens ist. Hier begegnen sich gekränkte Männlichkeit und eine Sorge um "christliche" Werte, die einem selber längst entglitten sind. Selbstverständlich gibt es echte Probleme, und der Umgang mit Migration ist diskussionswürdig ebenso wie die Energiewende oder die weitere Vertiefung der Europäischen Union. Aber die Populisten und Verschwörungstheoretiker erreicht ein solcher rationaler Diskurs oft nicht mehr: Sie sind im falschen Film.
Wie bekommt man die Leute da wieder raus?
Natürlich kann man Sozialleistungen erhöhen, die ärztliche Versorgung auf dem Land verbessern; man kann versuchen, denen in einer offener gewordenen Welt, und offener gewordenen deutschen Gesellschaft, wieder mehr "Heimat" zu geben. Aber die AfD hat auch in Großstädten hohe Stimmanteile erreicht, und keineswegs nur bei sozial Schwachen und "Abgehängten". Alle rationalen politischen Bearbeitungsversuche stoßen an Grenzen bei Menschen, die von der Suggestion beherrscht werden, dass heute alles falsch ist und früher alles besser war. Denn oft geht es den Leuten gar nicht darum, ob ein Krankenwagen eine halbe Stunde früher an sein Ziel in der Uckermark kommt oder der Dorfbäcker wieder aufmacht. Und nicht zuletzt: Heimat hin oder her, sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass ein Muslim ihr Nachbar, eine Frau mit dunklerer Hautfarbe ihre Arbeitskollegin ist und dass sich zwei Männer auf der Straße küssen.
Was kann man denn dann tun?
Am wichtigsten ist es, bei sich selber anzufangen: Zivilcourage. Nicht schweigen, wenn jemand im eigenen Umfeld - in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz - seine Ressentiments und Verschwörungstheorien äußert, und sei es scheinbar harmlos und leichthin. "Die Politiker lügen sowieso." "Die Flüchtlinge beuten sowieso nur unsern Sozialstaat aus, und an uns denkt niemand." Dann sollten wir sagen: Du, das sehe ich anders! Aber das erfordert Mut.

