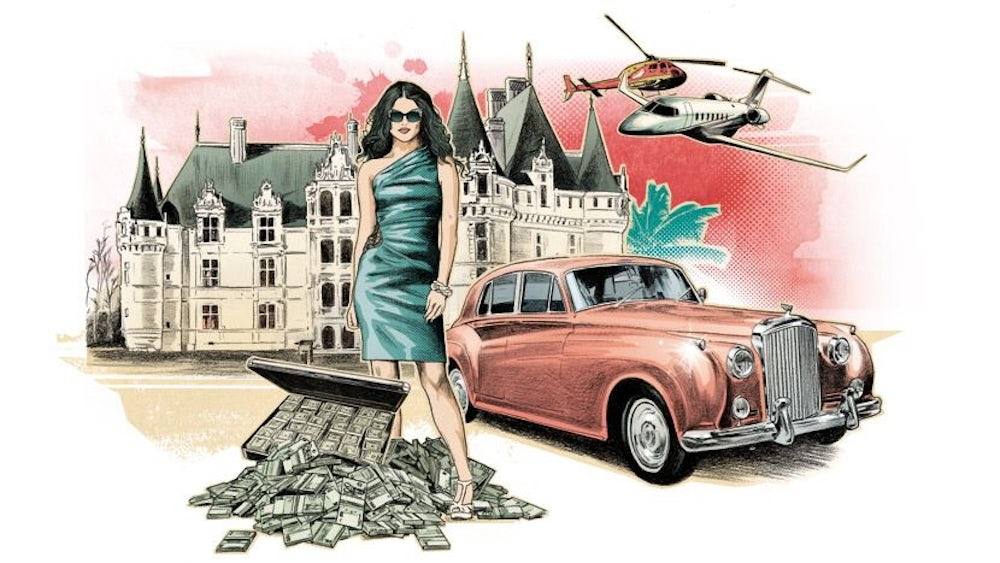Hawaii, der Inselbundesstaat im Pazifik, ist für alle Lebenslagen gerüstet. Möchte ein Liebespaar seine Hochzeit im Sonnenuntergang feiern, so kann es Pauschalangebote an diversen Stränden buchen, einschließlich örtlicher Musiker, die in bunten Hemden auf der Ukulele spielen. Möchte sich ein Ehepartner wiederum scheiden lassen und sucht er jemanden, der Zivilklagen zustellt, so finden sich ebenfalls engagierte lokale Dienstleister.
Einer von ihnen ist Christopher Williams, ein freiberuflicher Gerichtsvollzieher, der meist Räumungsklagen überreicht, zuweilen aber auch Scheidungsfälle übernimmt. Als Überbringer schlechter Nachrichten ist er doppelt gerüstet: Er beherrscht Kampfsportarten, hält sich aber gleichzeitig für sehr einfühlsam. Ende 2010 legt er sich so ins Zeug, als wäre er Privatdetektiv: Er lauert am Flughafen von Lihue, nordwestlich von Honolulu auf Kauai, und lässt dabei eine versteckte Kamera laufen.
Diesmal wartet er nicht auf einen säumigen Mieter, sondern auf einen russischen Oligarchen, den das Magazin Forbes für einen der reichsten Menschen überhaupt hält. Er heißt Dmitrij Rybolowlew und ist Mitte vierzig; nach dem Ende der Sowjetunion hat er mit dem Verkauf von Düngemittel sagenhaften Reichtum angehäuft. Man nennt ihn den "Kali-König". Allein seine Kunstsammlung soll Hunderte Millionen Dollar wert sein.
Aber natürlich sind auch Oligarchen nur Menschen. Rybolowlew soll untreu gewesen sein, Ehefrau Jelena verlangt die Scheidung, nun streiten sie sich unter anderem um ein Anwesen mit Palmenhain an der hawaiianischen Küste, welches der Ehemann von dem Schauspieler Will Smith gekauft haben soll. Deswegen hat Jelena Rybolowlewa nun den Gerichtsvollzieher engagiert: Er soll ihrem Mann eine Zivilklage in die Hand drücken; so möchte sie ihre Ansprüche auf das Haus anmelden.
Der Gerichtsdiener Williams behauptet, er habe die Klage damals tatsächlich an den Mann gebracht - wenn auch nur unter schwerem körperlichen Einsatz. Sein Film zeigt Geländewagen, die durch ein Tor fahren, mutmaßlich die des Oligarchen. Da springt Williams auf, jagt ihnen nach, gelangt an das offene Fenster eines fahrenden Wagens, keucht, ruft "Dmitrij!" (Den Nachnamen sagt er nicht, weil er ihn nicht aussprechen kann.) Auf dem Film lässt sich der Adressat zwar nicht erkennen, trotzdem ruft Williams "served" - "hiermit zugestellt".
So skurril der vermeintliche Beweisfilm auch ist: Er veranschaulicht, mit welchem Aufwand die reichsten Ehepaare der Erde operieren, wenn sie am Ende ihrer Beziehung um weltweit verstreutes Vermögen kämpfen. Der Rosenkrieg der Rybolowlews hat jahrelang vor der gesamten Weltöffentlichkeit stattgefunden. Es ist bekannt, dass die Ehefrau ihren Mann verdächtigte, das gemeinsame Vermögen zu verstecken. Dmitrij Rybolowlew hat diesen Vorwurf stets zurückgewiesen, und im vergangenen Herbst einigten sich beide Seiten schließlich auf einen Vergleich.
Dennoch ist die Geschichte der Rybolowlews noch immer ein Schulfall dafür, wie die reichsten Menschen ihr Geld und ihre Güter auf Steuerparadiese verteilen. Und was das bedeutet, wenn die Ehe kaputt ist und es gilt, das Vermögen nicht nur aufzuteilen, sondern überhaupt wiederzufinden. Interne Dokumente der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca verraten, mit welcher Dringlichkeit die Anwälte Jelena Rybolowlewas im Scheidungsverfahren versuchten, Gemälde, Möbel und eine Yacht sicherzustellen, von denen sie glaubten, der Ehemann habe sie böswillig verschwinden lassen.
Das Material, das der Süddeutschen Zeitung zugespielt und von Journalisten weltweit ausgewertet worden ist, zeigt ferner, dass die Kanzlei ihre Verschleierungsdienste wohl auch bewusst im Zusammenhang mit Ehescheidungen geleistet hat. Vermögende Kunden (meist Männer) baten die Offshore-Experten bei Mossack Fonseca, Geld vor jemandem zu verstecken, den sie wohl noch mehr fürchteten als das Finanzamt: die eigene Ehefrau. Die Berater, denen nichts Menschliches fremd zu sein scheint, zeigten sich hilfsbereit.
Scheidungen sind, wenn man das Emotionale ausblendet, letztlich auch nur ein Kuhhandel. Wie im Film "Ein (un)möglicher Härtefall" mit George Clooney sitzen sich am Ende die Anwälte beider Seiten gegenüber. Der Anwalt der Frau sagt: "Meine Mandantin ist bereit, sich mit 50 Prozent des Vermögens zufriedenzugeben." Der Anwalt des Mannes heuchelt Entrüstung: "Was? Warum nur 50? Warum nicht 100? Und wenn wir schon träumen, warum nicht 150?"
Aber die Vorausschauenden unter den Reichen lassen es gar nicht so weit kommen. Entweder schließen sie rechtzeitig einen Ehevertrag ab, der den Schaden sozusagen von vornherein begrenzt. Oder aber sie wählen den kreativen Weg und sorgen mit Hilfe von Verschleierungsprofis wie der Kanzlei Mossack Fonseca dafür, dass 100 Prozent des Vermögens erst gar nicht zur Debatte stehen, weil ein Großteil davon in Stiftungen und Briefkastenfirmen verschwunden ist.
In einem E-Mail-Wechsel Anfang 2015 zum Beispiel, gefunden in den Panama Papers, diskutieren zwei Mitarbeiter Mossack Fonsecas über die Wünsche eines Mandanten aus Thailand: Der möchte wissen, wie er ein Treuhand-Vermögen vor seiner Frau schützen könne. "Sollte die Ehefrau die Begünstigte sein und die Kinder noch minderjährig - wie lässt es sich da verhindern, dass einem die Frau bei der Scheidung das ganze Vermögen wegnimmt? Gibt es einen Königsweg?", fragt ein Mitarbeiter den anderen.
In Ecuador haben Mitarbeiter Mossack Fonsecas einem Mandanten Tarnfirmen angeboten, weil der Mann rechtzeitig vor der Scheidung "Vermögenswerte übertragen" wollte. In einem anderen Fall schrieb ein Mitarbeiter der Kanzlei in Luxemburg augenzwinkernd an einen Kollegen: "Der folgende Fall dürfte eine leichte Herausforderung für Dich sein. Aber benutze Dein Wissen nicht für Dich persönlich ;-) Also: Ein Niederländer möchte Teile seines Vermögens schützen vor den unangenehmen Folgen einer Scheidung (am Horizont!). Was empfiehlst Du? Kann man eine altmodische Stiftung benutzen, um den Zugang der Ex-Frau zu verhindern?"

Ein interaktiver Überblick über die Offshore-Welt der Mächtigen.
Manchmal, aber selten, ist es die Frau, die Geld versteckt. So findet sich in den Unterlagen Mossack Fonsecas auch der Fall einer Frau aus Peru, die mit einem mächtigen Mann verheiratet war. Ihren Vermögensberatern verriet sie, dass sie Tarnfirmen benutzte, um ihrem Mann geerbtes Geld zu verheimlichen.
Im Fall Rybolowlew gegen Rybolowlewa wurde ein Betrug zwar nie bewiesen, aber auch hier standen das abgrundtiefe Misstrauen zwischen den Eheleuten und der Verdacht von Offshore-Schiebereien im Mittelpunkt. Die Ehepartner hatten sich als Medizinstudenten kennengelernt und 1987 in Russland geheiratet. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs wandelte er sich zum Geschäftsmann und handelte mit Kaliumchlorid. Mitte der 90er-Jahre zog er mit Frau und beiden Töchtern in die Schweiz. Schließlich verlangte sie am 22. Dezember 2008 vor einem Genfer Gericht die Scheidung. Nach Schweizer Recht stand ihr damit die Hälfte des gemeinsamen Vermögens zu.
Die Rybolowlews waren, so erklärten es ihre Anwälte, "fabelhaft reich". In der globalen Liste vermögender Menschen von Forbes stand der Mann an 59. Stelle; der Lebensstil der Familie war entsprechend. Unter anderem wiesen die Anwälte der Frau auf eine "sehr beeindruckende Sammlung moderner Kunst" hin, dazu gehörten Gemälde von Modigliani, Picasso, van Gogh, Monet und Rothko.
Allerdings war es zumindest für die Frau schwierig, die Vermögensverhältnisse zu entwirren und der Reichtümer habhaft zu werden. Erstens hatte Dmitrij Rybolowlew lange vor der Scheidung einen Großteil seines Vermögens an Treuhand-Konstrukte auf Zypern übertragen, um angeblich die Töchter zu versorgen; und jetzt war unklar, ob dieses gewachsene Vermögen zur Scheidungsmasse gehörte.
Vor allem aber fungierten als Eigentümer der kostbaren Gemälde, der Möbel und der Yacht nicht Herr und Frau Rybolowlew selbst, sondern drei Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln. Die Ehefrau wusste nicht genau, ob sie auf diese Firmen Einfluss hatte, jedenfalls fürchtete sie, dass ihr Mann die Firmen allein kontrollierte und die Kostbarkeiten somit jederzeit verschwinden lassen konnte. Die Briefkastenfirmen hatte einst Mossack Fonseca eingerichtet.
Aus Sicht der Frau schien sofort klar zu sein, dass sie ihren Anteil am gemeinsamen Vermögen nur mit einem globalen Kraftakt würde eintreiben können. Bereits eine knappe Woche nach Beginn des Scheidungsverfahrens in Genf, am 30. Dezember 2008, erschienen drei ihrer Anwälte vor einer Richterin auf Tortola, der Hauptinsel der British Virgin Islands (BVI). Die Advokaten dankten "Eurer Ladyschaft", dass sie sich zwischen Weihnachten und Neujahr Zeit nahm und entschuldigten sich, weil sie wegen der Feiertage nur mäßig vorbereitet waren.
Nach diesen Höflichkeiten erläuterten sie ihren Verdacht, dass Dmitrij Rybolowlew die Familienschätze verschwinden lasse. Die Gemälde zum Beispiel, darunter van Goghs "Landschaft mit Olivenbaum" und "Pierrettes Hochzeit" von Picasso - seien immer in Genf gelagert worden, wo die Familie auch lebte. Doch nun seien mehrere dieser Bilder nach Singapur und London verschoben worden. Die Anwälte erwähnten auch kostbare Möbel sowie die gemeinsame Yacht My Anna, die 60 Millionen Dollar gekostet habe und nominell einer Briefkastenfirma namens Treehouse gehöre. Frau Rybolowlewa fürchte, so erklärten es ihre Vertreter, dass ihr Mann die Yacht aus dem Hoheitsgebiet der Jungferninseln oder der Schweiz entfernen und ihr somit entziehen würde.
Am Ende sah auch die Richterin ein "echtes Risiko", dass sich Boot, Bilder und andere Güter der russischen Klägerin "auflösen" könnten. Das Gericht ordnete an, die Vermögenswerte der Briefkastenfirmen vorübergehend einzufrieren.
Der Fall Rybolowlew aber beschäftigte nicht nur die Justiz auf den Jungferninseln, sondern auch in einem knappen halben Dutzend anderen Ländern, wie Schweiz, England, Singapur, Zypern, USA. In Amerika erregte Dmitrij Rybolowlew damals mit mehreren Immobilienkäufen Aufsehen: ein Penthouse am Central Park in Manhattan für 88 Millionen Dollar, ein Anwesen Donald Trumps in Palm Beach für 95 Millionen sowie das Haus von Will Smith in Hawaii für 20 Millionen Dollar.

Exklusiv
Der Formel-1-Star verhandelte womöglich selbst einen Vertrag mit Mercedes, den dann eine Briefkastenfirma abschloss. Ein seltsames Geschäft.
"Er wirft Geld aus dem Fenster wie ein betrunkener Seemann", spottete David Newman, ein Anwalt der Frau. Auch er unterstellte, dass der Oligarch sein Geld mit allen Mitteln in Sicherheit bringen wollte. Jelena Rybolowlewa wiederum machte ihr Recht an den Immobilien geltend, deswegen verpflichtete sie etwa in Hawaii den Gerichtsvollzieher Williams mit seiner versteckten Kamera.
Dmitrij Rybolowlew ist ein medienscheuer Mann, auf Anfrage hat er für diesen Artikel nicht Stellung genommen. Es ist nie bewiesen worden, dass er mit dem Vorsatz handelte, Vermögen vor seiner Frau zu verstecken; er selbst hat das mehrmals bestritten. Aber in Fällen dieser Art liegt der Verdacht natürlich nahe. "Je größer die zeitliche Nähe mancher Geschäfte zu einer Scheidung ist, desto wahrscheinlicher, dass ein Ehepartner versucht, den anderen zu betrügen", sagt Sanford Ain, ein Anwalt in Washington.
Natürlich kann es Betrug und damit eine Straftat sein, Familienvermögen zu verstecken, um es bei der Scheidung nicht teilen zu müssen. Die Kanzlei Mossack Fonseca hat auf Anfrage erklärt, sie bedauere "jeden Missbrauch von Firmen, die wir gründen oder von Diensten, die wir anbieten. Wo immer es möglich ist, leiten wir Schritte ein, um solchen Missbrauch aufzudecken oder zu beenden." Aber die geleakten Dokumente über Fälle aus Thailand, Luxemburg und Ecuador legen nahe, dass die Mitarbeiter Bescheid wussten, dass manche Mandanten ihr Geld absichtlich vor ihren künftigen Ex abschotten wollte.
Im Fall der Rybolowlews urteilte die Genfer Justiz zunächst im Jahr 2004, dass die Frau 3,3 Milliarden Euro erhalte, womit das als teuerste Scheidung der Geschichte galt. In zweiter Instanz aber wurde das in Zypern treuhänderisch verwaltete Vermögen anders bewertet, und die Richter sprachen der Frau nur noch eine halbe Milliarde zu. Im Herbst vergangenen Jahres legten die Eheleute den Streit schließlich bei. Wie viel Geld sie von ihm bekam, ist ein Geheimnis geblieben.
Aber der Fall dürfte noch lange als Warnung dafür dienen, dass besonders Ehefrauen auch leer ausgehen können. Vor allem dann, wenn sie nicht genug Bargeld besitzen für globalen Rechtsbeistand. Der Anwalt Sanford Ain aus Washington sagt, er habe in einem Scheidungsfall eine Frau gegen den Mann vertreten - und dessen Firmengeflecht habe er nur mithilfe eines Diagramms durchschauen können. "Es sah aus, als hätte man einen Haufen Spaghetti aufs Papier geworfen." Es habe zwei bis drei Millionen Dollar gekostet, alle Vermögenswerte zu ermitteln. Solche Anwälte muss man sich erst einmal leisten können.
Die Gewinner im Fall Rybolowlew sind die Dienstleister in der Welt der Steueroasen. Allein auf den Jungferninseln: Die örtliche Filiale Mossack Fonsecas half dabei, die Eigentumsverhältnisse der russischen Familie zu verschleiern. Eine andere Kanzlei auf Tortola half der Frau später dabei, Bilder und Boot aus einer Briefkastenfirma ins wirkliche Leben zurückzuholen.
Verhüllungs- oder Enthüllungsindustrie - lukrativ ist sie in jedem Fall.
Mitarbeit: Will Fitzgibbon