Unter Psychologen und Psychiatern, die zu den Auswirkungen des Internets auf den Menschen forschen, kommt als Antwort auf die Frage nach ihrer Einschätzung des wissenschaftlichen Fortschritts oft die Antwort: Das Wichtigste wissen wir eigentlich schon. Es gibt keine Zweifel, dass es zu Stress führen kann, wenn mit der Vernetzung von Menschen der ständige Vergleich und damit der Konkurrenzdruck zunimmt. Dass massiver Informationsfluss als Überforderung wahrgenommen und die Möglichkeit des permanenten Konsums bei unzureichender Fähigkeit zur Impulskontrolle zu Kontrollverlust führen kann. Auch was dagegen zu tun ist, scheint klar zu sein.
Der Berliner Psychiater Mazda Adli, der kürzlich ein bemerkenswertes Buch über die Auswirkungen des Stadtlebens auf die Gesundheit veröffentlichte, brachte das in einem Gespräch auf den Punkt: Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen der Moderne. Im Zentrum der Untersuchung stehen aber letztendlich nicht die Metropolen oder einzelne neue Technologien wie das Fernsehen oder das Internet, sondern die Frage, was der Verlust von haltgebenden Traditionen und göttlich gegebenen Moralvorstellungen mit den Menschen macht. Und welche Folgen die damit verbundene permanente Zunahme an Verantwortung für das eigene Leben und das der eigenen Kinder hat.
Eine Weile schien sich nicht nur unter Wissenschaftlern, sondern auch bei immer mehr Eltern die Einsicht durchzusetzen, dass die beste Lösung darin besteht, gesellschaftliche Veränderungsprozesse aktiver zu gestalten. Etwas zu tun gegen eine entfesselte Marktwirtschaft mit ihrer perfiden Verführung zum Dauerkonsum und gegen die Haltlosigkeit der Einzelnen in zunehmend fragmentierten sozialen Strukturen.
Kinder verbringen ihre Zeit immer noch am liebsten mit Freunden, Lesen, Fußballspielen
Doch nun erschien ein Artikel der amerikanischen Psychologin Jean Twenge im Magazin The Atlantic, der unter Eltern und auch einigen Wissenschaftlern wieder für neue Zweifel gesorgt hat. Unter dem Titel "Have Smartphones Destroyed a Generation?" (Haben Smartpones eine Generation zerstört?) mischt Twenge Anekdoten aus Kontakten mit Jugendlichen und ausgewählte Studien und Statistiken zu einer eindrücklichen emotionalen Mischung, die am Ende nur ein Urteil zulässt: Seit Smartphones den Alltag von Jugendlichen erobert haben, sind sie ganz anders als die Jugendlichen der Generationen vor ihnen.
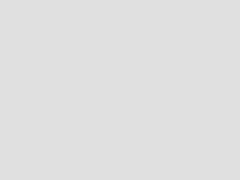
Die Tricks, die soziale Netzwerke einsetzen, erinnern an die Methoden von Zauberkünstlern. Hauptsache, der Nutzer schaut möglichst selten weg.
Sie verlieren ihre sozialen Fähigkeiten, sind viel einsamer und depressiver. Dieser Eindruck wird im Artikel mit anschaulichen Zahlen und Grafiken untermauert, die zeigen, wie es seit der Einführung des iPhones bergab geht bei ihnen. Die Zahl der Jugendlichen, die Sex haben, hat laut einer US-Studie um 40 Prozent abgenommen. Die Zahl der älteren Jugendlichen, die sich ihr eigenes Geld verdienen, sei von 77 auf 55 Prozent gesunken. Als alarmierendes Zeichen sieht Twenge auch, dass sie später und seltener den Führerschein machen, sie sind also unselbständig und wollen herumgefahren werden.
Angestiegen sei dagegen die Zahl der Jugendlichen, denen es aufgrund von Smartphones schlecht geht. Um 56 Prozent erhöht sei das Risiko für "schlechte Stimmung" bei Jugendlichen, die zehn oder mehr Stunden pro Woche mit ihrem Smartphone verbringen. Diese Zahlen klingen in der Tat beängstigend. Sie sind in dieser Form jedoch falsch.
Die Mahnerin stellt willkürliche Zusammenhänge her
Die Psychologin Sarah Cavanagh hat bereits eine sehr kluge Entgegnung für die Zeitschrift Psychology Today geschrieben, in der sie darlegt, wie Twenge in ihrem Artikel nur Studien auswählt, die ihre Thesen untermauern und solche abtut, die ihr widersprechen. Dass die Vernetzung durch das Internet für Jugendliche hilfreich sein kann, gerade wenn sie unter Depressionen oder Ängsten leiden, weil sie dort Freunde finden können und Zugang zu Hilfsangeboten haben.
Cavanagh kritisiert auch, dass Twenge Zusammenhänge herstellt, die willkürlich sind. Denn genauso, wie Twenge den Rückgang von Sexualkontakten unter Jugendlichen auf die Einführung des iPhones zurückführt, kann man auch die Dating-App Tinder für den Anstieg der Geburtenrate in den letzten Jahren verantwortlich machen. Oder eine Zunahme der lokalen Storchenpopulation. Zuletzt führt Cavanagh aus, dass man eine neue Generation, die weniger raucht, weniger trinkt und weniger Auto fährt, wohl kaum als eine zerstörte Generation bezeichnen kann.
Die gerade erschienene deutsche "Kinder-Medien-Studie" gibt auch bezüglich des Medienkonsums Entwarnung: Kinder sind immer noch am liebsten direkt mit ihren Freunden zusammen und genauso gerne, wie sie etwas mit dem Smartphone machen, lesen sie auch oder spielen Fußball. Nur lesen solche Studien wahrscheinlich deutlich weniger Eltern als dramatische Essays ehrlich besorgt wirkender Wissenschaftler in Medien mit weiter öffentlicher Verbreitung.
Das Dramatische an Warnungen solch charismatischer Wissenschaftler ist, dass sie so verführerisch sind, weil sich viele Eltern in ihren anekdotischen Erzählungen sofort wiedererkennen. Denn natürlich wissen die meisten Eltern, was passiert, wenn man einem Kind ein Smartphone in die Hand drückt und es uneingeschränkt damit daddeln lässt: Es macht immer weiter, wird irgendwann reizbar und will das Ding nicht mehr hergeben. Das ist zweifelsohne besorgniserregend. Aber es ist ein Fehler, die Schuld daran der Technologie zu geben. Sie ist vor allem in den gesellschaftlichen Umständen zu suchen, die das Verhalten der Kinder (und vieler Erwachsener) begünstigen und wahrscheinlich sogar mitverursachen.
Generationen überbesorgter Eltern sind herangewachsen
Getrieben von einer unendlichen Flut an Ratgebern, sind Generationen überbesorgter Eltern herangewachsen, die ihre Kinder vor allen Gefahren des Lebens schützen wollen, weil sie Angst haben, durch Versäumnisse schuld zu sein an deren zukünftigem Scheitern. Doch das führt fatalerweise zum Gegenteil, weil den Kindern durch das ständige Abschirmen die Möglichkeit genommen wird, echte Herausforderungen zu meistern und durch diese Erfahrung das Gefühl zu entwickeln, den Herausforderungen der sie umgebenden Welt gewachsen zu sein. Einer Welt, die sie häufig durch permanenten Nachrichtenkonsum in ihrem Umfeld schon früh als schrecklich und bedrohlich wahrnehmen.
Das Resultat dieser Erziehung sind Kinder, die wie gemacht sind dafür, sich hinter einem Smartphone zu verkriechen. Weil es dort für sie zunächst keine spürbaren Gefahren gibt, aber eine Befriedigung ihrer sozialen Bedürfnisse und ihres Spieltriebs. Was ihnen jenseits des Smartphones aufgrund der Angst ihrer Eltern vor Misserfolgen, Zecken und Alkoholvergiftungen kaum noch unbefangen möglich ist.
Es steht völlig außer Frage, dass man ein Kind nicht stundenlang allein mit einem Smartphone versacken lassen sollte. Man muss ihm beibringen, warum es wichtig ist, Contenance bewahren zu können und nicht impulshaft auf jeden Reiz zu reagieren. Weil es nur dann zu einem autonomen Wesen werden kann, das die Möglichkeit hat, aus sich selbst heraus zu entscheiden, wie es leben und sich verhalten will. Wann es zum Beispiel die Möglichkeiten des Internets nutzen und wann das Smartphone weglegen will, um etwas anderes zu tun.
Medienverzicht führt nicht unbedingt zu besserem Sozialverhalten
Man muss ihm, bevor man es mit den sozialen Medien und Messengerdiensten allein lässt, vermitteln, dass geschriebene Nachrichten möglicherweise anders beim Empfänger ankommen als gesprochene Worte. Und dass Privatsphäre nicht primär heißt, dass Mama und Papa nicht mitlesen dürfen, sondern dass man seine Daten nicht ominösen Datenhändlern im Internet überlassen darf und sich gegen staatliche Überwachung wehren muss, weil man sonst irgendwann die Möglichkeit zur informationellen Selbstbestimmung aufgibt, die grundlegend ist für eine psychisch gesunde Gesellschaft.
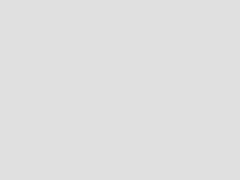
Autoren wie Manfred Spitzer und Harald Welzer sowie der "Spiegel" erklären das Smartphone zur gefährlichen Droge. Jenseits der Hitparaden-Literatur gibt es klügere Gedanken.
Die Mahner und Warner, die von der Angst anderer Menschen vor den Herausforderungen der Moderne profitieren, entlarven sich mitunter selbst. 2007, als das iPhone gerade auf den Markt gekommen war und kaum einem Jugendlichen zur Verfügung stand, erschien von Jean Twenge bereits das Buch "Generation Me", in der sie auch schon davor warnte, wie schlecht es um die nachfolgende Generation steht. In Deutschland beweist der als Medienkritiker bekannte Ulmer Psychiater Manfred Spitzer in Talkshows mitunter am eigenen Beispiel, dass Medienverzicht nicht unbedingt zu besserem Sozialverhalten führt.
Statt sich von Apokalyptikern verführen zu lassen, sollte man Smartphones lieber als das betrachten, was sie sind: eine neue Technologie mit enormem Potenzial. Und sich die Zeit nehmen, Kindern beizubringen, wie sie damit umgehen müssen. Damit sie als Erwachsene Smartphones dafür nutzen können, ein zufriedenes Leben zu führen und mithilfe dieser Technologie den Herausforderungen der Zukunft noch besser gewachsen zu sein.
Der Autor ist Psychiater und Autor. Zuletzt erschien von ihm "Digitale Paranoia - Online bleiben, ohne den Verstand zu verlieren" (C. H. Beck).

