Im Jahr 2009 war es, als im europäischen Spitzenfußball zum ersten Mal ein Begriff die Runde machte, der ihn danach ziemlich beschäftigen sollte. "Financial Fairplay", lautete die neue Zauberformel, die mithelfen sollte, die Auswüchse im Kickerbusiness in den Griff zu bekommen. Ein Jahr später beschloss Europas Fußball-Union die Einführung: "Wir ziehen die Sache knallhart durch", sagte der damalige Uefa-Präsident Michel Platini.
Nun, zwölf Jahre später, sieht das Financial-Fairplay-System (FFP) seinem Ende entgegen. Die an diesem Dienstag beginnende Champions-League-Saison ist wohl die letzte, in der das Reglement gilt - oder das, was noch von ihm übriggeblieben ist. Wegen Corona sind die Vorgaben aktuell ohnehin ausgesetzt oder angepasst worden. Aber bis zum Ende der Saison soll ein neues Konzept entstehen, über dessen genaue Ausgestaltung gerade ein Kampf innerhalb des europäischen Fußballs tobt.

Vor dem Champions-League-Auftakt kreisen die Debatten um das Verhältnis zwischen Trainer Koeman und Präsident Laporta - und um die Revanche für das schauderhafte 2:8. Die Bayern könnten nahezu in Bestbesetzung auflaufen.
Das FFP in seiner jetzigen Form jedenfalls geht als ein gescheitertes Projekt in die Fußball-Geschichte ein. Denn die Exzesse gingen weiter, und die Umsetzung des Reglements, das die Auswüchse begrenzen sollte, beförderte just die Klubs, die sich so wie Paris Saint-Germain oder Manchester City dank fürstlicher Alimentierungen aus Katar und Abu Dhabi besonders irritierende Auswüchse leisten konnten.
Kein Klub darf mehr Geld ausgeben als einnehmen, lautet die Grundregel: so einfach, und so leicht zu umgehen
Dabei klingt die Idee in der Theorie so einfach wie überzeugend. Kein Klub darf mehr Geld ausgeben als einnehmen, das ist die Grundregel. In einem Zeitraum von drei Jahren sind maximal fünf Millionen Euro Minus erlaubt und darf ein externer Investor lediglich eine Lücke von 30 Millionen Euro ausgleichen. Gemäß der allgemeinen Statistik war das Ansinnen sogar erfolgreich: In der Saison vor der Einführung des FFP summierte sich das Minus aller europäischen Erstligisten auf zirka 1,7 Milliarden Euro. Im Jahr vor Corona gab es demnach sogar ein Plus von mehreren Hundert Millionen Euro.
Jedoch bietet das System den Klubs generell viele Möglichkeiten für eine Buchführung in ihrem Sinn. Die gigantischen Ablösen etwa lassen sich über die Vertragslaufzeit des verpflichteten Spielers strecken. Als also PSG 2017 Neymar für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro band und mit einem Kontrakt bis 2022 ausstattete, standen in der Ausgabenstatistik für diesen Transfer "nur" 44,4 Millionen Euro pro Jahr.
Die Verkaufssumme eines Spielers hingegen lässt sich komplett in ein Jahr buchen. Auch vor diesem Hintergrund entstehen manche skurril anmutenden Transfer-Konstellationen, etwa ein Spielertausch zwischen zwei Klubs mit zwei verblüffend hohen Ablösesummen. Zudem lässt sich bei den Investorenklubs auch auf der Einnahmenseite tricksen, indem Firmen aus dem Umfeld des Investors als Sponsoren einspringen und die stattlichen Summen zahlen, die der Investor gemäß den Regeln nicht mehr zahlen dürfte.

In seinem ersten Spiel für United seit zwölf Jahren trifft der Portugiese doppelt - Kritiker des Transfers dürften erst einmal verstummen. Allerdings ist Ronaldo auch nicht mehr der Spieler, der den Klub 2009 verließ.
Dazu torpedierte die Uefa das Ansehen des Systems selbst durch den konkreten Umgang mit Verstößen. Lange sanktionierte die Uefa allein kleinere Vereine, insbesondere unter der Leitung von Platini und seinem Generalsekretär Gianni Infantino, der 2016 zum Fifa-Boss aufrückte. Klubs wie ManCity oder Paris kamen ohne große Sanktion davon - auch dank der Hilfe von Infantino. Erst unter ihrem neuen Präsidenten Aleksander Ceferin nahm die Uefa auch bei größeren Vereinen das Reglement ernster: So schloss sie 2019 den AC Mailand aus dem Europapokal aus und sperrte auch Manchester City für die Champions League, was der Internationale Sportgerichtshof (Cas) in einem ungewöhnlichen Prozess korrigierte.
So konnten ManCity und Paris, aber auch Manchester United in den vergangenen zehn Jahren allein im Transferbereich und abseits der üppigen Gehälter ein Transfer-Defizit von zirka einer Milliarde Euro auftürmen, ohne dass dies Folgen gehabt hätte. In diesem Sommer hatten die Klubs dabei einen noch größeren Spielraum als sonst. Denn wegen der Corona-Folgen handhabt die Uefa die Financial-Fairplay-Regeln weniger streng: So dürfen zum Beispiel die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 zusammengefasst werden.
Entsprechend blätterte Manchester City 115 Millionen Euro für Jack Grealish hin, Paris verpflichtete von Messi über Wijnaldum, Hakimi und Ramos bis zu Donnarumma fast ein halbes Dutzend herausragender Akteure. Ein Klub wie Barcelona hatte neben dem eigenen Missmanagement in der Vergangenheit darunter zu leiden, dass in Spanien strengere Vorgaben für die Höhe der Spielergehälter gelten; diese dürfen nur zirka 70 Prozent der Einnahmen betragen.
Im Gespräch ist eine Art Luxussteuer, viele Details sind aber noch unklar
Aber zugleich hat die Pandemie nun die Debatte über eine grundsätzliche Neuaufstellung des Systems beschleunigt. "Es geht darum, die Ausgaben der Vereine zu begrenzen", sagte Uefa-Boss Ceferin kürzlich dem Spiegel - und dabei insbesondere um die Einführung einer sogenannten Luxussteuer.
Im Prinzip soll das so funktionieren: Die Spielerausgaben sollen auf einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen gedeckelt werden, beispielsweise 70 Prozent. Gegen Verstöße wiederum sollen sich die Klubs mit dieser Luxussteuer freikaufen können. Uefa-Boss Ceferin brachte schon einen Steuersatz von 100 Prozent ins Spiel, als er kürzlich ein Beispiel vorrechnete: Wenn ein Verein 300 Millionen Euro ausgeben dürfte, er diese Summe aber um 200 Millionen Euro überschreiten würde, müsste er weitere 200 Millionen Euro Strafe bezahlen, die dann an andere Vereine umverteilt werden würde.
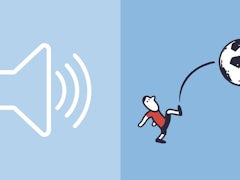
Gegen Barcelona spielt bei den Münchnern auch die Vergangenheit mit. Was unterscheidet die Nagelsmann-Elf aktuell von den Champions-League-Siegern von 2020?
Es sind noch viele Details dieser Reform unklar. Die grundsätzliche Stoßrichtung könnte Klubs wie Paris gefallen, weil ihre Besitzer dann mehr investieren und sie im Zweifel eben die Steuern auf sich nehmen würden; PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi sitzt als Mitglied des Uefa-Vorstandes und Präsident der Klubvereinigung ECA an entscheidender Stelle der Diskussionen. Aus der Bundesliga hingegen kommen viele kritische Stimmen, weil sie befürchten, dass Investorengelder quasi unbegrenzt fließen dürften. Sie wünschen sich generell eine Stärkung der Finanzregeln und plädieren für eine Limitierung dieser Zuwendungen - und dafür, dass es auch weiterhin nicht-monetäre Sanktionen wie einen Ausschluss gibt.
Allerdings ist das ja gerade die große Lehre aus dem gescheiterten Financial-Fairplay-System: Sanktionen wie einen Ausschluss aus dem Wettbewerb braucht es nicht nur auf dem Papier - dafür bedarf es des sportpolitischen Willens, diese Sanktionen im Zweifel auch durchzusetzen.

