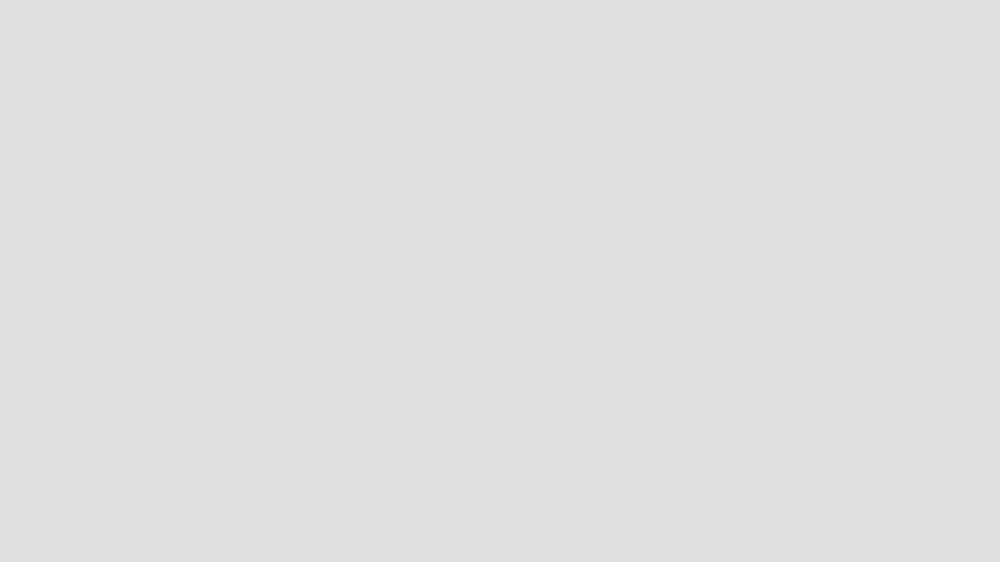Die Tragödie Venezuelas hat einen weiteren Namen bekommen: Hyperinflation. Das eigentlich wohlhabende und mit riesigen Ölreserven gesegnete Land wird nach einer langen Wirtschaftskrise gegen Jahresende vermutlich eine Rate der Geldentwertung von einer Million Prozent erreichen, schrieb jetzt Alejandro Werner, Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die westliche Hemisphäre, in einem Überblick. Das ohnehin niedrige Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird um 18 Prozent schrumpfen, nachdem das Land bereits 2016 und 2017 einen zweistelligen Rückgang der Wirtschaftsleistung erdulden musste. Der Zusammenbruch der Ökonomie, die Knappheit an Lebensmitteln und öffentlichen Gütern wie Gesundheitsleistungen, Strom, Wasser, öffentliche Transportmittel, führt zu Migrationsströmen, durch die auch die Nachbarländer nach und nach in die Krise hineingezogen werden, so der IWF.
Venezuela steht damit vor einer der schlimmsten Hyperinflationen der Weltgeschichte. Sie ist nur vergleichbar mit der großen Inflation in Deutschland 1923 oder der in Simbabwe 2009. Nach der Definition des amerikanischen Ökonomen Phillip Cagan wird aus einer galoppierenden Inflation eine Hyperinflation, wenn die monatliche Rate der Geldentwertung 50 Prozent übersteigt, was auf eine Jahresrate von 13 000 Prozent hinausläuft. In Deutschland kam die Geldentwertung im November 1923 auf gut 30 000 Prozent.

Italien steht ohne Regierung da, die Währung der Türkei taumelt und immer mehr Anleger fliehen vor dem Risiko. Es braut sich ein bedrohliches Szenario zusammen.
Präsident Nicolás Maduro kündigte jetzt ein Programm der "wirtschaftlichen Erholung" an, das am 20. August starten werde. Geplant sei dabei auch eine "Geldumstellung": "Fünf Nullen weniger". Ursprünglich hatte Maduro die Streichung von drei Nullen angekündigt.
Die Schuldigen an der Katastrophe Venezuelas machen es ähnlich wie andere Verantwortliche vor ihr - sie suchen nach Sündenböcken. Maduro, der zusammen mit einer sozialistischen Militärclique das Land regiert, sagt, sein Land befinde sich in einem Wirtschaftskrieg, den die Vereinigten Staaten angezettelt hätten. Demonstranten, die gegen die Politik Maduros auf die Straße gingen, bezeichnete er als "faschistische Banden".
Diesen Wirtschaftskrieg gibt es nicht. Dafür ist es klar, wo die Ursachen der Hyperinflation in Venezuela liegen. "Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen", postulierte der Nobelpreisträger Milton Friedman einst. Will sagen: Inflation entsteht, wenn Notenbanken oder Regierungen zu viel Geld in Umlauf bringen. In Deutschland begann der Weg zur Zerstörung der Mark im August 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die kaiserliche Regierung finanzierte den Krieg zunächst solide durch Ausgabe von Kriegsanleihen und Steuererhöhungen. Ein Teil jedoch wurde durch Gelddrucken aufgebracht, und dieser Teil wurde mit der Zeit immer größer, weil die Regierung Proteste und Kriegsmüdigkeit fürchtete. Nach dem verlorenen Krieg musste die Notenpresse noch schneller arbeiten, bis im November 1923 ein Dollar 4,2 Billionen Mark kostete.
Venezuela leidet an der "Holländischen Krankheit"
In Venezuela war es kein verlorener Krieg, sondern der unermessliche Ölreichtum des Landes, der den Marsch in die Katastrophe auslöste. Alles begann am 6. Dezember 1998, als Maduros Vorgänger, der charismatische Offizier Hugo Chávez, die Präsidentschaftswahlen in Venezuela gewann. Chávez rief die "Bolivarische Revolution" aus, die auch in den Industrieländern unter der Bezeichnung "Sozialismus für das 21. Jahrhundert" begeisterte Zustimmung fand. Der ökonomische Kern dieses Sozialismus bestand darin, die Rohstoffrente aus der Ölförderung, also das, was nach Abzug von Lohn- und Kapitalkosten von den Öleinnahmen übrig bleibt, an das Volk, genauer: an die Anhänger des Präsidenten, zu verteilen.
Was passiert, wenn man das tut, haben schon andere Länder durchgemacht. Zum Beispiel die Niederlande. Dort wurde in den 1960er Jahren Erdgas entdeckt. Die Rohstoffrente, die dabei entstand, nutzten die Niederländer, um ihren Sozialstaat auszubauen. Die Löhne stiegen und mit ihnen die Kosten der heimischen Produktion, wodurch niederländische Industriegüter an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Als die Gaspreise dann einbrachen, stürzte das Land in eine schwere Wirtschaftskrise. Bis heute nennt man diesen Krisenverlauf "Holländische Krankheit". Die Krankheit wurde erst geheilt, als die Tarifparteien 1982 das legendäre "Abkommen von Wassenaar" unterzeichneten, bei dem die Gewerkschaften einem Deal zur Lohnzurückhaltung für neue Arbeitsplätze zustimmten.
Dass auch Venezuela unter der Holländischen Krankheit leiden würde, war internationalen Ökonomen schon lange klar. Im Verhältnis wurde in dem Land immer weniger produziert, die Preise stiegen, die Ölförderung ging zurück. Zunächst wurden die verheerenden Folgen der Bolivarischen Revolution durch hohe Ölpreise und das Charisma von Hugo Chávez verdeckt. Doch als 2012 der Ölpreis weltweit einbrach, wurde die Wirtschaftskrise in Venezuela offenbar. Eigentlich wäre spätestens nun eine Entsprechung zum Abkommen von Wassenaar nötig gewesen, ein Sozialpakt, verbunden mit umfassenden Wirtschaftsreformen. Aber dazu bräuchte es ein Mindestmaß an gesellschaftlichem Vertrauen, doch das gab es nicht, auch weil die bolivarische Revolution viele Institutionen geschwächt hatte. Nach dem Tod von Revolutionsführer Chávez 2013 entfiel auch noch dessen Charisma als einigender Faktor. Seinem Nachfolger Maduro blieb nur die Notenpresse. Das Haushaltsdefizit liegt heute bei 30 Prozent des BIP und wird komplett durch frisch gedrucktes Geld finanziert. Inzwischen ist die Hyperinflation im letzten Stadium angekommen: "Die Geldnachfrage ist zusammengebrochen", schreibt IWF-Experte Werner. Auf deutsch: Niemand will mehr Bolivar-Noten haben, sie sind nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt wurden.
Hyperinflation ist nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe, sie zerstört auch das gesellschaftliche Gefüge. Stefan Zweig, der die Hyperinflation in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg miterlebte, schrieb: "Es gab kein Maß, keinen Wert innerhalb dieses Zerfließens und Verdampfens des Geldes; es gab keine Tugend als die einzige: geschickt, geschmeidig, bedenkenlos zu sein und dem jagenden Ross auf den Rücken zu springen, statt sich von ihm zertrampeln zu lassen."
Reiche Länder zeigen wenig Interesse am Leiden der Venezolaner
Es ist, als hätte Zweig auch über das heutige Venezuela geschrieben. Die Berichte, von dort zeigen jedenfalls dramatisch, wie gesellschaftliche Tugenden verfallen. Venezuela hat heute eine der höchsten Kriminalitätsraten in Lateinamerika, die Hauptstadt Caracas gilt als gefährlichste Stadt der Welt. Das Land erlebt eine Welle von Teenager-Schwangerschaften, weil es keine Verhütungsmittel mehr gibt. Die Venezolaner hungern und fahren auf Hamsterfahrten nach Kolumbien, um sich wenigstens das Nötigste zu besorgen. Trotzdem wurde Präsident Maduro im Mai wiedergewählt, weil dessen Anhänger die Wahl beeinflussten und weil heute die meisten Bürger von Zuwendungen von der Regierung leben.
Die reichen Ländern zeigen heute kaum Interesse am Leiden der Venezolaner. Manche Aktivisten träumen noch vom "Sozialismus für das 21. Jahrhundert", manche üben Solidarität mit den Tätern. In einem Parteitagsbeschluss erklärte sich die deutsche Partei Die Linke im Juni vorigen Jahres "solidarisch mit der bolivarischen Revolution, wie sie von Hugo Chavez eingeleitet wurde, um die demokratischen und sozialen Errungenschaften in Venezuela zu bewahren und zu entwickeln".