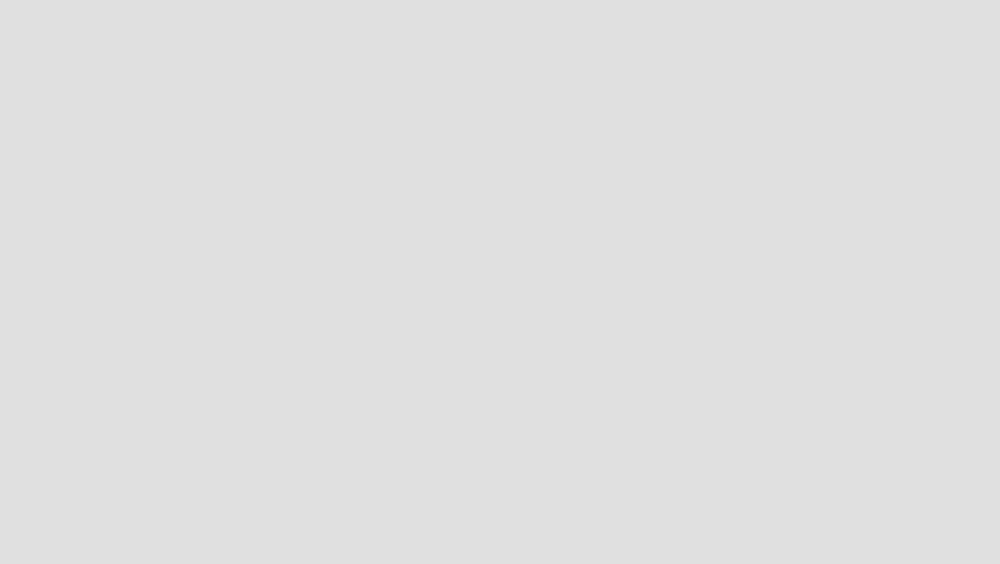"Mama, wie ist das, wenn Astronauten mal müssen?" Das Mädchen mit den blonden Zöpfen erwartet eine Antwort, die Mutter kichert verlegen. "Also, ähm." Zum Glück ist professionelle Hilfe nicht weit. "Sie glauben gar nicht, wie oft wir diese Frage hier hören", sagt ein Nasa-Mitarbeiter, der neben einer ausgemusterten Trägerrakete steht. "Astronauten, Schwerelosigkeit, Toiletten - so was fasziniert eben die Kinder." Und wie ist es nun? Der Mann zeigt auf eine nachgebaute Toilettenkabine mit Vakuum-WC. "Wird alles abgesaugt, aber nur, wenn sie genau zielen. Das gehört zur Grundausbildung aller Raumfahrer."
Nicht alles im Kennedy Space Center ist so witzig wie die Frage nach den Toiletten. Leid und Freude, Jubel und Trauer sind in der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt eng miteinander verwoben. Die Insel vor der Küste Floridas, besser bekannt als Cape Canaveral, dient seit einem halben Jahrhundert als Weltraum-Bahnhof. Wenngleich die Vermarktung heute wesentlich professioneller läuft als früher: Als Neil Armstrong 1969 zum Mond flog, konnte das Publikum die Reise allenfalls vor dem Radio oder im Fernsehen verfolgen. Heute ist das Space Center selbst zur Attraktion geworden, ein lebendes Museum, in dem sich alles um frühere und künftige Weltraummissionen dreht, allen voran die nächste Mars-Mission (2020 soll der nächste "Mars-Rover" starten).
Die wichtigste Zutat für einen authentischen Weltraum-Spaziergang? Eine starke Klimaanlage. Während im All minus 270 Grad Celsius herrschen, kratzt Cape Canaveral im Sommer häufig an der 40-Grad-Marke. Der Weltraum-Bahnhof liegt mitten in einem Sumpfgebiet, schon im Eingangsbereich zeichnen sich Schweißflecken auf den T-Shirts der Besucher ab. Im "Raketengarten" dann der komplette Temperaturschock: Die Sonne knallt auf acht ausgemusterte Antriebsmodule, die höher sind als so manches Bürogebäude. Ein seltsames Gefühl, dass die meisten dieser Raketen ursprünglich als Massenvernichtungswaffen entwickelt wurden, bevor sie in der Raumfahrt zum Einsatz kamen. Krieg und Frieden, Zerstörung und Schöpfung - alles nah beieinander in der galaktischen Forschung.
Ganz anders die Stimmung in den Ausstellungshallen. Der Gang wirkt dunkel und kühl, wie im Weltraum. Hier ruht das Spaceshuttle Atlantis: 26 Jahre lang war es im Einsatz: 33 Missionen, 126 000 geflogene Meilen, zwölf Andock-Vorgänge an der internationalen Raumstation ISS. Nun steht es im Besucherzentrum, ein beleuchteter Stahlpfeil, den jüngere Besucher nur noch aus dem Fernsehen kennen. Anfassen verboten, Fragen stellen erlaubt. "Gab's da auch was zu essen?", fragt ein Knirps mit Nasa-Mütze. Seine Eltern verweisen auf eine gläserne Vitrine, in der eingeschweißte Astronautenkost liegt. "Nudeln mit Käse, Cracker, Erdbeer-Frühstückstrunk", antwortet die Mutter. "Auch nicht schlechter als gestern im Flugzeug, oder?"
Neues entdecken, fremde Welten erobern: Wenn die Nasa ihre Werbefilme zeigt, klingt immer auch ein bisschen "Star Trek" mit durch. Dazu eine kräftige Portion Pathos, ein Appell an den amerikanischen Pioniergeist, der sogar bei den internationalen Besuchern verfängt - laut Space Center kommen fast 50 Prozent aus dem Ausland. Dabei werden auch die Schattenseiten des großen Abenteuers nicht verschwiegen: der tägliche Kampf gegen Muskelschwund, kosmische Strahlung und umherfliegender Weltraumschrott. Während Hobby-Astronomen am Boden jubeln, sitzen die echten Astronauten einsam in ihren Wohnmodulen. Ein Leben im All ist ein Leben voller Entbehrungen.
Ist es das wert? Oder wäre so mancher Astronaut im Nachhinein lieber am Boden geblieben? Die Verantwortlichen im Space Center haben erkannt, dass solche Fragen die Leute interessieren. Und dass sie darauf authentische Antworten erwarten - nicht von einer App auf dem Smartphone, sondern von Menschen, die wirklich dabei waren. So wie Sam Gemar. Der 62-Jährige war insgesamt drei Mal im All. Seit 1997 ist er offiziell pensioniert, tritt aber regelmäßig im Space Center auf. "Mittagessen mit einem Astronauten" heißt die Veranstaltung, die Besucher gegen eine Zusatzgebühr buchen können. In einem festlich gedeckten Speisesaal gibt es Hühnchen, Salat und Reis - und galaktische Anekdoten.
Als Sam Gemar den Raum betritt, sieht er aus wie Bruce Willis in "Armageddon": ein groß gewachsener Mann mit Sonnenbrille, lichtem Haar und Nasa-Einteiler, auf der Schulter ein Aufnäher mit der amerikanischen Flagge. "Was, glaubt ihr, macht ein Astronaut im All?", fragt Gemar, während er mit einem Mikro von Tisch zu Tisch geht. Es dauert nicht lange, da kommt wieder die Toilettenfrage. "Ihr schnallt euch fest wie bei einer Hinrichtung", erklärt Gemar. "Wenn ihr das ein paar Mal probiert habt, klappt es wie am Schnürchen." Die asiatischen Gäste schütteln ungläubig den Kopf. Eine Brasilianerin legt irritiert die Gabel zur Seite.

Dexter, Scarface, Goldfinger und natürlich Miami Vice: Die Stadt am Strand ist Schauplatz bekannter Filme und Serien. Wie sehen die Drehorte wirklich aus? Ein Besuch an zehn Locations.
Es folgen Gespräche über Drohnen, Raketen und die militärische Nutzung des Weltraums. "Eigentlich wollten wir, die Amerikaner, immer nur Frieden", sagt Gemar, was im Publikum gemischte Reaktionen auslöst. Einige klatschen euphorisch, andere schütteln den Kopf. Dann lenkt der Weltraum-Senior das Gespräch in eine andere Richtung. "Die Starts der Spaceshuttles waren spektakulär, aber das ist Geschichte. Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht." Er überlegt kurz, dann schiebt er einen vielsagenden Satz hinterher: "Momentan ist unsere Vision nicht ganz klar."
Tatsächlich befindet sich die Nasa derzeit in einem Zustand, den man entweder als Findungsphase oder als Sinnkrise bezeichnen könnte. Seit 2011 schickt die Raumfahrtbehörde keine eigenen Spaceshuttles mehr ins All, nachdem die altersschwachen Fluggeräte ausgemustert worden waren. Privatinvestoren wie "SpaceX" oder "Virgin Galactic" versuchen, die Lücke zu füllen, indem sie die Infrastruktur von Cape Canaveral nutzen und gegen Gebühren eigene Raketen abschießen. Kritiker fürchten, dass medizinische Forschung und internationale Projekte durch kommerzielle Interessen verdrängt werden könnten. Zumal Donald Trump zwar der Nasa den Auftrag erteilt hat, Amerikaner möglichst bald auf den Mond und den Mars zu schicken. Gleichzeitig aber beendete er die Klimaschutz-Programme der Nasa und lobt die Initiativen der Privatwirtschaft, die weit günstiger arbeite als die eigene Behörde. Noch dazu will Trump den Weltraum mithilfe einer landeseigenen "Space Force" militarisieren.
Um den eigenen Mythos aufrecht zu erhalten, wendet sich das Kennedy Space Center deshalb gezielt an die Jugend. In der Themenwelt "Mars Experience" soll die nächste Generation lernen, wie man auf dem Mars landen, leben und arbeiten könnte. Wer möchte, kann per Computer schon einmal an die ISS andocken, um kurz darauf den "Grand Canyon" des Mars zu erkunden: Ein Plakat zeigt einen Astronauten, der sich wildwestmäßig abseilt. Doch auch bei den Imagefilmen kommt die Kritik an der Weltraum-Erforschung zur Sprache, die regelmäßig die Debatte auf der Erde prägt. "Die Dollars, die wir im All investieren, werden alle auf der Erde ausgegeben", versichert eine Nasa-Mitarbeiterin. Ob Handys, Computer oder Krebsmedikamente: Vieles davon sei ohne die Grundlagenforschung im All undenkbar. Die meisten Besucher scheinen diese Argumente zu überzeugen. "Wahnsinn, welche technischen Fortschritte durch die Raumfahrt entstanden sind", sagt Emily Bailey. Die 28-Jährige verbringt zusammen mit Mann und Sohn ihren Urlaub in Florida. Besonders beeindruckt hat sie das lebensgroße Spaceshuttle Atlantis.
In der Nähe des Raketengartens wird Astronaut Sam Gemar um ein Selfie gebeten. "Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen", sagt Alejandro Cuevas, ein 44-jähriger Chilene. "Meine Frau und ich waren zuletzt vor zehn Jahren hier. Damals war sie schwanger; jetzt ist unser Sohn schon richtig groß." Der Mann strahlt, ein breites Grinsen zeichnet sich unter seinem Dreitagebart ab: "Darf ich Ihnen die Hand schütteln?" Für Gemar sind solche Momente schon fast normal. Er ist ein Space-Cowboy, der die richtigen Posen in- und auswendig kennt: Arme verschränken, USA-Flagge in die Kamera drehen, verschmitzt lächeln. "Wenn du einmal da oben warst, siehst du die Welt mit anderen Augen", erzählt der pensionierte Astronaut. "Du begreifst, auf was für einem wunderschönen aber auch verletzlichen Planeten wir leben."
Ein Tag im Space Center kann lang sein. Busse befördern Besucher bis zur Abschussrampe, von der aus die Raketen starten. Im Kino laufen, in besonderer Schärfe, 4K-Filme mit Aufnahmen aus dem Weltraum, erklärt von Jennifer Lawrence. Im Souvenirshop werden "planetenfreundliche Tragetaschen" aus recyceltem Plastik angeboten. Einen Simulator gibt es obendrein. Wer danach immer noch nicht genug hat, kann im Hotel den Fernseher auf den Nasa-Kanal stellen. Prompt erscheint Alexander Gerst, der deutsche ISS-Astronaut, auf dem Bildschirm. Er redet von Schlafpositionen, Sonnenaufgängen und Kameradschaft im All. Nur eine Kleinigkeit vermisse er dann doch: einen richtig schönen, knackigen Salat.