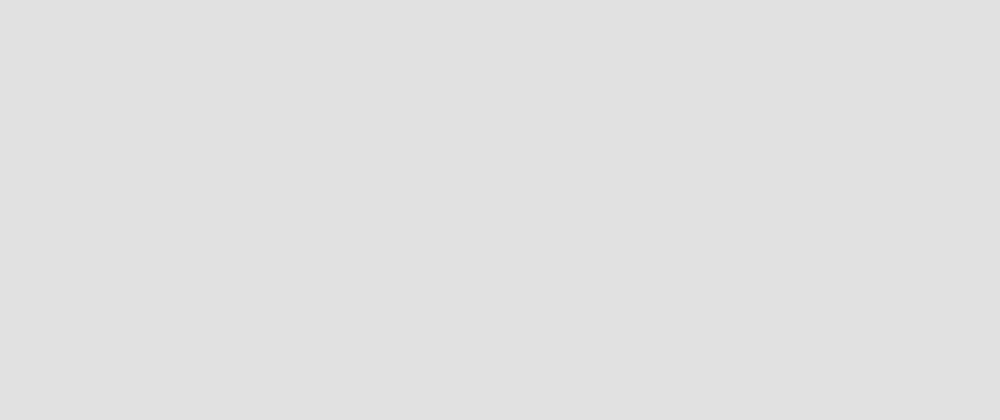Mathias Espinosa blickt aufs azurblaue Wasser im Hafen von Puerto Ayora, der mit 12 000 Einwohnern größten Stadt der Galapagosinseln. Gemächlich schaukeln Ausflugsboote auf den Wellen. Der 55 Jahre alte Deutsch-Ecuadorianer Espinosa, geboren in Kirchheim unter Teck, kam 1987 hierher. Er ging schon mit Bill Clinton tauchen. Als Tauchlehrer zeigt er seinen Kunden die fabelhafte Unterwasserwelt der Galapagosinseln, Hammerhaie, Seelöwen, tropische Fische und Pinguine. Und als Naturführer begleitet er Gäste in den Nationalpark. Die Entwicklung des Tourismus auf den Inseln hat er miterlebt. Als junger Mann hat er auf der Tip Top II bei Rolf Wittmer angeheuert, einem der Pioniere des Tourismus auf Galapagos. Wittmer stammte aus einer Kölner Familie, die 1932 nach Galapagos ausgewandert war. Vater Heinz war Privatsekretär von Konrad Adenauer in dessen Zeit als Oberbürgermeister von Köln. Wittmer junior brachte Espinosa bei, wie man wilde Ziegen jagt, Zackenbarsche fischt und Langusten fängt. "So hatten die Touristen immer frisches Essen", erzählt er.

In Jahrmillionen der totalen Isolation ist auf den Galapagosinseln ein einzigartiges Ökosystem entstanden.
Seither haben sich die Anzahl und die Ansprüche der Besucher deutlich erhöht. Von Massentourismus mag Espinosa nach 31 Jahren als Guide aber nicht reden: "Heute wie damals kann man noch immer Nester von Blaufußtölpeln und anderen Vögeln auf den Besucherwegen im Park bewundern." Massen finde man doch eher auf einer anderen Insel: "Wir haben im Jahr so viele Touristen wie Mallorca an einem Wochenende", sagt er.
Plastikmüll, Fischfang, Taxis: Alles, was der Tourismus mit sich bringt, belastet das Ökosystem
Die nackten Zahlen geben Espinosa recht: 2017 kamen 242 000 Touristen auf die zu Ecuador gehörenden Galapagosinseln, während es auf Mallorca in der gleichen Zeit 10,3 Millionen waren. Auf Mallorca, das nicht einmal halb so groß ist wie die Galapagosinseln, leben 880 000 Einwohner, auf Galapagos 25 000. Von den 14 größeren und mehr als hundert kleinen Inseln sind nur fünf bewohnt. Die Bevölkerung lebt auf drei Prozent der Landfläche, die restlichen 97 Prozent sind Nationalpark - seit nunmehr 60 Jahren: 1959, also hundert Jahre nach dem Erscheinen von Charles Darwins bahnbrechendem Werk "Vom Ursprung der Arten", das auf seinen Beobachtungen auf den Galapagosinseln fußt, gründete der Staat Ecuador seinen ersten Nationalpark, um diesen einmaligen Naturraum, in dem 40 Prozent der Arten endemisch sind, zu bewahren. Die Schutzbestimmungen gelten weltweit als vorbildlich.
Also alles im grünen Bereich? María-José Barragán Paladines sucht sorgsam nach Worten. "Wir erkennen die Notwendigkeit des Tourismus an", sagt sie. Die Frage sei aber, welche Art von Tourismus. Die Meeresbiologin ist seit knapp einem Jahr Direktorin der Charles-Darwin-Station (CDS) - als erste Ecuadorianerin und als erste Frau. "Wir befinden uns mitten in einem hypersensiblen Ökosystem", sagt sie. Einem System, das sich über Jahrmillionen in totaler Isolation herausgebildet hat. Mitten in ist dabei wörtlich zu verstehen: Am Hafen von Puerto Ayora, wo die Schnellboote und Wassertaxis anlegen, dösen Seelöwen auf Parkbänken, im Hafenbecken schwimmen junge Haie, Meeresleguane wärmen sich auf schwarzem Lavagestein auf. Am kleinen Fischmarkt der Stadt wartet stets ein Seelöwe unter dem Tresen auf seinen Anteil. Ein beliebtes Fotomotiv, doch Barragán gefällt nicht, dass aus kommerziellen Gründen der Mindestabstand von zwei Metern zwischen Mensch und Tier missachtet wird.
Die Wissenschaftlerin hat an der TU München studiert, im Bremer Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung ZMT ihre Doktorarbeit verfasst. Sie ging am Beispiel der Galapagosinseln der Frage nach, wie sich Naturschutz und die Anwesenheit des Menschen vereinbaren lassen. Der Plastikmüll, der Fischfang, die Mobilität seien Herausforderungen. "Vor zehn Jahren gab es hier vielleicht zehn Taxis", sagt sie, heute seien es an die 150. Kein Wunder: Die Zahl der Ankünfte ist zwischen 2007 und 2017 um gut 60 Prozent gestiegen. Die Biologin fordert ein Umdenken, auch wenn das nicht einfach sei. Sie hat in Deutschland gelebt, ihr kleiner Sohn versteht nicht, dass auf den Inseln nicht stets alles verfügbar ist, wie er es gewohnt ist. Kein Kino, kein Fast Food, keine Ladenketten.
Beim Fotografieren sind die Behörden mittlerweile rigoros: Selfies mit Tieren sind verboten
Was ein Kind begreifen muss, müssen auch Einheimische und Touristen verstehen. Süßwasserquellen und fruchtbare Böden gibt es kaum. Lebensmittel, Baustoffe, sämtliche Gebrauchsgüter kommen mit Versorgungsschiffen vom Festland. Strom und Trinkwasser werden durch Generatoren und Meerwasserentsalzungsanlagen erzeugt, der Restmüll muss zur Entsorgung aufs Festland geschafft werden. Der Galapagos-Tourismus ist ein schwieriger Balanceakt zwischen den Interessen von Mensch und Natur.

Wie kam es, dass Menschen den Archipel fanden? Und was hat es mit der mysteriösen "Galápagos-Affäre" auf sich? Testen Sie sich auf die Schnelle in sieben Fragen.
Ein Beispiel dafür ist Lonesome George. Besucher können ihn auf der Forschungsstation am Rand von Puerto Ayora hinter Glas betrachten. Die präparierte Riesenschildkröte von der Insel Pinta erlangte weltweit Berühmtheit als vermeintlich letztes männliches Tier seiner Art. Sie starb 2012 im Alter von geschätzten 100 Jahren. Dann fanden die Forscher Diego: jung, gesund, fortpflanzungswillig. Diego sichert nun, in letzter Minute, den Fortbestand der Pinta-Schildkröte.
Im Jahr 2007 drohte das Gleichgewicht zu kippen, die Unesco setzte den Archipel 1000 Kilometer vor der Küste Ecuadors auf die Rote Liste, der Welterbestatus der Galapagosinseln war in Gefahr. Viele Ecuadorianer waren während und nach der Wirtschaftskrise 1999/2000 auf die Inseln gezogen. Hinzu kam der unkontrollierte Zustrom von Urlaubern, auch von Rucksacktouristen, die in der Wildnis und an Stränden campten, Party machten, die Tiere in ihrem Lebensraum störten und Müll zurückließen. Etliche Tierarten waren bereits im Bestand gefährdet.
Die Behörden zogen schnell Konsequenzen: Neubürger wurden zwangsweise aufs Festland zurückgeschickt. Zuziehen darf jetzt nur noch, wer einheiratet oder einen Arbeitsvertrag vorzuweisen hat. Zelten in der Wildnis und am Strand ist verboten. Nach einer komplizierten Formel werden nun die Besucherströme kontingentiert und gelenkt. Mit Erfolg: Schon 2010 nahm die Unesco den Nationalpark Galapagos von der Roten Liste. Heute darf sich kein Besucher mehr ohne Naturführer an einem der circa 80 Besuchspunkte im Nationalpark oder einem der 60 Unterwasserspots aufhalten. Selfies mit Tieren und Selfiestangen sind verboten.
Eine, die alle Bestimmungen im Detail kennt, ist Beate Zwermann. Seit 1992 bereist sie die Inseln, plant und verkauft Individualreisen nach Galapagos. "Der Nationalpark funktioniert wie ein Flughafen", sagt sie: "Es werden Besucherslots vergeben." Zwischen sechs und zehn Uhr und zwischen 14 und 18 Uhr dürfen Kreuzfahrttouristen zu den Besuchspunkten gehen, erklärt sie, Tagestouristen zwischen zehn und 14 Uhr. Die Schiffe sind lizenziert, auf allen zusammen haben maximal 1850 Passagiere Platz, und sie müssen in einem 15-tägigen Fahrplan abwechselnd die Nord- und die Südinseln befahren. Mit Radar überwacht die Nationalparkbehörde alle Schiffspositionen.
Was im Kreuzfahrttourismus funktioniert, müsse an Land erst noch umgesetzt werden, sagt Zwermann. Beliebte Orte wie Puerto Ayora, die dortigen Felsenschluchten Las Grietas und der Strand Tortuga Bay oder die Unterwasser-Lavatunnel Los Túneles auf Isabela seien überlaufen. Das Problem sei, dass Inselurlauber mittlerweile mehr als 70 Prozent ausmachten, der Rest besuche den Nationalpark mit dem Schiff. Neue Hotels dürfen nur gebaut werden, wenn ein altes abgerissen wird. Und kein Hotel darf mehr als vier Stockwerke und 60 Betten haben. "Derzeit gibt es 3200 Gästebetten an Land", sagt Zwermann. Zu wenig für die steigende Nachfrage. Die Galapagosinseln seien ausgebucht, ein Wachstum des Tourismus sei mit der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich. CDS-Direktorin Barragán beobachtet mit Sorge, dass der Druck auf die Nationalparkbehörden steige, weitere Besucherplätze zu öffnen. Dabei gibt es in Puerto Ayora noch nicht einmal eine moderne Kanalisation und Kläranlage: Die Abwässer von Gästen und Bewohnern landen in Sickergruben.

Auf Expeditionskreuzfahrt in Patagonien erleben die Passagiere eine sehr raue Natur - und spüren, warum Seeleute bis heute das Kap Hoorn derart fürchten.
Um den Besucherstrom besser zu steuern und illegaler Einwanderung vorzubeugen, müssen sich Reisende seit Februar 2018 vor dem Abflug nach Galapagos-Baltra auf den Flughäfen Quito und Guayaquil vor dem Einchecken an gesonderten Schaltern registrieren. So werden alle Besucher auf Galapagos erfasst und erhalten eine Einreisekarte. Sie kostet 20 Dollar, zusätzlich müssen sie einen Rückflug und eine Hoteladresse vorweisen. Um Airbnb und illegale Vermietungen auszutrocknen, benötigen Gäste in Privatunterkünften ein Einladungsschreiben. Bei Ankunft auf Baltra ist eine Eintrittsgebühr in den Nationalpark von 100 US-Dollar fällig. Zu wenig, findet Zwermann, verglichen etwa mit Permits für ein Gorilla-Tracking: Uganda verlangt 600, Ruanda seit 2017 gar 1500 US-Dollar. Spätestens vom Ende dieses Jahres an müssen Touristen ihre Ausflüge vorab buchen. Fraglich ist, ob das helfen wird, die Zahl der Wochenendausflügler vom Festland zu senken. Feiern am Strand, etwa an der Playa de los Alemanes in Puerto Ayora, ist nach wie vor sehr populär. Ecuadorianer und US-Amerikaner stellen die größte und am schnellsten wachsende Besuchergruppe.
Zu viele Menschen sind ein Problem, invasive Arten das andere: Ziegen, Hunde, Katzen. Aktuell bedroht wieder einmal eine Rattenplage die Gelege der Bodenbrüter, etwa der Blaufußtölpel, Fregattvögel, Gabelschwanzmöwen. Mit dem Menschen kamen aber nicht nur invasive Tiere, sondern auch Pflanzen. Die Folgen beschäftigen die Biologin Heinke Jäger, die seit 1998 auf der Charles-Darwin-Station arbeitet, schon fast ihr ganzes Berufsleben. Ihr Fachgebiet sind invasive Arten an Land. Eine davon ist der Chinarindenbaum. Er verdrängt die endemischen Scalesien, kleine buschartige Bäume, die mit der Sonnenblume verwandt sind.
Heinke Jäger macht aus der Chinarinde ein wohlschmeckendes Tonic. Doch so viel Gin Tonic können die Galapageños nicht trinken, um diesem Eindringling Herr zu werden. Eine Zeit lang dachte man, es sei das Beste, die Bäume auszureißen. Dann kam die Brombeere. Für sie war jeder ausgerissene Baum ein Einfallstor, um andere Pflanzen zu umschlingen und zu ersticken. "Wir lernten, dass jeder weitere Eingriff in das System alles nur noch schlimmer macht", sagt Heinke Jäger. Ändert sich aber die Flora, dann finden die heimischen Pflanzenfresser das Nahrungsangebot nicht mehr, an das sie sich im Laufe der Evolution angepasst hatten. Wie einst die Artgenossen von Lonesome George.