Mehr als vier Monate nachdem der weiße Polizist Darren Wilson den schwarzen Jugendlichen Michael Brown in Ferguson erschossen hat, nehmen die Proteste gegen Polizeigewalt kein Ende - kurz vor Weihnachten wurde in der Nähe ein weiterer schwarzer Teenager von einem Polizisten getötet. Darren Wilson, der Todesschütze von Michael Brown, wurde ebenso wenig angeklagt wie jener Polizeibeamte, der den Afroamerikaner Eric Garner in New York in einen tödlichen Würgegriff nahm.
In US-Medien wird täglich über Rassismus debattiert, und in vielen Städten finden Demonstrationen statt - auch an Weihnachten. Besonders viele Aktionen gibt es rund um St. Louis - die 21 000-Einwohner-Stadt Ferguson ist ein Vorort der Großstadt. Initiiert werden die Aktionen von einer Vielzahl an Organisationen, die "Lost Voices", "Hands Up United", "This is the Movement" oder "Heal STL" heißen.
Einige der kreativsten Proteste organisiert eine Gruppe namens " Tribe X", die zwei 19-jährige Studenten gegründet haben. Im Interview mit SZ.de erklären Alisha Sonnier und Jonathan Pulphus, was sie antreibt und wieso die neue Bürgerrechtsbewegung keinen Anführer braucht.
SZ.de: Wann habt ihr erfahren, dass Michael Brown in Ferguson erschossen wurde?
Alisha Sonnier: Das war noch am gleichen Tag, also am 9. August. Ich habe bei Facebook und Twitter davon gelesen, dass ein junger Schwarzer im Norden von St. Louis erschossen wurde. Plötzlich haben alle darüber geredet. Die meisten Bilder und Videos habe ich in den sozialen Netzwerken gesehen und nicht etwa im Fernsehen oder auf Nachrichten-Websites.
Jonathan Pulphus: Bei mir war es genauso. Über Twitter habe ich erfahren, dass in Ferguson eine Mahnwache stattfindet. Ich bin hin und habe Alisha am Canfield Drive getroffen; das ist die Straße, in der Brown lebte. Wir kennen uns schon länger und spürten beide, dass wir etwas tun müssen.
Ihr geht nicht nur demonstrieren, sondern habt auch eine Organisation gegründet. Wieso?
Alisha: Tribe X wurde in dem Moment geboren, in dem Michael Brown starb. Wie er sind Jonathan und ich auch aus St. Louis und kennen die Strukturen und Faktoren, die zu solchen Tragödien führen. Wir wollen etwas verändern und mit einer Organisation können wir besser aufklären.
Warum löst der Tod von Michael Brown solche Emotionen bei vielen Schwarzen aus?
Alisha: Als Mike am 9. August starb, war sein erster Tag am College ganz nah. Am 11. August sollte es losgehen. Ich habe an diesem Tag mein Studium begonnen. Ich habe es an die Uni geschafft, und er nicht. Sein Tod rüttelt so viele auf, weil wir uns so ähnlich sind. Wir jungen Schwarzen wissen, dass es egal ist, wie viel Bildung du dir aneignest und welche Leute du kennst. Wenn du auf andere Leute und vor allem auf Polizisten triffst, dann sehen die meist nur eines: Du bist schwarz und damit eine Bedrohung.
Jonathan: Die Reaktion der Polizei, die sehr brutal und mit paramilitärischen Mitteln gegen die Protestierer vorging, hat viele aufgebracht. Dass Browns Leiche viereinhalb Stunden auf der Straße lag und die Polizei seine Mutter daran hinderte, ihren Sohn zu berühren, hat viele entsetzt. Nachdem der Todesschütze Darren Wilson nicht angeklagt wurde, haben wir noch mehr Zulauf bekommen.
Bevor er erschossen wurde, hat Mike Brown einige Zigarillos gestohlen. Habt ihr deswegen länger überlegt, ob ihr euch engagiert?
Alisha: Nur weil jemand eine Straftat begeht, heißt das doch nicht, dass sein Leben nichts wert ist und man ihn mit Kugeln durchlöchern muss. Jeder hat doch ein Recht auf eine Anhörung und einen Prozess. Wir haben deswegen nie darüber nachgedacht, uns nicht mehr zu engagieren. Bei der Bewegung geht es um etwas, das größer ist als Mike Brown und Ferguson. Es geht um ein ungerechtes System, in dem täglich unschuldige Menschen wie Emmett Till, Trayvon Martin, Regina McBride, Aiyana Jones und Eric Garner sterben.
Mit Präsident Obama sitzt seit sechs Jahren ein Schwarzer im Weißen Haus. Hat er nach den Todesfällen von Michael Brown und Eric Garner die richtigen Worte gefunden?
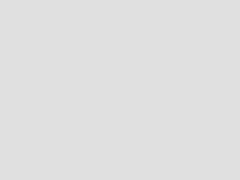
Die USA, ein rassistisches Land? Im ersten Interview nach den Jury-Entscheidungen von Ferguson und New York spricht Obama klare Worte. Der Präsident ermuntert Aktivisten, friedlich zu protestieren. Doch er verbirgt seine Gefühle als Afroamerikaner.
Jonathan: Er könnte noch viel deutlicher werden. In St. Louis sind viele Schwarze enttäuscht, weil sie nicht das Gefühl haben, dass er uns vertritt, sondern nur seine Regierung. Es scheint, als wären wir seiner Regierung egal. Natürlich war die Hoffnung vieler schwarzer Wähler übertrieben, die dachten, dass alles besser würde, nur weil ein Afroamerikaner Präsident ist. Aber wann immer es um Rassismus geht, dann weicht er aus. Es war toll, als er 2012 gesagt hat, dass sein Sohn so aussehen würde wie Trayvon Martin, jener unbewaffnete Teenager, der in Florida erschossen worden war.
Alisha: Das Beispiel Obama zeigt, wie wichtig es ist, dass sich das System ändert. In zehn Jahren kann ich eine eigene Firma haben und Millionen Dollar verdienen, aber es ist eine Tatsache, dass es in Amerika für Schwarze noch immer schwieriger ist als für Weiße. Wer extrem talentiert ist wie Obama, der kann alles erreichen, aber strukturell sind wir benachteiligt. Auch als Präsident muss Obama weiter in diesem System arbeiten. Im Senat und im Repräsentantenhaus sind die meisten Abgeordneten Weiße; auch in der Regierung ist es so. Ich verstehe, dass seine Macht Grenzen hat und er wohl nicht aussprechen kann, was er denkt. Aber schade ist es trotzdem.
Was hält Obama zurück? Früher hat er über seine Erfahrungen mit Rassismus gesprochen.
Jonathan: Er will wohl zeigen, dass er Präsident aller Amerikaner ist. Aber wir Schwarzen waren 2008 und 2012 ein wichtiger Teil seiner Wähler. Es waren unsere Eltern und Großeltern, die bei der Bürgerrechtsbewegung in den fünfziger und sechziger Jahren ihr Leben riskiert haben. Ohne sie wäre er jetzt nicht im Weißen Haus. Wie viele Schwarze habe auch ich das Gefühl, dass er uns nun etwas zurückgeben müsste. Vorsichtige Unterstützung ist keine echte Solidarität.
Seht ihr euch als Teil einer neuen Bürgerrechtsbewegung?
Alisha: Ich habe das Gefühl, dass eine neue civil rights movement entsteht. Wir protestieren seit mehr als 100 Tagen. Wenn Leute müde werden, denen sage ich: Der Busboykott in Montgomery hat mehr als ein Jahr gedauert. Ich glaube, dass wir noch länger protestieren müssen, denn es geht nicht mehr darum, dass Schwarze im Bus mit Weißen sitzen oder ins Restaurant dürfen. Wir wollen das System ändern. Wie kann es sein, dass es nach Mikes Tod keinen Polizeibericht gab und Darren Wilson sich selbst das Blut von den Händen waschen konnte? Wie kann es sein, dass Staatsanwalt Robert McCulloch seinen Job nicht macht und die Grand Jury mit Informationen überhäuft? Das sind strukturelle Probleme, die nicht weggehen, nur weil Wilson den Dienst quittiert hat.
Auf Beobachter wirken die Proteste rund um Ferguson vielfältig und kreativ. Wäre die Wirkung aber nicht größer, wenn es einen Anführer geben würde?
Alisha: Wir Aktivisten sehen, dass wir erfolgreich sind. Wir brauchen keinen Sprecher oder Anführer, sondern wir müssen uns landesweit besser vernetzen. Eine Aktion, die in allen 50 US-Staaten gleichzeitig stattfindet, das wäre toll. In den sechziger Jahren haben wir gesehen, was passiert, wenn es einen herausgehobenen Anführer gibt: Das FBI hat Martin Luther King mit einer Schmutzkampagne überzogen. Und als King erschossen wurde, war die Bürgerrechtsbewegung am Ende. Uns kann das nicht passieren: Es gibt keine Einzelperson, von der alles abhängt. Wenn einer der vielen Aktivisten getötet oder ausfallen würde, ginge es trotzdem weiter.
Jonathan: Anfang Oktober haben wir an unserer Hochschule, der St. Louis University (SLU), eine Demo organisiert, bei der 3000 Leute dabei waren. Anschließend haben wir bei "Occupy SLU" sechs Tage lang auf dem Gelände gecampt. Danach hat uns die Universitätsleitung schriftlich zugesichert, mehr Stipendien für schwarze Studenten aufzulegen und den Bereich African American Studies zu fördern. Später haben wir mit einem "Die-in" den Verkehr in einer Geschäftsstraße in St. Louis blockiert: Wir lagen viereinhalb Minuten auf dem Asphalt, um an die viereinhalb Stunden zu erinnern, die Mike Brown in seinem Blut lag.
Diese Die-ins finden seit Wochen in ganz Amerika statt.
Alisha: Ja, das ist sehr populär, weil es ein starkes Bild ist. Zuletzt haben wir eine große Aktion am Black Friday organisiert, also am Tag nach Thanksgiving, wo alle Amerikaner nur ans Shoppen denken. Wir waren mit 250 Leuten in einem Einkaufszentrum in St. Louis. Unser Ziel war es, den Black Friday lahmzulegen, damit die Geschäfte kein Geld verdienen, wenn uns das Rechtssystem ungerecht behandelt, wenn unsere Leute getötet werden. Wir haben Weihnachtslieder gesungen, sind marschiert und haben Die-ins abgehalten. Nach zwei Stunden wurde die Mall geschlossen. Wir waren die erste Organisation, die es geschafft hat, ein Einkaufszentrum lahmzulegen. Niemand wurde verhaftet, nichts wurde gestohlen, alles war total friedlich.

Nach Thanksgiving denken Amerikaner ans Einkaufen. In St. Louis wird am "Black Friday" gegen Polizeigewalt protestiert. Drei Shopping Malls werden vorübergehend geräumt. In Ferguson selbst beginnt das Aufräumen - und eine schwarze Bäckerin wird mit Geld überschüttet.
Welche Rolle spielt Social Media für euch?
Jonathan: Twitter und Facebook sind sehr wichtig, um uns gegenseitig über Aktionen zu informieren. Manche von uns haben 50 000 Follower bei Twitter, wenn die etwas verbreiten, dann kommen Hunderte Demonstranten. Bei den Protesten machen viele Aktivisten Kurzvideos für Vine und Instagram, so dass wir unsere Botschaft ohne Hilfe von TV-Sendern und Zeitungen verbreiten können. Auch die Journalisten informieren sich über die Proteste, indem sie uns bei Twitter folgen.
Wie soll es weitergehen mit Tribe X?
Alisha: Wir hatten einige erfolgreiche Aktionen, die wir ausführlich geplant hatten. Wir beteiligen uns lieber an wenigen Events, die dafür viel Aufmerksamkeit erzielen. Wir wollen uns aber künftig stärker am Gesetzgebungsprozess beteiligen und den Kontakt zu Abgeordneten suchen, um Veränderungen zu erzielen. Aber wir machen 2015 weiter. Aufgeben ist keine Option, denn die Leben von Afroamerikanern müssen besser geschützt werden.
