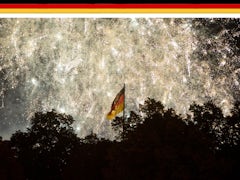"Die Würde des Menschen ist unantastbar." Der Satz ist ein atemberaubendes Versprechen und fast schon eine Anmaßung. Wie oft hört man in den Nachrichten, dass die Menschenwürde nicht nur angetastet, sondern in den Staub getreten wird. Trotzdem formuliert Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz einen verfassungsrechtlichen Superlativ. Die pathetische Sentenz erlaubt keine Relativierung, sie ist keine Zusage, die sich selbst zurücknimmt, sie kennt kein zögerliches "Kommt drauf an" und nicht einmal die Abwägung mit anderen Grundrechten.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das klingt wie das Paradies.
Die Wahrheit ist: Der Schutz der Menschenwürde wurde aus der Hölle geboren.
Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten die Barbarei und den Zivilisationsbruch der Nazizeit noch schrecklich klar vor Augen. Ein Staat hatte sich zum größten Verbrechen der Menschheit verschworen. Da galt es im Parlamentarischen Rat, die Vorzeichen des neuen Staates umzukehren, von minus auf plus. Artikel 1 rückt den Menschen ins Zentrum der staatlichen Existenz. So steht es im zweiten Satz, die Menschenwürde wird darin zum Betriebssystem des Staates: "Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."
Artikel 1 schützt den "Kernbereich privater Lebensgestaltung"
Im Entwurf von Herrenchiemsee hatte man zunächst sogar noch eine Erläuterung vorangestellt, um ja keinen Zweifel aufkommen zu lassen: "Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen." Ein klarer, ein großer Satz, schade, dass er dann doch nicht ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Er könnte Regierungen und Parlamente Demut lehren.
Dass eine Verfassung einen Eid auf den Menschen ablegt, das war ein gewaltiger Fortschritt. Denn historisch ist die Menschenwürde noch jung. Gewiss, der Begriff der Würde ist alt, aber seine Bedeutung war eine andere. Wenn man im Römischen Reich von Würde sprach, von "dignitas", dann war damit die Würde des Amtes oder eines höheren Ranges gemeint. Das war ein Konzept der Ungleichheit und damit das Gegenteil dessen, was das Grundgesetz meint. Menschenwürde genießt nicht nur der Erfolgreiche, nicht nur der Begabte, nicht nur der Reiche - nicht nur der "Würdenträger". Sondern der Mensch, weil er Mensch ist. Nicht einmal in der Französischen Menschenrechtserklärung von 1789 findet sich dieser radikale Gedanke; dignités meint dort ebenfalls die Ämterwürden.
Das Schöne und das Gefährliche daran ist: Jeder kann sich darunter etwas vorstellen, nur ist es bei jedem etwas anderes. Die Varianten reichen bis ins Groteske, das weiß man, seit der Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressekonferenz nach der größtmöglichen Vokabel suchte, um die öffentliche Kritik an den unantastbaren Fußballern des FC Bayern als maximal verwerflich zu brandmarken - es fiel ihm die Menschenwürde ein. Zum Vergnügen des Publikums, das natürlich bemerkt hatte, dass es nicht die Sorge um die Menschenwürde war, die Rummenigge antrieb, sondern Hybris und Arroganz. Aber der bizarre Auftritt illustriert, dass Menschenwürde manchmal eine Frage des Standpunkts ist.
1993 hatte das Bundesverfassungsgericht über die Beschwerde eines entlassenen Straftäters zu entscheiden, der - weil wegen Drogendelikten verurteilt - die Weisung erhielt, während der Bewährungszeit jeden Kontakt mit Drogen zu vermeiden, sonst müsste er zurück ins Gefängnis. Er hielt das für eine Verletzung seiner Menschenwürde. Die Verfassungsrichter dagegen belehrten ihn, die behördliche Weisung solle ihn nicht etwa erniedrigen, sondern vor weiteren Straftaten bewahren.
Menschenwürde meint weder den Ärger dünnhäutiger Sportmanager noch die Ehre des Kiffers, das ist leicht zu begreifen. Aber was ist das - Menschenwürde? Ist sie greifbar, messbar, sichtbar - oder nur Verfassungslyrik? Was kann man sich kaufen für diese Menschenwürde?
Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder erstaunlich konkrete Folgerungen aus Artikel 1 gezogen. Er verbietet Abhörwanzen im Schlafzimmer - der "unantastbare Kernbereich privater Lebensgestaltung" sei von der Menschenwürde geschützt, schrieb das Gericht 2004 im Urteil zum Lauschangriff. Auch im Gefängnis ist sie zu achten: Zwei Häftlinge in eine Zelle von acht Quadratmetern ohne abgetrennte Toilette zu sperren, ist nicht menschenwürdig, hat Karlsruhe mehrmals entschieden.
Und schließlich das menschenwürdige Existenzminimum: Es sichert jedem Hilfsbedürftigen die materiellen Voraussetzungen, "die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-schaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind". So entschieden in Karlsruhe die Verfassungshüter am 9. Februar 2010; die Hartz-IV-Sätze mussten neu berechnet werden. Menschenwürde lässt sich also in Quadratmetern messen. Oder in Euro umrechnen.
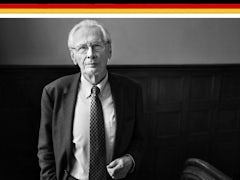
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm erklärt den Verfassungspatriotismus der Deutschen und warnt vor zu vielen Details im Grundgesetz.
Man merkt schon: Sie kommt häufig dann ins Spiel, wenn die Freiräume ganz eng zu werden drohen. Wenn also der hehre Satz, mit dem das Bundesverfassungsgericht das Prinzip Menschenwürde einmal erläuterte, plötzlich wie ein leeres Versprechen klingt: "Dem liegt die Vorstellung vom Menschen als geistig-sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich zu entfalten."
Geistig-sittliches Wesen? Freie Entfaltung? Wer hinter Gefängnismauern lebt oder kein Geld zum Leben hat, für den ist nicht mehr viel übrig vom würdigen Leben. Aber genau in dieser Situation schlägt die Stunde der Menschenwürde. Sie verspricht kein sorgloses Leben, keinen unbeschränkten Raum zur Selbstverwirklichung, keinen Komplettschutz vor staatlicher Belästigung. Nein, sie verspricht nur, dass vom Menschsein auch dann noch etwas bleiben muss, wenn die Freiheit auf die Größe einer Nussschale geschrumpft ist.
Ja zu lebenslang, aber mit einer Chance auf Freiheit
Oder wenn das Leben fast verwirkt ist: 2006 untersagte Karlsruhe den Abschuss entführter Passagiermaschinen, selbst wenn damit eine größere Zahl von Menschen gerettet werden könnte. Dies missachte die Betroffenen als Subjekte der Würde: "Sie werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, verdinglicht und gleichzeitig entrechtlicht." Der Mensch, heißt das, darf nicht zu einer Ziffer in der Saldierung der Toten werden. 200 getötet, 20 000 gerettet.
Manchmal bedeutet Menschenwürde nicht mehr als - Hoffnung. Der Satz mit dem geistig-sittlichen Wesen stammt aus der Lebenslang-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1977, auch dies ein Fall vom äußeren Rand der Gesellschaft. Damals hat das Gericht gesagt: Ja, auch lebenslange Haft ist mit der Menschenwürde vereinbar, obwohl kaum jemand 15, 20 Jahre Haft ohne Schäden an Leib und Seele überstehen kann. Das Gericht setzte jedoch hinter das "Ja" ein großes "Aber": Menschenwürdig sei der Strafvollzug nur dann, wenn dem Häftling zumindest die Chance verbleibe, "je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden". Auch dies ist ein Satz, der konkrete Konsequenzen hat - Therapieangebote, Resozialisierungsbemühungen und vielleicht doch eine vorzeitige Entlassung. Menschenwürde wäre dann auch in Jahren messbar.
Niemals darf dem Menschen der Rückweg zu einem Menschsein verbaut werden, das den Namen verdient - zum Dasein als selbstbestimmtes Wesen in Freiheit. Das gilt auch und gerade dort, wo dieser "soziale Wert- und Achtungsanspruch", von dem das Gericht gern spricht, zur ganz kleinen Münze geworden ist. "Die grundlegenden Voraussetzungen individueller und sozialer Existenz des Menschen müssen erhalten bleiben", schrieb das Gericht.
2004 folgte dann das Sequel der Lebenslang-Entscheidung, es ging um die Sicherungsverwahrung gefährlicher Straftäter. Auch hier gab das Gericht grünes Licht: "Es ist der staatlichen Gemeinschaft nicht verwehrt, sich gegen gefährliche Straftäter durch Freiheitsentzug zu sichern." Auch hier forderte es eine "reelle Chance" auf Wiedergewinnung der Freiheit. Aber weil es um die Schlimmsten der Schlimmen ging - in diesem Fall um einen kaum zu kontrollierenden Gewalttäter - erinnerte das Gericht daran, dass Menschenwürde kein Verfallsdatum und keine Verwirkung kennt. "Selbst durch unwürdiges Verhalten geht sie nicht verloren. Sie kann keinem Menschen genommen werden."
In jene Zeit fällt der Prozess gegen einen Frankfurter Polizeivizepräsidenten, der dem Kindesentführer Magnus Gäfgen Folter angedroht hatte - in der trügerischen Hoffnung, ihn zum Reden zu bringen und den entführten Jungen dadurch retten zu können. Der Fall löste eine beklemmende Diskussion aus. Folter, dieses absolute Tabu für jeden Staat, der sich zur Menschenwürde bekennt - sie schien für Teile der Gesellschaft plötzlich wieder in die Nähe des Denkbaren zu geraten. Am Ende hielt das Tabu zwar. Aber den Satz, sie gehe selbst durch unwürdiges Verhalten nicht verloren, hätten damals gewiss nicht mehr alle unterschrieben.
Es könnte sein, dass dieser Gedanke noch mal wichtig wird, denn die Zeichen stehen auf Ausgrenzung. Das gilt für Sexualverbrecher, zumal, wenn es um Kinder geht, das gilt auch für islamistische "Gefährder". Die Bereitschaft sinkt, ihnen wenigstens das Minimalprogramm des Rechtsstaats zuzugestehen. Das bayerische Polizeigesetz droht mit notfalls unbegrenzter Präventivhaft - damit sie den Terrorakt gar nicht erst begehen können, den man ihnen zutraut. Was sagt das Verfassungsgericht dazu? Niemand darf "zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung" gemacht werden.
Und noch eine Gruppe könnte Schutz unter dem Dach der Menschenwürde suchen. Eine Gruppe übrigens, die sich in keiner Weise unwürdig verhalten hat. Seit einigen Jahren mehren sich die Versuche, Flüchtlinge loszuwerden oder gar nicht erst ins Land zu lassen - möglichst schon an den europäischen Außengrenzen. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht im Asylurteil von 1996 dazu die ernüchternde Feststellung getroffen, das Grundrecht auf Asyl gehöre nicht zur "Ewigkeitsgarantie" der Menschenwürde und könnte daher per Verfassungsänderung sogar abgeschafft werden. Aber ganz so einfach liegen die Dinge wohl nicht. Das Gericht selbst hatte sieben Jahre zuvor formuliert, "allgemein" liege dem Asylgrundrecht durchaus der Gedanke der Menschenwürde zugrunde. Und im Parlamentarischen Rat stand den Autoren des Grundgesetzes die Erfahrung von Flüchtlingen noch sehr drastisch vor Augen, die einst von Land zu Land geirrt waren, nur um aufs Neue an der Grenze abgewiesen zu werden.
Ihnen erschien es deshalb zu riskant, der Grenzpolizei die Zurückweisung zu überlassen - ohne ordentliche Prüfung eines Asylanspruchs. Aus Sicht des Rechtswissenschaftlers Mathias Hong, der eine Habilitationsschrift über Menschenwürde verfasst hat, spricht viel dafür, dass auch das Flüchtlingsrecht einen Kern hat, der von der Menschenwürde geschützt ist. Einen Kern, zu dem das Verbot des "Refoulement" gehört, also der schlichten Zurückweisung an der Grenze ohne Prüfung.
Weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Flüchtlinge durchgereicht werden, bis ins menschenrechtliche Niemandsland. "Dann beginnt das Spiel: Man schickt den Mann zurück oder man schickt ihn an die andere Grenze, und von dort geht es wieder weiter", warnte seinerzeit der SPD-Politiker Carlo Schmid. Hermann von Mangoldt (CDU) pflichtete ihm bei: "Wir haben unsere Erfahrungen aus dem Krieg."