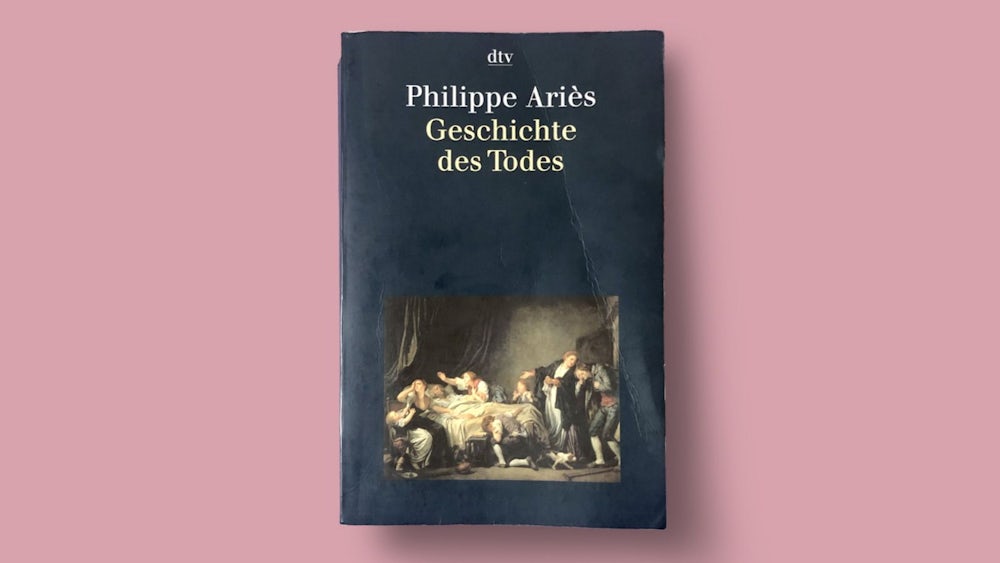Von all den Vorstellungen vom Jenseits, die Menschen sich gemacht haben, ist die der Heiligen Theresa von Lisieux, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der Normandie lebte, besonders verführerisch: Sie hoffte, im Paradies eine genaue Wiederherstellung des Ortes wiederzufinden, in dem sie die ersten elf Jahre ihres Lebens verbracht hatte, mitsamt seinen Einwohnern, Erinnerungen und all den köstlichen Farben ihrer Kindheit. Dies berichtet der französische Historiker Philippe Ariès in seinem grandiosen Buch "Die Geschichte des Todes" - im französischen Original heißt es "L'homme devant la mort" (1978), also etwa "Der Mensch im Angesicht des Todes", was das Machtverhältnis ehrlicher schildert.
Gestorben wurde schon immer, und trotz vieler Bemühungen lässt es sich auch bis heute nicht vermeiden - aber der Umgang damit hat sich im Laufe der Jahrhunderte drastisch verändert. Der Tod ist womöglich das einzige, das die Menschheit nicht hat unterkriegen können - sogar im Gegenteil. Ariès, der 1984 im Alter von 69 Jahren starb und sich selbst übrigens als "Sonntagshistoriker" bezeichnete - im Hauptberuf dokumentierte er den Import tropischer Früchte - argumentiert, dass der Tod früher, seine Recherchen beginnen im Mittelalter, ein gezähmter war.
Unversehrt begrub man nur die Armen
Damals konnte sich die Menschheit gut mit ihm arrangieren, doch im Laufe der Epochen wurde er immer wilder, bis er seinen heutigen Zustand erreichte, den Ariès als entfesselt begreift: Unsere Sterbezimmer füllen sich nicht mehr mit Schaulustigen wie im Frankreich des 17. Jahrhunderts, sondern wir stehen ihm stumm und ohnmächtig gegenüber, und tun, als gäbe es ihn nicht. Doch der ausgelagerte Tod wütet umso schrecklicher.
Die Lektüre ist seltsamerweise tröstlich, auch wenn es viel um Gebeine, Sezierung oder die Angst geht, lebendig begraben zu werden, die Jahrhunderte dafür sorgte, dass Höherstehende nicht unter die Erde kamen, ohne hier und da testweise aufgeschnitten worden zu sein - unversehrt begrub man nur die Armen. Aber vorübergehend versöhnt die Lektüre einen mit der Aussicht, eines Tages womöglich auch selbst zu sterben, wo es doch offenbar ausnahmslos jedem Menschen, der jemals gelebt hat, irgendwann passierte.
Weitere Folgen der Kolumne "Nichts Neues" finden Sie hier .