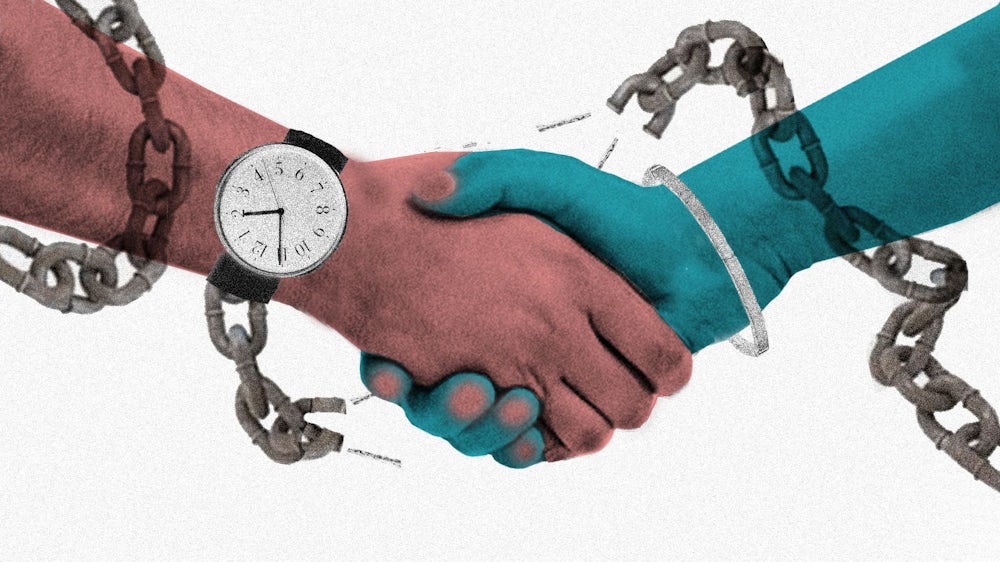Frauen besetzen die wichtigsten Staatsämter, kontrollieren den Zugang zu den Ressourcen und haben die gut bezahlten Jobs an sich gerissen. In Deutschland herrscht Staatsfeminismus. Männer fühlen sich unterdrückt und in ihren Bedürfnissen nicht ernstgenommen. Diese Zukunftsvision entwirft Karen Duve in ihrem satirischen Roman "Macht" und überspitzt dabei ein gängiges Verständnis von Feminismus, das eigentlich ein Missverständnis ist. Denn wer glaubt, Frauen würden am liebsten einfach die Machtverhältnisse umkehren, hat nicht verstanden, dass Gleichberechtigung - also das, worauf Feminismus zielt - nur funktioniert, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten. Es mag absurd klingen, aber der Feminismus braucht die Unterstützung der Männer.
Wenn wir - als Frauen - um uns blicken, sehen wir: Männer. Ein System aus Boys Clubs, das sich selbst erhält und Frauen ausschließt. Das Ausschließen funktioniert subtil: Zum Beispiel, indem man uns suggeriert, dass Frauen angeblich aus evolutionären Gründen weniger Ambitionen auf Karriere hätten. Klingt wissenschaftlich, ist aber zu kurz gedacht. Was Studien stattdessen tatsächlich zeigen, ist, wie erfolgreich das Patriarchat sich selbst am Leben erhält als eine Gesellschaftsordnung, in der "männlich" die Norm und "weiblich" die Abweichung ist.
Einer, der diese Zusammenhänge seit Langem erforscht, ist der Soziologe Michael Meuser. Seine These: Unsere Gesellschaft wird nach wie vor von "homosozialen Gemeinschaften" dominiert. Darunter versteht Meuser Männerrunden wie Studentenverbindungen, Stammtische oder Fußballvereine, in denen Frauen de facto abwesend sind. Meuser kommt zu dem Schluss, dass Männer sich unter Geschlechtsgenossen am wohlsten fühlen, weil dann die "Anforderungen an die Selbstbeherrschung" vermindert seien und man mit den Kumpels am besten "Spaß haben" und "Blödsinn reden" könne. Keine böse Absicht also, sondern Gewohnheit.
Feminismus ermöglicht es, die Rolle des Mannes neu zu verhandeln
Dem Männlichkeitsforscher zufolge liegt das auch daran, dass in Männerrunden unbewusst eine Rangordnung festgelegt wird, die Männern den Umgang miteinander erleichtert. Solche Monokulturen machen es der Gleichberechtigung schwer. Denn nicht nur Fußball- und Skatabende funktionieren Meuser zufolge nach diesem Muster, sondern auch die Arbeitswelt.
Dort, wo Frauen sich Zugang erzwingen - sei es per Gesetz oder durch gesellschaftlichen Wandel - beobachtet Meuser eine "Krise der Männlichkeit". Die Tatsache, dass die "männliche Herrschaft" (Bourdieu) zunehmend bröckelt, verstärke den Wunsch nach Selbstvergewisserung. Der moderne Mann kann nicht mehr den Patriarchen spielen, hat aber noch kein neues Rollenverständnis gefunden. Um aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen, braucht er den Feminismus - verstanden als gemeinsame Anstrengung in Richtung Gleichberechtigung. Denn der Feminismus ermöglicht es, nicht nur die Rolle der Frau, sondern auch die des Mannes neu zu verhandeln.
Die Krise des modernen Mannes ist deshalb eine Chance für unsere Gesellschaft: Meuser beobachtet, dass immer mehr Männer über genügend Selbstbewusstsein verfügen, dass sie den Rückzug in die Boys Clubs zur Selbstvergewisserung ihrer Männlichkeit nicht mehr nötig haben. Auf diese Männer sind wir Frauen angewiesen. Nicht, weil wir starke Beschützer bräuchten oder nicht selbst für uns sprechen könnten. Sondern, weil ohne die Solidarität unserer Partner, Väter und Kollegen Gleichberechtigung keine Chance hat. Das ist kein Rückzug in die Opferrolle, sondern ein Appell an diejenigen, die derzeit faktisch die Gestaltungsmacht besitzen: Männer eben.
Frauen bleiben systematisch ausgeschlossen
Denn ein Blick in die öffentliche Sphäre zeigt, wie es im Moment um die Gestaltungsmöglichkeiten von Frauen steht: Es gibt in Deutschland elf Prozent C4-Professorinnen, neun Prozent Bürgermeisterinnen, acht Prozent Tatort-Regisseurinnen, fünf Prozent Frauen in Dax-Vorständen, zwei Prozent weibliche Chefredakteure in deutschen Medien. Diese Zahlen sammelte die Publizistin Anke Domscheit-Berg in ihrem Buch "Ein bisschen gleich ist nicht genug!". Sie machen sprachlos.
Seit 1949 behauptet das Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Dort steht auch, dass der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken soll. Bis Elisabeth Schwarzhaupt die erste deutsche Bundesministerin wurde, vergingen dennoch zwölf Jahre. Bis zur ersten Bundeskanzlerin sogar 56 Jahre. Aber immerhin: Jetzt gibt es Angela Merkel. Ist sie der Beweis dafür, dass Chancengleichheit erreicht ist? Wohl kaum. Dass wir eine Bundeskanzlerin haben, bildet den Alltag nicht ab. In der freien Wirtschaft haben sich gerade mehrere Großkonzerne die Zielgröße "Null" für ihre Frauenquote im Vorstand gesetzt. Porsche, Commerzbank, Eon, Thyssen-Krupp und Infineon gehören dazu. Dieses selbst gesteckte Ziel gilt bis 2022, die Hausregeln des Boys Clubs ändern sich nicht.
Bis auf Ausnahmen bleiben Frauen systematisch aus den Kreisen ausgeschlossen, die die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten. Schade ist das nicht nur für jene Frauen, die um Karrieremöglichkeiten gebracht werden. Sondern auch für unsere Gesellschaft als Ganzes, weil sie sich damit gut die Hälfte ihres Potenzials entgehen lässt. Hier bräuchten wir Männer, denen es nicht egal ist, dass ihre Töchter es vermutlich nie so weit bringen werden wie sie selbst - einfach nur, weil sie das falsche, das "andere Geschlecht" haben.
Doch nicht nur auf der gesellschaftlichen, auch auf der individuellen Ebene brauchen wir mehr Gleichberechtigung. Ein schwieriges Terrain: Denn es geht um Privates, um Liebe und Familie und um unsere romantischen Vorstellungen davon. Wenn es aber um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht, wird auch das Persönliche politisch. Nicht nur die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt plädiert pragmatisch dafür, dass jede Frau arbeiten gehen sollte. Ein Mann sei keine Altersvorsorge und deshalb könne frau sich nur auf sich selbst verlassen. Schließlich bedroht Altersarmut vor allem Hausfrauen und Frauen im Zuverdiener-Modell.
Dennoch berichtete der Spiegel jüngst über die Renaissance der Hausfrau als Lebensmodell junger Akademikerinnen. Viele von ihnen gehen so den Weg des geringsten Widerstands. Bestens ausgebildete Frauen überlassen ihrem Mann die Rolle des Familienernährers und machen sich selbst zu einer dieser Frauen, über die Männer früher sagten: "Sie hat mir den Rücken freigehalten." Auf diese Weise bringen sich die Frauen um die Macht, unsere Gesellschaft mitzugestalten.

Dicke Frauen sollen keine engen Kleider tragen, Mütter nicht im Café stillen. Der weibliche Körper ist Kampfzone.
Mit deutlich mehr Gegenwind hat zu kämpfen, wer ein gleichberechtigtes Familienmodell lebt. Dennoch lohnt es sich: Nicht nur, weil es vor Altersarmut schützt. Es schenkt Kindern zwei Bezugspersonen und die Möglichkeit, von Vater und Mutter zu lernen. Außerdem hilft es, einen Nachteil auszugleichen, den Frauen nach wie vor bei der Jobsuche haben: Bei einer jungen Bewerberin mache er sich durchaus Gedanken, ob sie bald schwanger wird und sich dann verabschiedet, gibt ein mittelständischer Unternehmer zu. Bei einem Mann habe er diese Sorge eher nicht. Aus Unternehmersicht mag das verständlich sein, gerecht ist es nicht. Auch deshalb sollte es zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass auch Väter in Elternzeit gehen - und zwar länger als die üblichen zwei "Vätermonate". Dann bringen Bewerberin und Bewerber das gleiche Risiko mit.
Ein altes Missverständnis: Der Feminismus habe etwas gegen Männer
Wer übrigens zu phlegmatischem Optimismus neigt und glaubt, dass die Bewegung in Richtung Gleichberechtigung nun angestoßen ist und der Rest sich in den kommenden Jahren von selbst erledigt, der vergisst, dass das Problem nicht einfach damit gelöst ist, dass Frauen plötzlich imitieren, was Männer jahrzehntelang vorgemacht haben. Schließlich ging deren Karriere bisher meistens zu Lasten ihrer Partnerinnen, die Familien- und Hausarbeit übernahmen. Wenn es gerecht zugehen soll, müssen sich Frauen und Männer in der Mitte treffen.
Dass dieser Versuch erfolgreich sein kann, beweisen Paare wie Stefanie Lohaus und Tobias Scholz. Die Herausgeberin des Missy Magazine hat gerade zusammen mit ihrem Partner das Buch "Papa kann auch stillen" veröffentlicht, in dem die beiden von dem Versuch berichten, die Familienarbeit gemeinsam nach dem 50/50-Prinzip zu organisieren. Sie zeigen: Es geht. Aber Männer und Frauen müssen viel miteinander reden. Es sind solche Gespräche, in denen zeitgemäßer Feminismus stattfindet.

SZ-Autorin Karin Janker schreibt in ihrem Essay, das Patriarchat mache beide Geschlechter unfrei: Frauen werden unterdrückt und von Männern wird erwartet, eine Familie jederzeit alleine ernähren zu können.
Ansonsten bleibt der Gleichberechtigungsdiskurs ein Gespräch unter Frauen, weil Männer sich nicht angesprochen fühlen. Es ist eines der ältesten Missverständnisse, dass der Feminismus etwas gegen Männer habe. In Wirklichkeit ist er in der Lage, Männer und Frauen gleichermaßen zu befreien. Von Rollenklischees und dem Gefühl, nur zwischen Hierarchiekämpfen und der Flucht ins Private wählen zu können. Frauen und Männer müssen gemeinsam aushandeln, wie Gleichberechtigung aussehen soll. Bereits das ist subversiv und revolutionär, wenn man bedenkt, dass bisher im öffentlichen Raum immer noch nach Männer-Regeln gespielt wird. Wenn Frauen und Männer miteinander sprechen, durchbrechen sie die Regeln des Boys Club, wo sich alle ohne Worte verstehen.
Väter haben ein Recht darauf, ihre Kinder aufwachsen zu sehen
Dass inzwischen 700 000 Männer die UN-Kampagne "HeforShe" per Klick unterstützen, die Emma Watson als Botschafterin für Frauenrechte eingeläutet hat, ist zumindest ein symbolischer Anfang. Der Feminismus braucht die Solidarität der Männer, weil Frauen sich immer wieder in Männer verlieben und Männer sich in Frauen. Das Paar, sei es homo- oder heterosexuell, ist die kleinste politische Einheit in Sachen Gerechtigkeit.
Natürlich kann nicht jeder Angestellte eine Frauenquote in seinem Unternehmen durchsetzen. Aber er kann seine Frau als gleichberechtigte Partnerin ansehen und sie fördern, indem er ihr die Möglichkeit gibt, sich beruflich zu verwirklichen. Auch wenn das heißt, dass er selbst eine weniger steile Karriere macht. Langfristig ist eine Familie sicherer aufgestellt, wenn sie auf zwei Säulen steht und beide Elternteile berufstätig sind. Und eine Beziehung stabiler, wenn beide Partner glücklich und ausgelastet sind.
Männer und Frauen sollten den gemeinsamen Feind kennen: Das Patriarchat macht beide unfrei. Weil es Frauen unterdrückt und von Männern verlangt, dass sie unrealistische Erwartungen erfüllen und die Belastung, eine Familie zu ernähren, allein tragen müssen. Es ist an der Zeit, dass auch Männer sich emanzipieren. Denn Väter haben ein Recht darauf, ihre Kinder aufwachsen zu sehen. Männer haben ein Recht darauf, dass sie sich die Aufgabe, das Familieneinkommen zu erwirtschaften, mit ihrer Partnerin teilen. Wir alle haben ein Recht darauf, in einer Gesellschaft zu leben, die von weiblicher wie männlicher Kompetenz profitiert.