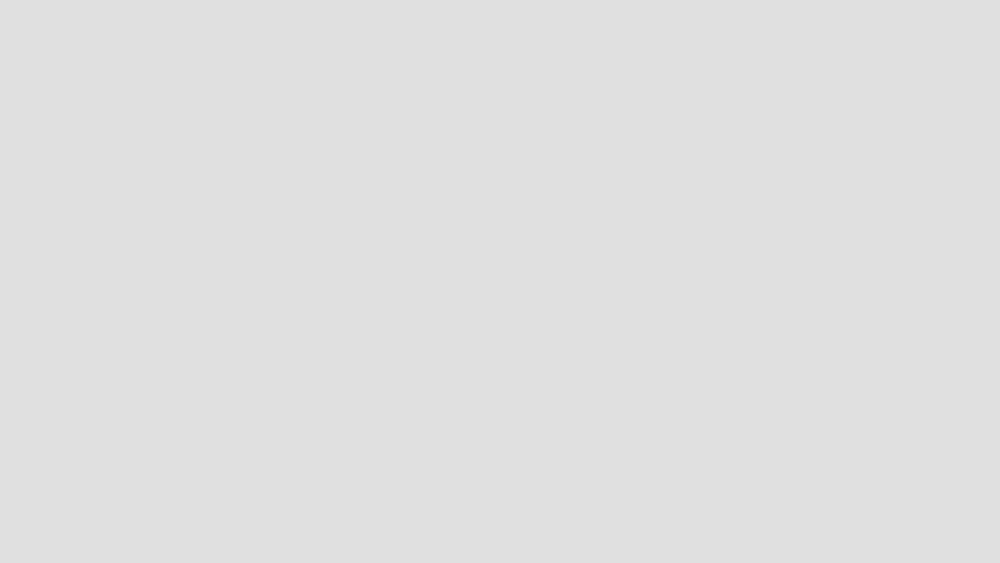Irland hat mit Apple einen Steuerdeal ausgehandelt
Die EU-Kommission hat ihren Zwischenbericht im Steuerverfahren gegen Apple und Irland veröffentlicht ( hier als PDF). Darin greift die Behörde einen Deal an, den Apple mit dem irischen Finanzamt ausgehandelt hat. Dank ihm muss Apple kaum Steuern zahlen. Der Konzern steuert sein Europageschäft über Niederlassungen in Irland. Wer etwa in Deutschland ein iPhone kauft, steigert den Gewinn einer irischen Apple-Tochter.
Apple kann sich seinen Gewinn schönrechnen
Die Kommission zitiert aus Protokollen der Verhandlungen zwischen dem irischen Fiskus und Apple. Darin legen die Parteien fest, dass nur ein kleiner Teil des Umsatzes der irischen Apple-Töchter steuerlich berücksichtigt werden soll.
2012 hat Apple beispielsweise 460 bis 520 Millionen Euro mit zwei irischen Gesellschaften umgesetzt. Die Kommission veröffentlicht nur eine Spanne, um das Geschäftsgeheimnis von Apple zu schützen. Wegen des Deals mit dem Finanzamt muss Apple in der irischen Steuererklärung nur 50 bis 70 Millionen Euro als Gewinn deklarieren. Darauf wird der sowieso schon niedrige irische Steuersatz fällig, sodass Apple nur zwei bis 20 Millionen Euro zahlte.
Brüssel ermittelt
Die Kommission darf einschreiten, wenn hier die Steuersubvention als verbotene Beihilfe eingestuft wird. Dazu läuft nun ein formales Verfahren. Der irische Staat muss der Kommission weitere Unterlagen schicken, Apple darf auf die Vorwürfe antworten. Entscheiden wird erst die neue Kommission unter Präsident Jean-Claude Juncker, dem ehemaligen Premier von Luxemburg.
Gegen Junckers Heimatland und die Niederlande laufen ähnliche Verfahren. Betroffen ist in Luxemburg eine Finanztochter des Autobauers Fiat, in den Niederladen die Kaffeehauskette Starbucks. Die Kommission kann zu Unrecht erteilte Beihilfen zurückfordern. Auf die Konzerne könnte so eine hohe Strafzahlung zukommen.
Kommission verurteilt den Apple-Deal scharf
Im Zwischenbericht der EU-Kommission wird an mehreren Stellen deutlich, dass die Behörde den Steuerdeal als illegal ansieht - auch wenn die finale Entscheidung noch aussteht. Die Vereinbarung sei nicht durch tatsächliche Werke oder durch Ausgaben für einen Maschinenpark gedeckt, heißt es.
Apple und das Finanzamt hatten sich schon 1990 erstmals auf konkrete Zahlen geeinigt, wie viel Umsatz für das irische Finanzamt relevant sei. Für diese Zahlen könne Apple keine sachliche Begründung liefern, heißt es in einem Protokoll der Verhandlungen damals. Der Steuerberater des Konzerns habe dem Vertreter des Finanzamts vielmehr zu verstehen gegeben, dass Apple schon so viel Steuern zahlen werde, dass der Vorschlag des Konzerns als gut gemeint eingestuft würde.
Apple widerspricht
Der Konzern weist die Vorwürfe von sich. "Apple hat nie eine spezielle Behandlung durch irische Beamte erfahren", teilt der Konzern mit. "Wir wissen, dass wir nicht gegen das Gesetz verstoßen", hatte Finanzvorstand Luca Maestri am Montag in einem Interview gesagt.
Dublin verteidigt sein Steuersystem
Auch die irische Regierung wehrt sich gegen die Ermittlungen in Brüssel, die Dublin nun gerne aufkläre. Der Zwischenbericht der EU enthalte "einige Missverständnisse". Die "betroffene Firma", also Apple, habe keine Vorzugsbehandlung genossen und sei "in kompletter Übereinstimmung mit den Gesetzen" besteuert worden, heißt es in der Mitteilung. Die Prüfung von Seiten der EU werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, doch die Regierung sei überzeugt, dass am Ende kein Verstoß gegen Beihilferegeln festgestellt werde. Im Übrigen drehe sich die Untersuchung um eine "technische Frage" bei der steuerlichen Behandlung einer bestimmten Firma - keinesfalls gehe es generell um die Steuerrate für Unternehmen oder das Steuersystem, betonen die Iren.
Frankreich und Deutschland machen Druck auf Irland
Kein Wunder, dass der letzte Punkt der Regierung so wichtig ist: Denn die niedrige irische Steuerrate von Unternehmen für 12,5 Prozent ist aus Sicht Dublins ein wichtiger Köder, um Investoren anzulocken. Der Billigtarif erzürnt allerdings die Regierungen in anderen Ländern, etwa in den USA, Frankreich oder Deutschland. Sie sehen darin ein Steuerschlupfloch - aufgerissen von einem Land, das nach dem Platzen der Immobilienblase nur die Hilfsmilliarden seiner Partner vor der Pleite bewahren konnten. Der irische Premier Enda Kenny musste im März 2011, gerade mal einen Tag nach seiner Wahl, zu einem EU-Gipfel anreisen, wo ihn Kanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy in die Mangel nahmen: Sie wollten, dass Irland seine Unternehmensteuern erhöht. Doch der Ire ließ die Forderungen an sich abperlen.
Boom dank ausländischer Konzerne
Tatsächlich waren es die Milliarden-Investitionen ausländischer Konzerne, die in den Neunzigerjahren aus dem einstigen Armenhaus Europas den sogenannten keltischen Tiger machten. Vor allem Banken, Pharma-, Medizintechnik- und IT-Konzerne wurden angelockt von der Kombination niedriger Steuern und einer gut ausgebildeten, jungen, englischsprachigen Bevölkerung. Doch die Finanzkrise und das Platzen der Immobilienblase trafen Irland hart. Die Regierung musste die maroden Banken stützen und für deren Kredite geradestehen. Die Staatsverschuldung schoss durch die Decke. 2010 suchten die Iren Schutz unter dem Euro-Rettungsschirm, im vergangenen Jahr konnten sie dann wieder darauf verzichten, obwohl die Staatsverschuldung hoch bleibt. Die Wirtschaft wächst rasant - vor allem dank ausländischer Investitionen und hoher Exporte. Der Verdacht, jene Investoren würden mit unlauteren Mitteln angelockt, ist deswegen das Letzte, was die Regierung gebrauchen kann.