Es ist einfach, gegen den Kapitalismus zu wettern. Wenn es ins Detail geht, wird es allerdings rasch nebulös. Die ersten Schwierigkeiten tauchen auf, wenn es darum geht zu definieren, was den Kapitalismus eigentlich genau ausmacht. Definitionen gibt es viele, eine der kürzesten findet sich im Duden. Das bekannteste Nachschlagewerk der deutschen Sprache definiert Kapitalismus als "Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, deren treibende Kraft das Gewinnstreben Einzelner ist". Das lässt viel Raum für Interpretationen - und die gibt es reichlich. Und auch an Kritik mangelt es nicht. Die Sache ist kompliziert.
Noch komplizierter wird es, wenn die Frage auftaucht, ob denn nun das ganze System oder nur einzelne Teile davon zu verdammen seien. Die größte Herausforderung besteht aber unbestritten darin, Vorschläge zu machen, die helfen, den Kapitalismus zu reformieren, oder gar ein System zu entwickeln, das ihm überlegen ist.
Modelle für einen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Wandel
Die Süddeutsche Zeitung hat Ökonomen, Wissenschaftler und Unternehmer befragt, die dazu eigene Ideen entwickelt haben und sich der Diskussion stellen. Ihre Vorschläge sind höchst unterschiedlich, konzentrieren sich meist auf einzelne Aspekte und Bereiche, lassen sich in einigen Fällen auch kombinieren. Weitgehend einig sind sie sich darüber, dass das Monstrum Kapitalismus sehr schwer zu zähmen ist. Zu groß sind die Widerstände und die Trägheit der Masse, die großen Veränderungen eher ablehnend gegenübersteht. Nach dem Motto: besser beim Altbewährten bleiben, anstatt neue unwägbare Risiken einzugehen. Radikal und vollkommen brechen mit dem System Kapitalismus will jedoch, bis auf den französischen Wissenschaftler Serge Latouche, keiner der Befragten, weil überzeugende Alternativen nicht in Sicht seien. Die Zeiten, in denen Monarchen hemmungslos ihr Volk knechten durften oder die sozialistische Planwirtschaft mehr schlecht als recht den Mangel verwaltet hat, wünscht sich keiner zurück.
Die Experten sehen jedoch die Notwendigkeit für tief greifende Reformen einer kapitalistisch geprägten Weltwirtschaft. Sie richten den Blick auf eine Gesellschaft, die am Anfang eines großen Umbruchs steht und sich von alten Denkmustern befreien muss. Klimawandel, das Ende des Erdölzeitalters und die wiederkehrenden Finanzkrisen sind Herausforderungen, die mit dem Dogma aufräumen, dass sich mit Wirtschaftswachstum alle Probleme lösen lassen. Die Welt stößt an ihre Wachstumsgrenzen, Rohstoffvorräte gehen zur Neige. Ressourcen wie Böden und Wasserreserven werden rücksichtlos ausgebeutet. Der Nachschub an Nahrung ist gefährdet, und die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.

Viele Deutsche machen das Wirtschaftssystem für die soziale Ungerechtigkeit verantwortlich. Aber ist der Kapitalismus wirklich die Wurzel allen Übels? Zeit sich Gedanken über ein Modell und seine Alternativen zu machen.
Für all diese Probleme bietet das kapitalistisch geprägte System nach Ansicht seiner Kritiker keine nachhaltigen und überzeugenden Lösungen an. Doch genau die werden dringend benötigt. Die von der SZ befragten Experten haben Modelle für einen sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Wandel entwickelt. Der wird aber nur funktionieren, wenn es Bürger und Staat schaffen, die Allmacht des Kapitals zu brechen und die Solidarität der Völkergemeinschaft zu stärken.

Wo der Kapitalismus seine Wurzeln hat, warum es ihn trotz aller Krisen und Kritik immer noch gibt und was das mit der Erfindung der Uhr zu tun hat - eine kleine Geschichte des Kapitalismus.
Giacomo Corneo, Professor für Öffentliche Finanzen, sagt: "Der Aktiensozialismus ist bewusst ein evolutionärer Versuch." Der Italiener glaubt, das sich die Menschheit an einer Weggabelung befindet und sich entscheiden muss.
Aktien und Sozialismus sind zwei Begriffe, die im Grunde nicht so recht zueinander passen. Giacomo Corneo, Professor für Öffentliche Finanzen, verwebt diese Elemente: Die Marktwirtschaft bleibt erhalten, das Privateigentum wird jedoch eingeschränkt. "Der Aktiensozialismus ist bewusst ein evolutionärer Versuch", sagt Corneo von der Freien Universität in Berlin. Voraussetzung dafür ist eine neue Institution, die nach dem Vorbild der Bundesbank gestaltet sein soll. Corneo hat sie Bundesaktionär getauft. Anstatt um stabile Preise, kümmert sich der Bundesaktionär um Renditen von Großkonzernen. Denn die großen Unternehmen gehören im Aktiensozialismus zu 51 Prozent dem Staat.
Doch im Gegensatz zur Planwirtschaft leitet sie der Staat nicht. Das machen weiterhin Manager - wie auch in anderen Firmen mit Mehrheitsaktionären. Die Öffentlichkeit nimmt über einen anderen Kanal Einfluss: Vertreter des Bundesaktionärs sitzen in den Aufsichtsräten. Gewinne sind im direkten Interesse des Staates, denn er profitiert finanziell: "Die Kapitalrenditen teilen sich dann nicht nur Minderheiten, sondern fließen auch in den öffentlichen Haushalt", sagt Corneo. Eine soziale Dividende, die mehr Geld für den Wohlfahrtsstaat und damit eine gerechtere Verteilung des Wirtschaftswachstums bedeute.
Das Konzept ist Ergebnis seiner Forschung zu Ungleichheit und Umverteilung. Beeinflusst hat ihn der Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph Stiglitz: "Er zeigt, dass auch komplizierte ökonomische Fragestellungen mit den Instrumenten der Mathematik gelöst werden können."

Gute Noten, tolle Projekte, High Potential: Ein junger Banker hat eine steile Karriere vor sich. Bis er mit dem System kollidiert, von dem er profitiert hat.
Der gebürtige Italiener Corneo glaubt, dass wir uns an einer Weggabelung befinden: Wollen wir ein System mit einer kapitalistischen Elite und einer Mehrheit ohne Mitspracherecht? Oder wollen wir eine wirklich offene Gesellschaft mit politischer und ökonomischer Selbstbestimmung? Ihm ist bewusst, dass seine Idee des Aktiensozialismus auf Widerstände stoßen wird. Bei den Eliten, aber "leider auch in den Köpfen derjenigen, die eigentlich am meisten davon profitieren würden". Er meint die Mittelschicht.
Der Attac-Mitbegründer in Österreich, Christian Felber, fordert: "Ethisches Verhalten muss sich lohnen." In einer auf Gemeinwohl ausgerichteten Wirtschaft sei Profit weiter wichtig, er dürfe aber nur Mittel zum Zweck sein.
502 - das ist die Bilanzsumme des Outdoor-Ausrüsters Vaude. Nicht 502 Euro, schließlich hat das Unternehmen aus Baden-Württemberg mehr als 1500 Mitarbeiter, der Umsatz soll im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen. Die 502 stehen für eine Bewertung nach Maßstäben des Gemeinwohls und sind das Ergebnis der sogenannten Gemeinwohlbilanz. Insgesamt können Unternehmen 1000 Punkte zu erreichen. Wer konventionell wirtschaftet, dürfte im Bereich von -100 Punkten liegen. Vaude schneidet besonders gut bei der Gewinnverteilung ab, das Finanzmanagement hat aber noch Luft nach oben. Immerhin gibt es keinen Punktabzug für fehlende Transparenz oder Umweltbelastungen.
Entwickelt hat diese Bilanz die Bewegung der Gemeinwohlökonomie. Ihr Initiator war 2010 der Österreicher Christian Felber. "Ethisches Verhalten muss sich lohnen", sagt Felber. In einer auf das Gemeinwohl ausgerichteten Wirtschaft ist Profit weiter wichtig, schließlich gilt weiterhin die Marktwirtschaft. Doch finanzieller Gewinn soll nicht mehr alleiniger Zweck sein, sondern lediglich ein Mittel. Inzwischen unterstützen 1831 Unternehmen diesen Gedanken offiziell, 250 von ihnen lassen sich von externen Auditoren überprüfen, die Industrie- und Handelskammer in Stuttgart informiert als Erste ihre Mitglieder über die Bilanz.

Viele Kabarettisten verteufeln den Kapitalismus. Vince Ebert nicht. Der Künstler über Wettbewerb und Kooperation, die Zahnärzte der Unterhaltungsbranche - und Primark.
Die Veränderungen sollen aber nicht auf Unternehmen beschränkt bleiben. Der Grundgedanke: "Der Mensch ist nicht grundsätzlich egoistisch und auf Konkurrenz programmiert." Konvente auf regionaler Ebene sollen Wirtschaftsfragen demokratisch klären. Es gelten die Prinzipien der Solidarität, Mitbestimmung, Gerechtigkeit: "Die Begrenzung von ökonomischer Macht mit dem Ende der Freiheit gleichzusetzen, ist eine zutiefst illiberale Weltsicht", sagt Felber.
Der Tänzer, Autor und Mitbegründer von Attac Österreich glaubt nicht an ein plötzliches Ende des Kapitalismus: "Er wird nicht von selbst verschwinden, er muss transformiert werden."
Der Ökonom Serge Latouche glaubt nicht, dass der Kapitalismus reformiert werden kann und soll. Wachstum könne grundsätzlich nicht nachhaltig sein. Es basiere auf immer mehr Konsum, und das sei im Ansatz falsch.
Die Rettung vor dem Kapitalismus muss radikal sein. Der Franzose Serge Latouche glaubt nicht daran, dass der Kapitalismus reformiert werden kann und soll: "Es geht nicht darum, den Kapitalismus zu retten - es gibt keinen verträglichen Kapitalismus", sagt Latouche. Wachstum könne grundsätzlich nicht nachhaltig sein: Es basiere auf immer mehr Konsum - und der sei schon lange nicht mehr dazu da, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern zu einem Selbstzweck verkommen.
Latouche, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris-Süd, gilt als Vordenker der französischen Décroissance-Bewegung. Décroissance lässt sich mit "Wachstumsrücknahme" ins Deutsche übersetzen. Die Verfechter dieses Ansatzes kommen vor allem aus Frankreich, aber auch aus anderen Ländern. Sie wollen das Wirtschaftswachstum nicht nur stoppen, sondern sogar ins Gegenteil verkehren: Die Wirtschaft soll schrumpfen. Dazu sollen die Menschen auf Konsum verzichten und sich freiwillig auf das Notwendige beschränken.
Décroissance sieht sich als radikale Bewegung und setzt auf zivilen Ungehorsam: Sie bauen Müllberge aus Werbung, die in Briefkästen landen, schalten Lichter bei Leuchtreklamen aus oder wandern einen Monat lang durch Frankreich. Doch die Aktivisten machen auch konventionelle politische Arbeit: Mit der Décroissance-Partei treten sie in Frankreich bei landesweiten Wahlen an, die Ergebnisse liegen im Promille-Bereich.
Wie soll ein Wachstumsrückgang konkret aussehen? Das will Latouche nicht sagen: "Décroissance ist lediglich der Leitbegriff einer radikalen Kritik, um eingefahrene ökonomistische Terminologie bloßzulegen", meint der 75-jährige Wirtschaftswissenschaftler. Der erste und unbedingt notwendige Schritt dazu: kapitalistisches Denken aus den Köpfen zu bekommen. Latouche glaubt, dass das keine vergebliche Hoffnung ist: "Ein Kulturwandel ist ein langsamer Prozess, aber manchmal gibt es Brüche. Ich habe 1968 erlebt. Es war beeindruckend, wie schnell da viele Menschen ihr Denken änderten."
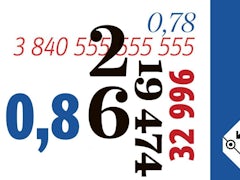
Der Kapitalismus ist ein hochemotionales Thema. Manchmal helfen da nur: nüchterne Zahlen. Hier sind 13, die Sie sich merken sollten. Oder wissen Sie, wann Geld wirklich glücklich macht?
Der Ökonom Niko Paech plädiert für ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum. Er weiß, dass das weniger Industrie bedeutet. Um dies sozial abzufedern, sollen Jobs umverteilt und die Arbeitszeit für jeden reduziert werden.
Das Gesicht der deutschen Postwachstumsökonomie ist ein 44-jähriger jungenhafter Professor für Ökonomie an der Universität Oldenburg. Sein Name ist Niko Paech. Paech will kein Kapitalismuskritiker sein: "Das lenkt von einem anderen K-Wort ab: Konsumgesellschaft." Sie verbraucht nicht nur immer mehr Ressourcen - sie hat nicht einmal unbedingt etwas davon. Als Konsumverstopfung bezeichnet Paech das Phänomen, wenn Menschen mehr Dinge kaufen, als sie Zeit haben zu nutzen.
Paech will den Konsum von zwei Seiten her bekämpfen: Suffizienz und Subsistenz. Hinter diesen Begriffen verbergen sich Nachfrage und Angebot - weniger verbrauchen und weniger herstellen. Das betrifft nicht nur Unternehmen, sondern auch jede einzelne Person. Die einzig sinnvolle Ziel ist für ihn die individuelle Ökobilanz: "Was kann sich ein Individuum an materiellen Freiheiten - Mobilität, Konsum und digitale Bequemlichkeit -nehmen, ohne ökologisch und sozial über seine Verhältnisse zu leben?" Auch vermeintliche Mitstreiter wie die Verfechter eines nachhaltigen Wachstums würden sich mit dieser Kernfrage kaum auseinandersetzen: "Die Vorstellung von grünem Wachstum ist ein Widerspruch in sich."

Der Mensch denkt rational, Märkte sind vollkommen: Studenten sind die einseitige Lehre der Volkswirtschaft leid - zeigen die Proteste Wirkung?
Paech plädiert für eine Postwachstumsökonomie, ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum. Mit anderen Worten: eine Abkehr von der Industrie. Das zerstöre sicherlich Arbeitsplätze, Gewerkschaften als Gegner sind ihm damit sicher. "Nur durch eine reduzierte und umverteilte Arbeitszeit kann das sozial abgefedert werden", sagt der Ökonom Paech.
Weniger Jobs, aber für möglichst viele Leute. Unverzichtbar sei dafür eine geringere Arbeitszeit, Paech schlägt 20 Stunden pro Woche vor. Die freie Zeit bedeute weniger Stress für den Einzelnen und Freiräume für Selbstversorgung. Doch das reiche nicht aus. Um nicht noch mehr Landschaften zu zerstören und Boden zu versiegeln, soll es sogenannte "Boden- und Landschaftsmoratorien" geben: keine Neubauten, der Rückbau von Agrarfabriken, Flughäfen und Autobahnen.
Barbara Unmüßig, Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung: "Wir brauchen eine ökonomische, kulturelle und ökologische Transformation." Viel Zeit bleibe nicht mehr. "Wir müssen dringend und radikaler umsteuern."
So kann es auf keinen Fall weitergehen, meint Barbara Unmüßig, Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung. Kapitalismuskritik sei bitter notwendig. Sie setzt sich für eine neue Ökonomie der Natur ein, die radikale Einschnitte beim verschwenderischen Umgang mit den begrenzten Ressourcen verlangt. So seien die Ölvorräte fast aufgebraucht, die Nahrungsmittelproduktion stoße an ihre Grenzen, und der dramatische Klimawandel lasse sich kaum noch aufhalten. "Natur, Land, Arbeit, Wissen und Vermögen werden in einem nie gekannten globalen Ausmaß zu privaten Zwecken angeeignet. Das Allgemeinwohl, die Menschenwürde, natürliche Lebensgrundlagen und demokratische Prinzipien bleiben dabei zu häufig auf der Strecke", kritisiert sie. Die Lösung sieht Unmüßig in einer Ökonomie des "Genug", in der Wachstum kein Selbstzweck mehr sein darf. Hier sieht sie den Staat gefordert, weil sich Mensch und Wirtschaft harte Grenzen nicht freiwillig setzen werden.

Die meisten Deutschen wünschen sich Reformen für den Kapitalismus, für eine soziale, gerechte und nachhaltige Marktwirtschaft. Was jetzt anders werden muss.
Was Verfechter der freien Marktwirtschaft als Ökodiktatur verdammen, ist für Unmüßig eine unverzichtbare Notwendigkeit, es gehe schließlich um das Wohl künftiger Generationen. "Wenn jeder Mensch auf der Welt so viel Fleisch essen würde wie ein Bundesbürger, dann müssten auf 80 Prozent der verfügbaren Ackerflächen nur Futtermittel angebaut werden." Sie definiert die Kernaufgabe so: "Wir brauchen eine ökonomische, kulturelle und ökologische Transformation." Drei Dinge seien dafür notwendig. Erstens ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, "dass wir dringend und radikaler umsteuern müssen". Zweitens müsse die weitere Expansion des Kapitalismus mit all seinen sozialen und ökologischen Verheerungen gestoppt werden. Drittens seien neue soziale, technologische und ökonomische Experimente notwendig. Wie sich das konkret umsetzen lässt, bleibt bei Unmüßig vage. Die Risiken dieser Reformen sieht sie wohl: "Dem Wachstum abzuschwören, bedeutet, einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruch zu riskieren", sagt sie.
Der Unternehmer Götz Werner: "Es ist ein Denkirrtum zu meinen, Arbeit sei das, was gut bezahlt wird. Erst wenn der Mensch ein Einkommen hat, kann er für andere tätig werden. Einkommen ermöglicht die Arbeit."
Götz Werner ist nicht nur ein Unternehmer der alten Schule - sondern Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das macht ihn zu einem Exoten in der Firmenwelt. Über Jahrzehnte hat der 71-Jährige die erfolgreiche Drogeriemarktkette dm aufgebaut. Im Gegensatz zu vielen Managern der Neuzeit, hat er seine soziale Verantwortung nicht aus den Augen verloren. Während Aldi, Lidl und Co. auf strikte Kontrolle von oben nach unten setzten, schlug Werner einen anderen Weg ein. Seinen Mitarbeitern hat er immer mehr Selbstverantwortung und Eigenkontrolle zugestanden und gute Erfahrungen damit gemacht.
Das allein reicht jedoch nicht aus, findet er: "Das Grundeinkommen hat sich für mich als eine Notwendigkeit ergeben aus meinen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen in der Übertragung auf die Volkswirtschaft." Dahinter steht das Konzept, dass der Staat jedem Bürger eine einheitliche finanzielle Basiszuwendung zukommen lässt, und zwar völlig unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage. Werners Forderung als Schnapsidee eines Sozialromantikers abzutun, fällt schwer. Dafür hat der Mann zu viel Praxis. Er glaubt nicht, dass die Menschen sich dann auf die faule Haut legen, im Gegenteil: "Es ist ein Denkirrtum zu meinen, Arbeit sei das, was gut bezahlt wird. Erst wenn der Mensch ein Einkommen hat, kann er für andere tätig werden. Einkommen ermöglicht die Arbeit", meint der Firmengründer. "Mit alldem können wir sofort anfangen, wir müssen es nur ernsthaft wollen." In Finnland will man das tun, zumindest im Rahmen eines Experiments, wie die Regierung angekündigt hat.

Viele Deutsche machen das Wirtschaftssystem für die soziale Ungerechtigkeit verantwortlich. Aber ist der Kapitalismus wirklich die Wurzel allen Übels? Zeit sich Gedanken über ein Modell und seine Alternativen zu machen.
Den Stab über den Kapitalismus brechen will Werner nicht. Schließlich hat ihn das System reich gemacht. Die Kapitalismuskritik sei eine Interpretationsfrage: "Die Verwerfungen, die wir zum Beispiel in der Finanzwirtschaft erleben, entspringen nicht dem Kapitalismus, sondern unserem Weltbild." Erst wenn Geld zum Zweck werde, entstehe menschliches Leid. Die größten Schwierigkeiten für eine Grundeinkommen sieht er in festgefahrenen Denkstrukturen und "Blendgranaten", von denen wir uns ablenken lassen.
Der Harvard-Professor Yochai Benkler ist überzeugt davon, dass sich mit dem kollektiven Lernen und Teilen von Wissen nicht nur die Wirtschaftswelt, sondern auch die Gesellschaft an sich zum Besseren verändern lässt.
Harvard-Professor Yochai Benkler ist ein radikaler Verfechter der Informationsfreiheit. Er ist überzeugt davon, dass sich mit dem kollektiven Lernen und Teilen von Wissen nicht nur die Wirtschaftswelt, sondern auch die Gesellschaft an sich zum Besseren verändern lässt. Dieser Ansatz wird in der Wissenschaft als Open-Source-Theorie bezeichnet - ein Begriff, abgeleitet aus der Softwareentwicklung, mit dem Programme beschrieben werden, deren Quelltexte frei verfügbar sind, sodass jeder daran mitarbeiten kann. Mit Kritik an den Auswüchsen des Kapitalismus hält der bekannte Juraprofessor nicht hinter dem Berg. Damit meint er vor allem " den arroganten Kapitalismus", wie er von den Vereinigten Staaten und Großbritannien seit den Siebzigerjahren geprägt worden sei. Benkler hat dafür auch einen Begriff gefunden: den "Milton-Friedman-Reagan-Thatcher-Washington-Konsenskapitalismus".
Er kritisiert vor allem die Deregulierung der Finanzmärkte, niedrige Steuern für Großverdiener, schwache Gewerkschaften und den Freihandel. Für ihn alles Faktoren, die die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werden lassen. Eine Fehlentwicklung, die gestoppt werden müsse, fordert er. Dafür sei es notwendig, die Märkte nach sozialen Kriterien auszurichten. Die Gesellschaft müsse sich auf die Stärken der Gemeinschaft besinnen. Darunter versteht er Kooperation statt Konkurrenzdenken. In den Unternehmen sei ein Umdenken notwendig. Deren Aufgabe sieht Benkler darin, die soziale und uneigennützige Zusammenarbeit der Menschen zu fördern. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte dabei helfen, meint Benkler, der damit auf einer Linie mit dem Drogeriemarkt-Unternehmer Götz Werner liegt.
In der Finanz- und Wirtschaftswelt stoßen Benklers Ideen auf breite Ablehnung. Was nicht überrascht, der Angriff auf Patent- und Urheberrechte würde sie um riesige Einnahmen bringen. Benkler ist sich dessen bewusst. "Diejenigen, die sich dank dieser Rechte die Taschen vollstopfen, werden den stärksten Widerstand leisten", meint er. Das allergrößte Hindernis für Reformen sieht er jedoch in der Trägheit.
