Wer schreibt, der bleibt. Wer Memoiren verfasst, will zumindest mitbestimmen, wie er im Gedächtnis bleibt. Das verhält sich auch bei Barack Obamas Resümee seiner ersten drei Jahre im Weißen Haus nicht anders.
Und wie wohl fast alle Politiker-Erinnerungen ist auch Obamas Opus (allein der nun veröffentlichte erste Band umfasst etwa 1000 Seiten) in erster Linie nicht nur eine persönliche Schilderung der Ereignisse, sondern zugleich eine Rechtfertigung der eigenen Handlungen, Entscheidungen und Unterlassungen, was wiederum deren - natürlich positiver - geschichtlicher Einordnung dienen soll. Siehe oben.
Obama probiert eine Art intellektuellen Spagat. Zum einen räumt er durchaus selbstkritisch ein, dass er mit seinem zentralen Wahlversprechen von "Change", vom Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft, letztlich nicht durchgedrungen ist. Amerikas Gesellschaft oder auch nur die politischen Entscheidungsprozesse in Washington haben sich nicht fundamental zum Guten verändert während seiner Präsidentschaft.

Donald Trump behauptet weiterhin, die Wahl habe in Wahrheit er gewonnen. Dass der scheidende Präsident die Realität leugnet, heißt nicht, dass er sie nicht kennt.
Ganz und gar nicht, schließlich, und das notiert Obama zu Beginn seiner Erinnerungen, ist "jemand zu meinem Nachfolger bestimmt worden, der in allem das exakte Gegenteil von dem verkörperte, wofür wir standen". Donald Trump und die Krise der amerikanischen Demokratie, die er heraufbeschworen hat, liegen wie ein Schatten auf Obamas Präsidentschaft.
Ohne Pathos geht es nicht
Zum anderen versucht er aber darzulegen, dass er trotzdem keineswegs gescheitert ist. Er verstehe alle, schreibt er, "die glauben, es sei an der Zeit, den Mythos zu entsorgen" - den Mythos, dass Amerika das Land ist, dessen Staatsräson das Versprechen von Gleichheit, Gerechtigkeit und demokratischer Teilhabe sei.
Nicht ohne Pathos, zu dem der nüchtern denkende Mann immer mal wieder neigt, schreibt er: "Mit Gewissheit kann ich jedoch sagen, dass ich noch nicht bereit bin, die Möglichkeit von Amerika aufzugeben - nicht nur um künftiger Generationen von Amerikanern willen, sondern um der gesamten Menschheit willen."
Doch in erster Linie berichtet Obama von den Ereignissen selbst. Kurz von seiner multikulturellen Jugend: Kind eines Kenianers und einer Weißen aus Kansas, aufgewachsen in Indonesien und auf Hawaii. Sein Studium in New York und Harvard, seine Heirat mit Michelle, seine Tätigkeit als Community Organizer in Chicago, schließlich ein kometengleicher Aufstieg vom Parlamentarier in der amerikanischen Provinz über den Senat in Washington bis ins Weiße Haus, und das alles innerhalb eines guten Jahrzehnts.
Dann folgen die großen Kämpfe seiner ersten Amtszeit. Der Versuch, den Zusammenbruch der amerikanischen Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008 abzuwenden. Das Ringen um ein milliardenschweres Konjunkturprogramm (das sich im Vergleich zu den Anti-Corona-Maßnahmen fast bescheiden ausnimmt) und der unerbittliche Widerstand der Republikaner dagegen. Der Stresstest für die Banken, den seine Regierung entwickelt, das Rettungspaket für die Autobranche, die vor dem Zusammenbruch steht.
Das vergebliche Mühen um ein Klimagesetz, das auch am Widerstand aus den eigenen Reihen scheitert. Er verlegt sich auf Verordnungen (die dann sein Nachfolger konterkariert hat). Der Kampf um die Gesundheitsreform, die nach schier unendlichen Zugeständnissen den Kongress passiert. Der Versuch, das Gefangenenlager in Guantanamo aufzulösen, der am Ende ebenfalls von den eigenen Leuten vereitelt wird.
Die Analyse der Gesundheitsreform geht zurück bis 1909
Großen Raum nimmt die Außenpolitik ein, seine Reisen in den Nahen Osten, nach Russland, nach Afrika, nach Asien. Implizit antwortet Obama dabei stets auf die Vorwürfe, die ihm - nicht nur von republikanischer Seite - gemacht wurden. Etwa, dass sich die USA unter seiner Ägide vom Führungsanspruch in der Welt verabschiedet hätten, dass er zögerlich und nicht entschlossen gehandelt habe, dass seine von hehren Ansprüchen geleitete Außenpolitik denselben nicht gerecht geworden sei.
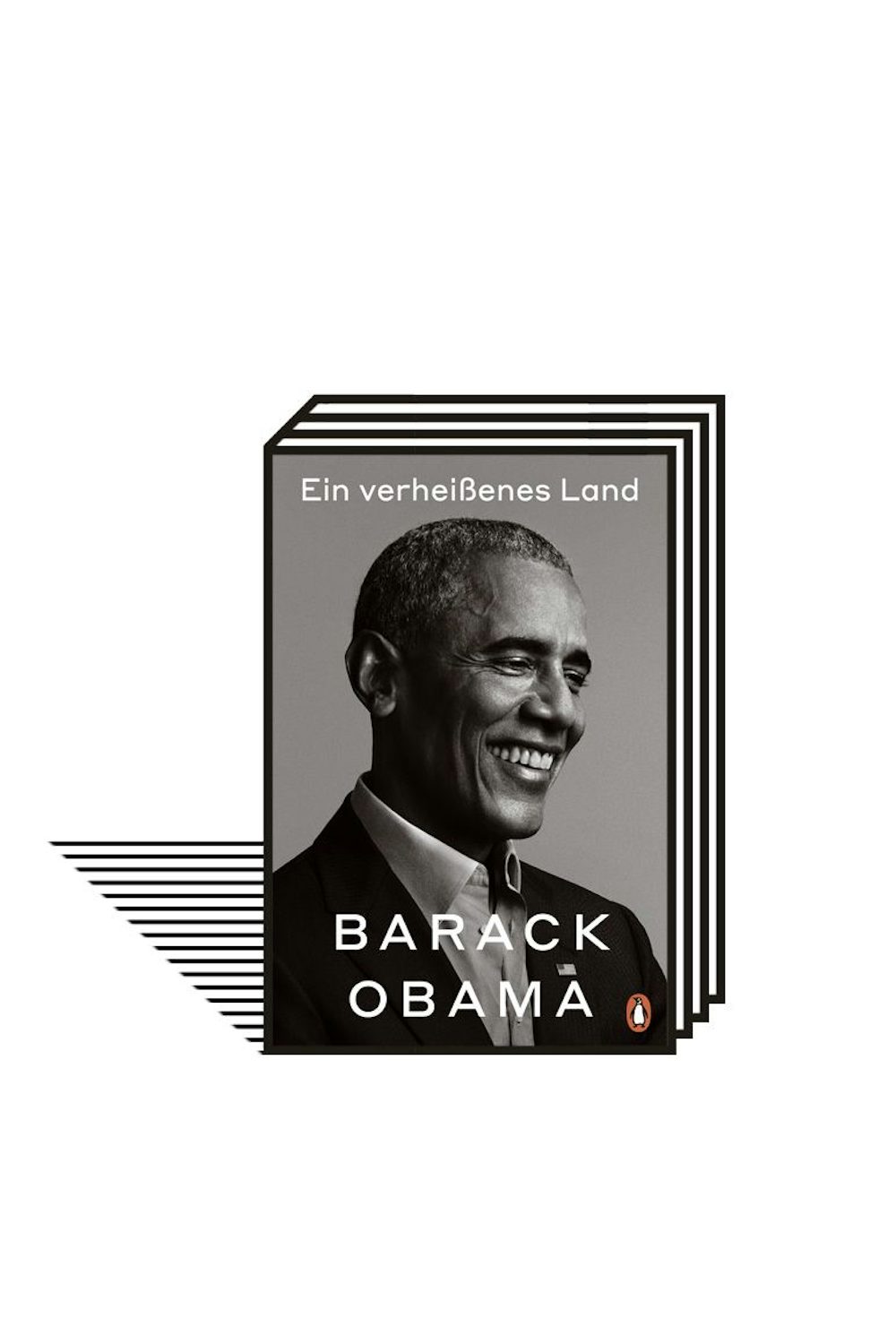
Minutiös schildert er beispielsweise, warum seine Entscheidung über das US-Engagement in Afghanistan sich monatelang hinzieht (wobei sein damaliger Vize Joe Biden ihm rät, sich nicht von den Generälen "blockieren" zu lassen). Er erläutert, warum es im Interesse der Vereinigten Staaten lag und liegt, "sich stärker als irgendeine Supermacht in der Geschichte an eine Reihe internationaler Gesetze, Vorschriften und Normen zu binden".
Was damit kritisiert wird, liegt auf der Hand: die sprunghafte, rücksichtslose America-First-Politik des gegenwärtigen Amtsinhabers. Überhaupt liest sich der Abriss seiner methodisch reflektierten politischen Entscheidungen wie die Antithese zur erratischen Ad-hoc-Herangehensweise seines Nachfolgers.
Gleich zu Beginn seiner Aufzeichnungen schreibt Obama, dass er eine "ehrliche Darstellung" seiner Zeit im Amt liefern wolle. Was, kaum verwunderlich bei einem Universitätsdozenten, zu teilweise eher akademischen Darstellungen der jeweiligen Thematik führt.
Wenn er über seine Auslandsreisen schreibt, liefert er gern ein kurzes Co-Referat zur historischen Situation des besuchten Landes. Und die Ausführungen zur Gesundheitsreform eröffnet er mit einer Zusammenfassung der Bemühungen um ein besseres US-Gesundheitssystem seit Präsident Theodore Roosevelt (der 1909 aus dem Amt schied).
In einer Hinsicht aber wird Obama persönlich. Er will, wie er schreibt, "einen Eindruck davon vermitteln, wie es sich anfühlt, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein". Das umfasst eben die Entscheidungen im Amt - und sein privates Leben. In das gewährt er, wohl dosiert, Einblick. Vor allem, was das Leben im Weißen Haus für ihn, seine Frau und Familie bedeutete.
"Das war's dann aber, Barack", forderte Michelle
Sein Pressesprecher Robert Gibbs etwa treibt ihm gleich zu Beginn der Amtszeit die Flausen aus dem Kopf, dass er sich unbemerkt vom Medientross private Ausflüge leisten könnte. Er "klopfte mir nur auf den Rücken", schreibt Obama resigniert, "und kehrte in sein Büro zurück, während ich grimmig irgendetwas murmelte".
Fast verwundert registriert der Vater zweier Mädchen, dass die beiden, Malia und Sasha, den Umzug nach Washington nicht nur gut wegstecken. Vielmehr scheinen sie ihr Leben im Weißen Haus durchaus zu genießen und wachsen im Gegensatz zu den Befürchtungen des besorgten Vaters ziemlich unbeschwert auf.
Anrührend kommt Obama auf die Belastungen zu sprechen, die sein Amt für seine Frau mit sich bringt. Sie war dagegen, dass er antritt, trägt seine Entscheidung aber loyal mit, obwohl sie ihm bereits bei seiner Kandidatur für den US-Senat sagt: "Das war's dann aber, Barack. Ein letztes Mal." Als er tatsächlich die Präsidentenwahl gewinnt, "senkte die Aussicht auf Einsamkeit sich wie eine Wolke über sie".

Der frühere US-Präsident darf im Gespräch mit dem Moderator seine Memoiren präsentieren. Und bietet eine Erklärung für seine eigene Wahl - und die seines Nachfolgers Trump.
Immer wieder, das ist aus den Zeilen deutlich herauszulesen, kämpft die erste schwarze First Lady mit Anflügen von Depression oder zumindest tiefer Niedergeschlagenheit. Und sie ist hin- und hergerissen zwischen ihren Aufgaben als Mutter, der Rolle einer First Lady und dem eigenen Anspruch, "Klischees über die Stellung der Frau aufzubrechen", was sich zumindest mit den traditionellen Vorstellungen nur schwer unter einen Hut bringen lässt.
Bis zu ihrem Umzug ins Weiße Haus war sie stets berufstätig, auch wenn sie, wie Obama einräumt, Karrierechancen aus Rücksicht auf die Familie sausen ließ.
Obama verwebt immer wieder mit leichter Hand mitunter erschöpfend detaillierte Darstellungen seiner Amtsgeschäfte mit derlei persönlichen Reminiszenzen. Wirklich politisch brisant dürften die Memoiren indes in einem Punkt sein: seine Abrechnung mit den Republikanern, deren Führungsleute er allesamt - und nicht nur Trump - für die gefährliche Polarisierung des Landes verantwortlich macht.
Die Republikaner sieht er schon lange als Problemfall
Da ist zum einen die Birther-Kampagne, die Trump bereits 2011, also lange vor seinem Einstieg in die Politik, anzettelt. Es ist der haltlose Vorwurf, dass Obama nicht in den USA geboren worden sei und damit kein Anrecht auf das Präsidentenamt habe. Klar sieht Obama den rassistischen Kern der Botschaft: dass ein schwarzer Mann nichts im Weißen Haus zu suchen habe, "als glaubten meine Gegner, die natürliche Ordnung der Dinge löste sich auf".
Es ist aber eben nicht nur Trump. Schon in der Nominierung der damaligen Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, als republikanische Vizepräsidentschafts-Kandidatin 2008, sieht Obama eine Weichenstellung. "Es schien, als würden mit Palin die dunklen Gespenster, die lange an den Rändern der Republikanischen Partei ein Schattendasein gefristet hatten - Fremdenfeindlichkeit, Antiintellektualismus, paranoide Verschwörungstheorien, die Abneigung gegenüber Schwarzen und braunen Menschen -, ihren Weg in die Mitte der Partei finden."
Der bald entstehenden Tea-Party-Bewegung wirft Obama ebenfalls rassistische Ressentiments vor. Sie habe ihn "dämonisiert und damit eine unmissverständliche Botschaft an alle republikanischen Amtsträger gesandt: Im Widerstand gegen meine Regierung galten die herkömmlichen Regeln nicht mehr".
Und dann ist da die Obstruktionsstrategie der Spitzenleute der Republikanischen Partei von Tag eins seiner Amtszeit an, angeleitet vom damaligen Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell: "die Weigerung, mit mir oder Angehörigen meiner Regierung zusammenzuarbeiten, egal unter welchen Umständen, zu welchen Themen und ungeachtet der Folgen für das Land". Auch ihnen, so schreibt Obama, sei "der Wahrheitsgehalt dessen, was sie sagten, vollkommen gleichgültig".
Was sie von Trump unterscheide? Lediglich, dass Letzterer noch dreister lüge. McConnell ist heute Mehrheitsführer im Senat. Das lässt wenig Gutes für die Ära Biden ahnen.

