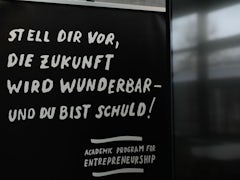Lisa von der Heydte ist Professorin für Management in der Sozialwirtschaft an der Katholische Stiftungshochschule München (KSH). Sie kommt aus der Welt des Social Entrepreneurship und erhielt ihren Ruf an die Hochschule vor zwei Jahren. Seither versucht sie, Studierende, die sich für Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik oder Pflegemanagement entschieden haben, fürs Gründen zu begeistern und ihnen unternehmerisches Denken nahezubringen. Kein einfaches Unterfangen.
SZ: Frau Professor von der Heydte, Sie beschäftigen sich mit Innovation und Unternehmertum in der Sozialwirtschaft - ist das nicht ein Widerspruch?
Lisa von der Heydte: Das halten tatsächlich viele erstmal für einen Gegensatz. Man fragt sich: "Geht es um etwas Soziales oder um Unternehmertum?" Mich treibt die Frage um, wie sich beides verbinden lässt - zum Beispiel durch Social Entrepreneurship.
Was ist damit gemeint?
Die Idee von Social Entrepreneurship ist, dass man soziale Herausforderungen mit unternehmerischen Herangehensweisen löst. Viele finden das zunächst einmal völlig absurd.

Neues aus München, Freizeit-Tipps und alles, was die Stadt bewegt im kostenlosen Newsletter - von Sonntag bis Freitag. Kostenlos anmelden.
Wie sind Sie darauf gekommen, daraus Ihren Beruf zu machen?
Mein erster Job hat mich nach München gebracht, zu Ashoka, eine der weltweit größten Organisationen, die Social Entrepreneurs fördern. Später habe ich für einen Rückversicherungskonzern internationale Organisationen beraten, wie sie mit den Risiken von Naturkatastrophen umgehen können. Und wie das Leben manchmal spielt, hat sich hier eine sozialunternehmerische Möglichkeit geboten: Mit einigen Kollegen konnten wir so aus einem bestehenden Dax-Konzern heraus ein soziales Unternehmen gründen.
Was war das Ziel dieser Ausgründung?
Wir haben eine Katastrophen- und Risikoberatung für humanitäre und Entwicklungshilfeorganisationen aufgebaut. Damit diese Institutionen ihre Risiken besser managen und mit ihren Ressourcen mehr erreichen können, haben wir ihnen Risiko-Daten und das nötige Wissen an die Hand gegeben. Man weiß zum Beispiel ziemlich genau, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Malaria-Ausbruch rund zwei Wochen nach einer Überschwemmung bei einer Temperatur von über 30 Grad Celsius sehr hoch ist. Das heißt, dass man als Hilfsorganisation schon früh in das Gebiet reingehen und Ärzte, Medikamente und Moskitonetze hinschicken kann.
Warum sollten Non-Profit-Organisationen öfters mit den Methoden gewinnorientierter Unternehmen arbeiten?
Da gibt es die nüchterne Erkenntnis, dass die Sozialleistungsquote mit 34 Prozent ein Rekordhoch erreicht hat und sozialstaatliche Mittel am Limit sind. Zugleich bewirken Kirchenaustritte, dass weniger Geld für wohltätige Zwecke zur Verfügung steht. Gleichzeitig altert die Gesellschaft; damit steigt beispielsweise der Bedarf an Hilfsleistungen. Auch das Spenderverhalten verändert sich gerade und verstärkt den Trend zum Unternehmerischen.
Die Deutschen spenden rund fünf Milliarden Euro im Jahr für gemeinnützige Zwecke. Was soll daran unternehmerisch sein?
Spender wollen immer öfter genau wissen, was mit ihrem Geld passiert und eine soziale Rendite über ein einmaliges "Hunger-Stillen" hinaus erzielen. Vor allem Unternehmer geben ihr Geld heute seltener in klassische Stiftungen, sondern investieren in soziale Unternehmen, um einen sozialen Ertrag zu bekommen. Genau darum geht es auch in meiner Arbeit an der Hochschule.

Prallen da nicht zwei Welten aufeinander - hier die katholische Stiftungshochschule, die auf Sozial-, Pflege-, Gesundheits- und pädagogische Berufe spezialisiert ist - und dort das Start-up-Denken?
Es sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen, ja, die aber in ihrer Kombination viel Positives bewirken können. Ich war jahrelang in einer Art Social Entrepreneurships Bubble unterwegs. Social Start-ups begeistern und faszinieren zugleich - was dazu führt, dass manch einer verdrängt, dass ein Großteil der sozialen Dienstleistungen in Deutschland durch traditionelle Wohlfahrtsorganisationen erbracht wird, die es seit 100 und mehr Jahren gibt.
Sie meinen Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und dergleichen?
Ja. Diese Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege leisten einen großen Teil der sozialen Arbeit für die Gesellschaft - etwa in der Kinder- und Jugendarbeit und Altenpflege. Ich frage mich: Wie können wir sozialunternehmerische Ansätze im klassischen Wohlfahrtbereich noch stärker fördern, um zum Beispiel Lösungen für die Personal- und Ressourcenknappheit zu finden? Genau da versuchen wir mit der Entwicklung des Social Innovation Campus an unserer Hochschule anzusetzen.
Warum will die KSH den Unternehmergeist ihrer Studierenden wecken?
2040 wird der Soziale Sektor mit über sieben Millionen Beschäftigen der größte Arbeitgeber Deutschlands sein. Jeder spürt - oft sogar am eigenen Leib - wie in diesem Bereich das Angebot an sozialen Dienstleistungen und die Nachfrage nicht mehr übereinkommen. Gleichzeitig gibt es keinen Sektor in Deutschland, der strukturell und kulturell so komplex und digital so abgehängt ist. Die Herausforderungen sind enorm. Wir wollen hier zum Beispiel Organisationen der Wohlfahrt und Social Entrepreneurs miteinander vernetzen und unsere Studierenden zu Gründungen befähigen.
Sollen angehende Hebammen, Pfleger oder Sozialarbeiter etwa lernen, einen Businessplan zu schreiben?
Ja, genau. Oder zumindest möchten wir den Studierenden ein Grundverständnis für ökonomische Zusammenhänge und einen Instrumentenkoffer bieten, mit dem sie zukünftige Fragestellungen sozialunternehmerisch lösen können. Als ich vor zwei Jahren den Ruf an die KSH bekam, dachte ich, die Studierenden würden mir die Türen einrennen. Aber so war es nicht: Die meisten begegneten sozialunternehmerischen Ideen mit Skepsis.
Konnten Sie die Studierenden inzwischen von Ihrem Ansatz überzeugen?
Die Arbeit an konkreten Aufgaben und die Kooperationen mit Partnerorganisationen helfen den Studierenden, sich in Fragestellungen hineinzudenken. Sie lernen, wie man anhand eines praktischen Falls ein Geschäftsmodell entwirft.
Zum Beispiel?
Ein Team hat sich mit Massenunfällen und Naturkatastrophen befasst, bei denen es eine große Zahl von leicht und schwer Verletzten gibt. Bislang nutzen Rettungskräfte Anhängekarten, um diese Patienten zu priorisieren, damit die Ärzte wissen, wem zuerst geholfen werden muss. Also Stift und Zettel, was umständlich ist. Die Studierenden haben dafür einen digitalen Geo-Tag entwickelt, in den die Daten der Betroffenen eingetragen werden. Diese Technik ermöglicht eine reibungslose Zuordnung von Personen und einen guten Überblick über die Einsatzlage.
Welche Ideen hatten die Studierenden noch?
Eine Gruppe entwickelte eine Rekrutierungsstrategie für Personal in sozialen Einrichtungen, die mit künstlicher Intelligenz und Neuromarketing arbeitet. Ein anderes Team schrieb einen Chatbot, der Menschen, die oft fehlenden oder schwer zu findenden Information für die rechtlich Betreuung von Angehörigen und anderen Personen zugänglich macht.
Aber am Ende kommt es doch darauf an, die großen Wohlfahrtsorganisationen von innen zu verändern?
Diese Veränderungen geschehen ja bereits. Wenn man das Rote Kreuz nimmt oder die Caritas - die wissen, dass Social Entrepreneurship durchaus sinnvoll ist. Sie haben alle schon innovative Ansätze auf den Weg gebracht. Aber aufgrund der schon genannten Organisationskultur und -struktur geschehen Veränderungsprozesse deutlich langsamer als in anderen Bereichen der Wirtschaft.
Deshalb haben etwa die Malteser das "Gewächshaus M" geschaffen, eine Art Accelerator, der soziale Innovationsprojekte der Mitarbeitenden voranbringt. Eine Ausnahme?
Etwas Vergleichbares gibt es beim Deutschen Roten Kreuz mit der Social Innovation Community oder bei der Caritas in Wien mit Magdas, einem Sozialunternehmen, das Menschen sinnstiftende Ausbildungs- und Arbeitsplätze bietet, die bei vielen anderen Arbeitgebern keine Chance erhalten. Aber diese Organisationen sind sehr komplexe Systeme, die Zeit brauchen, um sich zu verändern.