"Los", sagt der vierjährige Arthur und drückt mit dem Finger auf das Tablet, das vor ihm auf einem Stativ steht. Die Kinder auf der Couch stellen sich kurz vor: Jana aus der Bärengruppe, Johanna von den Eichis, Johanna von den Igeln, Leonie von den Füchsen und Arthur, auch ein Bär. Leonie zieht das Mikrofon ein wenig näher zu sich heran. "Kannst du kurz erklären, was das Kinderparlament ist?", fragt die Grundschülerin. "Da werden Kinder ausgewählt. Die gehen dann in den Veranstaltungsraum und besprechen, was so alles passiert", erklärt eine der Johannas. Doch dann muss der Dreh unterbrochen werden. Arthur hat den Aufnahme-Knopf nicht richtig erwischt und also bisher nichts aufgezeichnet - alles noch mal von vorne.
Das Kindertageszentrum Sankt Martin in Obergiesing, kurz Kitz genannt, erarbeitet mit sieben weiteren städtischen Kitas und acht Schulen auf Wunsch des Bildungsreferats gerade ein Konzept zur digitalen Bildung. Heute drehen die Kindergarten- und Schulkinder gemeinsam ein Video. Sie erklären, was das Kinderparlament ist. Der Film wird beim nächsten Elternabend gezeigt - damit die Mütter und Väter wissen, was so los ist im Alltag ihrer Kinder.

Maria Urban bereitet am Münchenkolleg Erwachsene auf das Abitur vor. Mit so viel Herzblut und Engagement, dass sie von ihrer Klasse für den Preis vorgeschlagen wurde.
Dass Medienpädagogik hier eine große Rolle spielt, sieht man schon am Eingang. "Fotografieren verboten", steht dort - selbst die Kleinsten lernen schon, dass sie ein Recht am eigenen Bild haben. Als sie in der Einrichtung von dem Projekt zur Medienbildung gehört haben, haben sie sich sofort beworben. "Wir finden es toll, dass wir hier im Haus mit Medien arbeiten können und dabei gut begleitet werden", sagt Leiterin Vera Dopfer. "Unsere Aufgabe ist es, die Eltern zu sensibilisieren und den Kindern, die in einem digitalen Alltag aufwachsen, zu vermitteln, dass man ein Tablet nicht einfach so nutzt, sondern überlegt und wohldosiert", erklärt Dopfer.
"Wir haben durch das Projekt für jede Gruppe leihweise ein iPad bekommen", berichtet Erzieherin Eva Gregorovics, die für die unter Sechsjährigen verantwortlich ist. Die Kinder gestalten damit Comics und Bilderbücher, sie fotografieren und filmen sich. Gerade arbeiten die Vorschulkinder an ihrem ersten Kochbuch. "Außerdem gibt es tolle Apps zur Sprachförderung", sagt Gregorovics. Kollegin Gabi Wagner kümmert sich um die Medienbildung der Hortkinder. Sie dürfen mit Apps lernen, können unter Aufsicht im Internet recherchieren oder auch mal spielen. "Vier gewinnt oder Puzzles sind am Tablet einfach interessanter", sagt Wagner.
Die ausgewählten Schulen und Kitas haben sich vor eineinhalb Jahren auf den digitalen Weg begeben, um München wieder zu dem zu machen, was es Ende der Neunzigerjahre mal war: ein Vorbild in Sachen Medienpädagogik. Sie erarbeiten Bausteine für ein "Konzept Münchner Medienbildung für medienkompetente Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene" (KoMMBi). Sie entwickeln digitale Unterrichtseinheiten und sie testen Wlan-Router, iPad-Koffer und Whiteboards. Vor allem aber haben sich die teilnehmenden Einrichtungen das Ziel gesetzt, ihre Lehrer und Erzieher zu qualifizieren, ihnen die Scheu vor Tablets, vor interaktiven Whiteboards und dem Internet zu nehmen und sie zu motivieren, mit digitalen Medien im Alltag zu arbeiten.
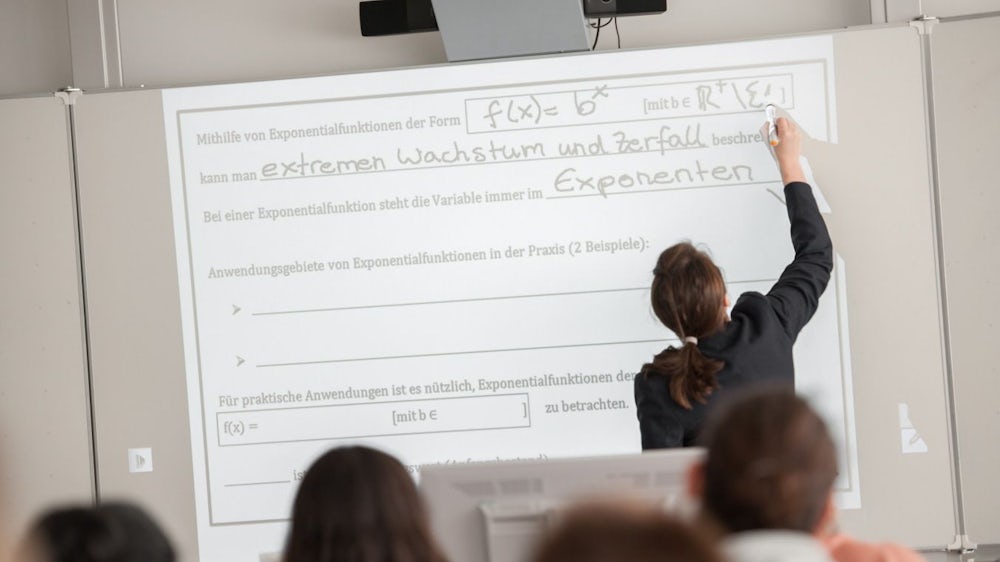
Das bayerische Kultusministerium verlangt ohnehin von jeder Schule ein Digitalkonzept bis 2020. In München aber kämpfen Lehrer noch mit schwerfälligen Systemen, mit Zugangsberechtigungen zum Verwaltungsnetz und Datenschutzproblemen im pädagogischen Netz, mit langsamen Internetverbindungen und fehlenden Wlan-Zugängen. München hinkt der Digitalisierung hinterher. Bildungsreferat und Stadtrat haben mittlerweile reagiert. 55 Millionen will die Stadt alleine für schnellere Leitungen und kabelloses Internet ausgeben, dazu stehen zweistellige Millionenbeträge für Lehrerarbeitsplätze zur Verfügung. Bis aber alle der mehr als 300 öffentlichen Schulen auf einem aktuellen Stand sind, wird es dauern.
Fünf Jahre ist es bereits her, da startete die Stadtratsfraktion der Grünen einen ersten Digitalisierungsversuch. Das Pädagogische Institut, das dem Bildungsreferat angegliedert ist, erarbeitete daraufhin ein Konzept. "Lernen 2020" hieß es, und es war so teuer, dass sich der damalige Stadtschulrat Rainer Schweppe vor der Kommunalwahl 2014 damit nicht in den Stadtrat traute. Er gründete stattdessen die Strategiegruppe Medienpädagogik. Die wiederum beauftragte erneut das Pädagogische Institut, ein Gesamtkonzept für Medienbildung zu erarbeitet. KoMMBi war geboren.
Im Pädagogischen Institut sind Sonja Moser und Christine Debold für das Projekt verantwortlich. Sie standen erst mal vor einem Haufen Problemen. In der Stadt erhalten Schulen nur eine technische Ausstattung, wenn ein pädagogisches Konzept zur Nutzung der Geräte existiert. Kindertagesstätten haben bisher solche Konzepte nicht, weshalb sie auch keine Geräte haben, die von den Kindern genutzt werden können. Auf der anderen Seite gibt es in München Schulen, die sogar Tablets besitzen und Whiteboards in allen Zimmern. Mit dieser Bandbreite an Voraussetzungen sahen sich Moser und Debold konfrontiert. "Wir haben uns daher für ein dezentrales Vorgehen entschieden", sagt Moser. Jede Schule und jede Tagesstätte müsse sich selbst entscheiden, wie sie das Projekt angehen wolle.
Das Pädagogische Institut schulte pro teilnehmender Einrichtung zwei bis drei Medienbeauftragte. "Sie sollen als Motor das Thema Digitalisierung in den Einrichtungen voranbringen", sagt Debold. Aber sie sollen auch nicht alleine Leuchtturmprojekte starten: Bei der Auswahl der Kitas und Schulen habe das Pädagogische Institut daher darauf geachtet, dass auch die Schulleitungen hinter dem Projekt stehen. "Jede Schule macht ein eigenes Projekt", sagt Moser. Das solle nachhaltig und fächerübergreifend sein und sich am besten auch noch auf andere Schularten übertragen lassen.
In der Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft im Norden Münchens sind die Lehrer Stephan Hübner, Manfred Köhler und Melanie Walther die Medien-Botschafter. Die drei haben sich nach Themengebieten aufgeteilt: Hübner beschäftigt sich mit dem Einsatz von Smartphones und Tablets im Unterricht. Köhler testet, wie Schüler lernen, moderne Medien effizient und verantwortungsbewusst zu nutzen und deren Inhalte für eine Präsentation aufzuarbeiten. Walther beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit sozialen Medien und digitalen Plattformen. Die Ergebnisse sollen am Schluss in ein Medienkonzept einfließen und Anregungen für andere Lehrer bieten.
Heute unterrichtet Walther eine 13. Klasse in Mathematik, Exponentialfunktionen stehen auf dem Stundenplan, ein eher trockenes Thema. Zu Beginn der Stunde zeigt sie ein Video, das sie vorher bei Youtube herausgesucht und zu dem sie für die Schüler ein Skript mit Lückentext erstellt hat. Film schauen und dabei Text ausfüllen, lautet die erste Aufgabe. Es gibt Schlimmeres. Die Schüler erfahren sofort, warum die Exponentialfunktion doch nützlich sein könnte: Sie beschreibt die Ausbreitung von Fischschwärmen oder Epidemien und den Zerfall von radioaktivem Material.

Bei der Besprechung schreibt Walther auf dem interaktiven Whiteboard mit einem speziellen Stift mit. Der verschwindet wieder, wenn das Gerät ausgeschaltet wird - Tafelwischen ist also überflüssig. Mit wenigen Klicks markiert Walther die wichtigsten Passagen in Gelb und verteilt dann iPads an die Klasse. Mit einem QR-Code auf dem Skript gelangen die Schüler automatisch zu einer Aufgabe, die sie nun lösen sollen - auf Papier allerdings. "Mit den iPads arbeiten wir natürlich nicht jede Stunde", sagt Schulleiter Matthias Rauch. Nur wenn es zum Lehrplan passe - das Tablet als Werkzeug wie Mathe-Buch, Zirkel oder Taschenrechner.
Um zu überprüfen, ob die Schüler den Stoff verstanden haben, könnte Walther in der nächsten Stunde einen Test schreiben - das käme eher schlecht an. Sie lässt die Schüler stattdessen an einem Mathe-Quiz teilnehmen. Das funktioniert wie "Wer wird Millionär". Alle Schüler loggen sich über ihr iPad ein und wählen einen Namen. Für jede Antwort haben sie ein paar Sekunden Zeit. Das Programm wertet nicht nur richtige Antworten, sondern auch, wie schnell diese kamen - und zeigt alles in Echtzeit auf dem Whiteboard an. "Meine Rolle als Lehrerin hat sich verändert", wird Walther nach der Stunde sagen. Sie sei mehr Lernbegleiterin geworden, die beim Lernen unterstützt. Reine Wissensvermittlung ist heute nicht mehr gefragt.
Knapp elf Kilometer in südwestlicher Richtung unterrichtet Anna Dietmayer am Louise-Schröder-Gymnasium Englisch in einer fünften Klasse. Die Schüler sitzen in Zweiergruppen über ihre iPads gebeugt. Heute sollen sie das Sprechen üben. "Das ist manchmal sehr anstrengend, weil gerade die schüchternen Schüler sich nicht trauen", sagt die Lehrerin. Was aber in der analogen Welt so schwer fällt, klappt mit digitaler Unterstützung perfekt. In der letzten Stunde haben die Schüler Dialoge geschrieben. Das Thema: eine Unterhaltung über das Schulsystem.

Die Stadt will an ihren Schulen ein digitales Serviceportal einführen. Bisher gibt es das in München nur am Luisengymnasium - anderswo ist es längst Standard.
In einer App bestimmen die Kinder nun den Hintergrund ihres Zeichentrickfilms, wählen die Charaktere aus und drücken auf Aufnahme. Wenn die Figur ihren Mund bewegen soll, müssen die Kinder nur ihren Finger auf der Figur bewegen. Tim-Luca Roth und Johannes Trespe haben Abraham Lincoln als Polizisten verkleidet und lassen ihn mit einem Cowboy im Ballerina-Kleid sprechen. "Mrs Dietmayer is my favourite teacher", sagen die Jungs. Ihre Lehrerin geht währenddessen von Gruppe zu Gruppe, hilft bei Fragen, korrigiert bei offensichtlichen Fehlern. "Wir üben schon mal, als nächstes macht die Klasse ein Video über die Schule", sagt Dietmayer.
Im Louise-Schröder-Gymnasium mussten Lehrer und Schulleitung bisher viel improvisieren. Sie haben sich eigene Medienwagen mit Rechner, DVD-Player und sogar Videorekorder zusammengebaut. Von seinem Budget kauft Schulleiter Robert Laslop nach und nach Whiteboards. Einige fehlen noch, was daran lag, dass der Rahmenvertrag der Stadt unbemerkt ausgelaufen war und die Schulen monatelang nichts mehr besorgen konnten. "Das einzige, was uns wirklich noch fehlt, ist Wlan", sagt Jakob Sauer, der zweite Medienbeauftragte der Schule. Deshalb habe sich das Gymnasium auch an KoMMBi beteiligt: Denn im Projekt testet es mobile Router - so schnell geht das bei der Stadt sonst nicht.
Bis Juli noch läuft KoMMBi, solange können die beteiligten Schulen und Kitas ihre Vorzugsbehandlung genießen und weiter an ihren Konzepten arbeiten. Noch in diesem Jahr will Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) die Erkenntnisse bündeln und dem Stadtrat eine "Digitalisierungsstrategie für Bildungseinrichtungen" vorstellen. Wie es mit den KoMMBi-Einrichtungen und deren Projekten konkret weitergeht, ist noch unklar. Fest steht hingegen, dass der digitalen Offensive dieses Mal keine Kommunalwahl in die Quere kommt. Die findet erst wieder im Frühjahr 2020 statt. Bis dahin sollen die Schulen zumindest schon mehrheitlich schnelles Internet haben - falls der Plan dieses Mal tatsächlich aufgeht.

