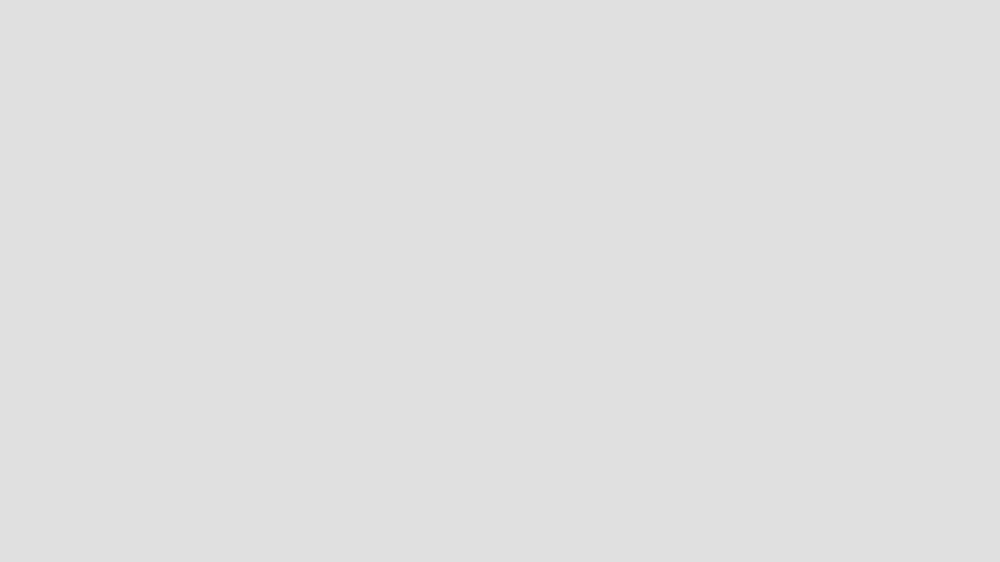Der Arabische Frühling hatte seine beste Zeit hinter sich, und der politische Spielraum verengte sich täglich, aber noch wurden Visionen straffrei verbreitet. Während sich auf dem Tahrir-Platz in Kairo die Masse heiser schrie, verstieg sich daneben im achten Stock eines Hotels einer der führenden Salafisten Ägyptens zu einer bemerkenswerten Forderung. Er wünsche sich für sein Land Demokratie, und zwar nicht irgendeine Demokratie, sondern ein demokratisches System wie in Frankreich.
Frankreich, das Mutterland der Revolution, das kurz zuvor ein Verbot des Niqab, des Gesichtsschleiers, ausgesprochen hatte? Wirklich? Der Salafist, kurz aus dem Konzept gebracht, rettete sich in die große Dimension: Jawohl, und warum nicht gleich ein modernes Kalifat schaffen, eine Gemeinschaft der Gläubigen - nach dem Vorbild der Europäischen Union?

Wer gehört zur Nation? Weil die Begriffe schwammig sind und die Definitionen fehlen, tut sich Deutschland mit "den Anderen" so schwer.
Sieben Jahre später wirkt die Szene erstaunlich: durch die unhinterfragte, inzwischen fast nostalgische Strahlkraft der Begriffe "Europäische Union" und "Demokratie", aber auch, weil die Demokratieforderung des Bärtigen ein grundlegendes, und hochaktuelles Missverständnis darüber verrät, was dieser Begriff wohl bedeutet. Nach einem Bonmot unter Nahost-Experten erschöpft sich die islamistische Demokratievorstellung in einem Machtgewinnungsmechanismus aus wenigen Worten: "One man, one vote, one time". Hätten die Islamisten einmal die Macht durch Wahlen errungen, so die Vermutung, würden sie sie einzig dazu nutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Und so war Demokratie natürlich nicht gemeint.
Inzwischen hat dieser Irrtum allerdings seinen Widerhall in der europäischen Gegenwart gefunden. Dass die Falschen demokratische Mittel missbrauchen, um die Demokratie zu deformieren oder sogar abzuschaffen, ist eines der Bedrohungsszenarien in der allmählich doch sehr reichhaltigen Demokratiedämmerungsliteratur. Autoren von Yascha Mounk über Steven Levitzky und Daniel Ziblatt bis zu Georg Seeßlen beschreiben das Siechtum einer einst unbesiegbaren Idee. Besorgte Analysen von Georg Diez ("Das andere Land"), Hans-Peter Martin ("Game over") und Michael Hartmann ("Die Abgehobenen") folgen im Herbst.
Zwar zeichnen sich am Horizont auch optimistischere Werke ab, aber das Grundgefühl, das auch eine Zeitschrift wie Foreign Affairs ("Is Democracy Dying?") erfasst, lässt sich etwa so zusammenfassen: 26 Jahre nachdem Francis Fukuyama das "Ende der Geschichte" und den Sieg der westlichen Demokratie ausrief, trägt eben jene Demokratie nur noch Episodencharakter. Der unschlagbare Magnetismus des demokratischen Modells wurde vom Aufstieg der Rechten, Populisten und Autokraten längst performativ widerlegt. Wenn China wirtschaftlich so übermächtig und Russland außenpolitisch so aggressiv sein darf, wenn in Ungarn, Polen, Österreich Rechtspopulisten Wahlen gewinnen, ist es Zeit für eine schonungslose Selbstprüfung: Waren die Minderheiten in ihren Ansprüchen zu maßlos? Die "Eliten" zu gierig? Das "Establishment" zu arrogant? Die Medien zu selbstbezogen?
Die Geschwindigkeit, mit der dabei der universelle Anspruch der Demokratie preisgegeben wird, ist atemberaubend. Handlungsleitende Grundannahmen von gestern, hat der brillante bulgarische Soziologe Ivan Krastev konstatiert, "wirken inzwischen nicht nur veraltet, sondern geradezu unverständlich". Differenzierte, weit gereiste Zeitgenossen fragen ohne zu blinzeln, ob die Demokratie noch das beste Modell für Deutschland ist. Sieht so das Ende aus?
Im Jahr 2000 hatten weltweit bis auf acht Länder alle Staaten zumindest einmal wählen lassen
Nimmt man die düsteren Panoramen genauer in Augenschein, erkennt man vor allem die geschickte Pinselführung. Lange Zeit war Unschärfe ein Trick der Feinde der Demokratie. Unter dem Deckmantel demokratischer Forderungen, schallte es aus Moskau oder Damaskus, wolle der Westen nur seinen "Way of Life", Nacktbilder oder die Nato-Außengrenzen in fremdes Staatsgebiet tragen. Die bunte Revolution in Georgien? Der Maidan in Kiew? Der Arabische Frühling? Demokratisch verbrämte Expansionsbewegungen.
Das war reine Propaganda. Nun betreiben ausgerechnet die Hüter der Demokratie ähnliche Übersteigerungen. Zu den Grundzutaten einer Demokratie gehören freie Wahlen, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Aber wenn jetzt von der todkranken Demokratie die Rede ist, geht es meist um viel mehr: wirtschaftliche oder militärische Überlegenheit, ein liberales Gesellschaftsmodell, kulturelle Offenheit, "westliche" Werte, ja, gleich um den ganzen "Westen". Selten sah das Abendland so schlecht aus.
Aber wenn China Amerika wirtschaftlich überflügelt, ist dies ein Beweis für die Überlegenheit chinesischer Unternehmen, nicht des Einparteiensystems. Ein Völkerrechtsbruch wie die Annexion der Krim entkräftet nicht das Freiheitsbedürfnis der Ukrainer, es bleibt ein Völkerrechtsbruch.
Im Idealfall gewährleistet die Demokratie den zivilen, gewaltfreien Interessenausgleich, auch für Minderheiten, wenn auch nicht für alle Partikularinteressen. Diese Fähigkeit zum Konsens macht der Demokratie keiner nach, und sie unterscheidet sich grundlegend von der Umverteilung von Privilegien, politischer Erpressung oder einem schlichten Elitenwechsel, mit denen Autokratien Warlords, Palastfraktionen oder Geheimdienstzweige bei Laune halten. Wer Autokratien von innen gesehen hat, der weiß, dass sie sich gerade nicht durch jene stahlharte, effektive Exekutive oder Verwaltung auszeichnen, die ihnen demokratieverwöhnte Europäer manchmal andichten, sondern durch eine hirnerweichende Bürokratie, Korruption und Klüngel.
Der Schriftsteller Roberto Saviano prangert das Schweigen in seinem Land an und appelliert an Italiens Intellektuelle, gegen die Angriffe auf Demokratie und Bürgerrechte aufzustehen.
Dieser segensreiche demokratische Konsens beinhaltet allerdings nicht immer das Wünschenswerte, beispielsweise ein offenes Gesellschaftsmodell, wie es der Westen nach Jahrzehnten zu schätzen gelernt hat. Wenn eine konservative Gesellschaft keine Schwulenehe einführen möchte, ist das zweifellos tragisch für Homosexuelle, aber nicht der Beweis finaler Demokratieunfähigkeit. Die Demokratie ist kein Wunscherfüllungsapparat, sondern eine ziemlich zähe, manchmal enttäuschende Sache. "Es kann das Volk sein eigener Tyrann sein, und es ist es oft gewesen", schrieb Ludwig Börne in vordemokratischen Zeiten hellsichtig.
Zu den jüngsten Diktaturaussteigern zählen Äthiopien Usbekistan
Hinzu kommt, dass die düstersten Prognosen zeitlich auf schmalem Grat fußen. Der Reputationseinbruch der Demokratie vom respektierten politischen Konzept zum Schlusslicht der Systeme hat sich innerhalb weniger Jahre vollzogen - durch Trump, Putin, Orbán, AfD oder den Brexit, auch wenn letztere nun gerade das Resultat einer Volksabstimmung waren. Gegen die Wucht der jüngsten Ereignisse aber hilft einzig die historische Gesamtschau. Denn quantitativ ist die Sache klar.
1941, so hat der Economist vorgerechnet, waren gerade ein Dutzend Staaten demokratisch, im Jahr 2000 aber hatten weltweit bis auf acht Länder alle Staaten mindestens einmal wählen lassen. Und auch wenn dazu Schein-, Halb-, Viertel- und Garnicht-Demokratien gehören, ist die Zahl der Staaten, die in den vergangenen Jahrzehnten den Schritt zur Demokratie geschafft haben, um ein Vielfaches größer als jener, die von einer Demokratie in eine Diktatur abgeglitten sind. Zu den jüngsten Diktaturaussteigern zählen Äthiopien und - praktisch unbeachtet - der jahrzehntelange Folterstaat Usbekistan.
Auch früher sei die Demokratie gelegentlich in Bedrängnis geraten, gibt der Politologe Yascha Mounk zu bedenken, doch habe sie sich immer wieder erholt. Es gibt sehr vernünftige Gründe, die Attraktivität des Modells nicht aus dem Blick zu verlieren. Unübertroffen ist die Demokratie beispielsweise in allen Angelegenheiten des Machtwechsels. In jeder Autokratie ist dies ein krisenhafter, sogar systemgefährdender Moment. Stirbt der Despot, fallen ähnlich üble Prätendenten übereinander her. Einen Herrscher zu Lebzeiten abzulösen ist nicht leichter. Da ein politischer Neustart nach ein paar Jahren ausgeschlossen ist, und der Gefallene die politische oder juristische Rache der Rivalen fürchten muss, bleibt ein freiwilliger Machtverzicht Selbstmord - mit der Folge schier unendlicher, immer verbissener verteidigter Regentschaften.
Eine eigenartige Lust am Untergang greift um sich
Keiner der vermeintlich so fest installierten Autokraten - weder Orbán noch Erdoğan noch Putin - hat diesen heiklen Übergang bislang gemeistert. Putins Intermezzo als Premier zwischen zwei Präsidentschaften war ein Trick, um das Problem zu umgehen. Wie schwankend das System tatsächlich ist, zeigt der Einbruch seiner Popularitätswerte, weil die Regierung das Rentenalter anheben will. In Demokratien ist Abgewähltwerden Routine, aber viele Russen können sich Russland ohne Putin gar nicht mehr vorstellen. Autokratien leben von der Gegenwart, die Zukunft ist nicht ihre Stärke.
Insofern wundert man sich, wie viel Dreck der Demokratie gerade hinterhergeworfen wird, mit wie viel Verve herbeigeschrieben wird, was doch um jeden Preis verhindert werden soll. Dass Polen und Ungarn junge, instabile Demokratien sind, die nun Rückschritte erleben, ist schlimm genug. Aber nur schlechte Historiker beschreiben Fortschritt als lineare Entwicklung. In den reifen, institutionell gefestigten Demokratien wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, auch Amerika kontrollieren sich die Gewalten gegenseitig, selbst wenn ausgesprochen unappetitliche Kräfte dies ändern wollen.
Eine eigenartige Lust am Untergang greift um sich, die naiv nennt, was nur vernünftig ist: das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit eines Modells, das Winston Churchill "die schlechteste aller Staatsformen" nannte - "ausgenommen alle anderen". Bislang hat nichts und niemand diesen Satz widerlegt.