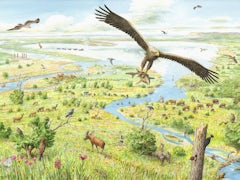Der Anruf, der vieles veränderte, erreichte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund am Morgen eines kalten Spätwintertages über die Tierfund-Hotline. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Meeresbiologin und Robbenforscherin Linda Westphal, solchen Anrufen nachzugehen. Aber als der Kollege sagte, jemand habe ein totes Kegelrobben-Jungtier am Kap Arkona gesehen, war sie sofort aufmerksam. Wenig später stieg sie die Veilchentreppe an der Rügener Steilküste hinunter. Tatsächlich: Wenige Meter hinter dem Fuß der Treppe lag das Tier.
Das weiße Fell hatte diesen Gelbstich, der typisch ist für neugeborene Kegelrobben. Die Nabelschnur war frisch, Blut tränkte den Sand. Das Meer war ruhig, zwischen Tier und Strand lagen große Steine. Es konnte nicht angespült worden sein. Linda Westphal wusste, was das bedeutete. Es war der 8. März 2018, und alles wies darauf hin, dass dieser Fund der erste Nachweis einer Kegelrobbengeburt an der deutschen Ostseeküste seit mehr als 100 Jahren war.
Die Tiere können im Schwimmen schlafen
Es waren noch einige Untersuchungen und Beratungen nötig, ehe Linda Westphal und andere Experten sicher sagen konnten, dass dieses kleine tote Kegelrobbenmännchen tatsächlich ein Kind der vorpommerschen Fauna ist. Aber mittlerweile hat sich die Erkenntnis gesetzt: Die Kegelrobbe ist zurück in der deutschen Ostsee, und zwar nicht nur als Gast, der aus anderen Regionen herangeschwommen kommt, sondern als einheimische Tierart.
Das Frühjahr brachte weitere Funde. Im April wurde ein zweites Kegelrobben-Junges in Heringsdorf auf Usedom gesichtet. Wenige Tage später bekam Linda Westphal den nächsten spektakulären Anruf. Sie hatte gerade eine Rekordentdeckung im Osten des Greifswalder Boddens gemacht: Über 200 Kegelrobben lagen zur Laichzeit des Herings auf dem Riff Großer Stubber. "Ich dachte, an dem Tag kann ich nicht noch mehr vom Hocker gehauen werden." Dann meldete sich der Naturschutzverein Jordsand: Weiße, lebendige Kegelrobbe auf der Greifswalder Oie.

Wagemutige Robben nutzen Windparks als Lebensraum und orientieren sich an Unterwasser-Pipelines. Anscheinend sind die Tiere anpassungsfähiger als gedacht - doch was lockt sie überhaupt in die Anlagen?
Es ist ein Unterschied, ob eine bedrohte Tierart wie die Kegelrobbe nur regelmäßig vorbeischaut in einer Region oder ob sie sich dort auch fortpflanzt. Wenn der Nachweis da ist, dass eine Tierart heimisch ist, ist der Druck auf die örtliche Politik größer, sie nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU zu schützen. "Das bedeutet, das Land Mecklenburg-Vorpommern müsste jetzt vermehrt Maßnahmen ergreifen, um den Zustand dieser Population zu verbessern", sagt Henning von Nordheim, Leiter der Abteilung Meeresnaturschutz im Bundesamt für Naturschutz (BfN). Nordheims Arbeitsplatz ist seit 1992 die BfN-Außenstelle Insel Vilm vor der Südküste Rügens. Das Schicksal der Kegelrobben hat ihn dort immer besonders interessiert.
Als deutscher Vertreter in den Meeresschutz-Gremien der Ostsee-Anrainerstaaten hat er einst strenge Schutzregeln mitentwickelt, sodass sich der Bestand im Baltischen Meer von 5000 auf heute 30 000 Tiere erholen konnte; Verbote von Umweltgiften wie PCB oder DDT und von allgemeinen Jagdaktivitäten waren dabei wichtige Faktoren. Ab 2000 kamen Kegelrobben auch wieder in die deutsche Ostsee. Möglicherweise gab es auch Geburten, aber der Nachweis fehlte. Bis zum 8. März 2018. "25 Jahre lang habe ich auf diesen Zeitpunkt gewartet", sagt Henning von Nordheim.
Andere hätten auf den Zeitpunkt verzichten können, denn die Kegelrobbe hat nicht nur Freunde. Sie steht wie ein Symbol für das widersprüchliche Verhältnis des Menschen zum Wildtier. Einerseits will er es bestaunen als exotischen Zeugen einer intakten Natur. Andererseits soll es nicht in seine Jagdgründe eingreifen.
In der deutschen Nordsee ist die Kegelrobbe so etwas wie der Star der Tiere. Sie ist das größte deutsche Raubtier, Männchen werden bis zu zweieinhalb Meter lang und bis zu 300 Kilo schwer. Kegelrobben können im Schwimmen schlafen, haben ein ausdrucksstarkes Gesicht und sind nicht ängstlich. In den vergangenen 20 Jahren haben sie die Insel Helgoland als sicheren Lebensraum mit Nähe zum Menschen entdeckt - genauer gesagt Helgolands benachbartes Eiland Düne.
So viele Kegelrobben gibt es dort mittlerweile, dass sie Durchgänge versperren oder die Landebahn des Flugplatzes belegen. Aber keine Flüche sind zu hören. Der Robbentourismus blüht. Helgoland lebt gut davon, dass man den Kegelrobben hier so nahe kommen kann wie sonst nirgends auf der Welt.
"An der Ostsee ist die Situation völlig umgekehrt", sagt Henning von Nordheim. Die Jagd auf Robben gehört hier sozusagen zur Fischerei-Tradition. Um 1900, als die gesamte Ostsee noch von bis zu 100 000 Kegelrobben bevölkert war, lobte die preußische Regierung sogar eine Abschussprämie aus. Die Folge war, dass es im Süden des Binnenmeeres bald gar keine Kegelrobben mehr gab.
Heute beobachten viele Küstenfischer mit Argwohn, dass der Bestand sich erholt. Kegelrobben holen Fisch aus den Stellnetzen, sie machen diese auch mal kaputt. Gleichzeitig hören Fischer den Vorwurf, dass sich junge Kegelrobben tödlich in ihren Netzen verheddern. Dirk Lerche von der fischerfreundlichen Rechtspartei AfD sprach im Landtag von einem "nicht unerheblichen Konfliktpotenzial". Und für den Landesfischereiverband sagt Sprecher Thorsten Wichmann, erst nach zwei laufenden Forschungsprojekten solle man die Kegelrobbensituation bewerten.
Henning von Nordheim findet dagegen: "Ein Managementplan für die Robben in Mecklenburg-Vorpommern ist ganz dringend und ganz schnell erforderlich." Eine Robbenschutzgruppe aus Naturschutzverbänden, Behörden und Fischern habe schon viele Ideen. Zum Beispiel Entschädigungszahlungen für Fischer, die nachweisen, dass Kegelrobben Fang oder Material beschädigt haben.
Oder: Unterstützung für Fischer, die sich mit geeigneten Netzen am Kegelrobbenschutz beteiligen. Aber natürlich gehören zu den Empfehlungen auch Schutzzonen für Jungtiere, Beobachtungspunkte für Touristen mit Sicherheitsabstand. Und vor allem: Schulungen für Gemeindemitarbeiter, Feuerwehren und Polizei, damit sich nicht wiederholt, was das zweite gemeldete Kegelrobben-Junge auf Usedom vermutlich umgebracht hat.
Einsatzkräfte hatten zunächst vorbildlich den Strand abgesperrt. Aber dann trugen sie das weiße Wesen immer wieder ins Wasser, weil sie eine erwachsene Robbe, vermutlich die Mutter, im Wasser beobachtet hatten. Irgendwann kam es nicht mehr zurück. "Sie meinten was Gutes zu tun und haben es wahrscheinlich ertränkt", sagt Henning von Nordheim.
Wenige Wochen nach der Geburt haben die Tiere noch nicht die Speckschicht, die sie vor der Kälte des Wassers schützt. "Das weiße Fell saugt sich voll", sagt Linda Westphal, "sie schwimmen damit, als hätten sie einen dicken Strickpullover an." Sie ermüden und kühlen aus. Deshalb muss man auch einsame Kegelrobben-Junge an Land lassen und sich darauf verlassen, dass das Muttertier zurückkommt.
Manche Wege der Kegelrobben sind unergründlich. Henning von Nordheim kann nicht lückenlos erklären, warum die Kegelrobben Helgoland bestürmen, aber nur zögerlich in die deutsche Ostsee zurückkehren. Wer weiß, vielleicht sagt ihnen ihr Instinkt, dass sie in Mecklenburg-Vorpommern nicht so willkommen sind. Auf Helgoland haben sie gelernt, dass die Menschen ihnen nichts tun und sie auch sonst keine bösen Überraschungen fürchten müssen. Die Steilküste von Rügen hingegen könnte sie abschrecken, weil sie den Blick verstellt auf das, was in der Ferne lauert. Und im nahen Wald gibt es Marder und Füchse, die für ein Neugeborenes eine Gefahr sind.
Gerade der Fund vom 8. März zeigt, dass Kegelrobbenmütter dem Strand dort aus gutem Grund misstrauen. Das tote Jungtier hatte Fraßspuren im Gesicht. Seine Geburt war eine Sensation für die Wissenschaft. Aber aus Kegelrobbensicht hat sie am falschen Ort stattgefunden.