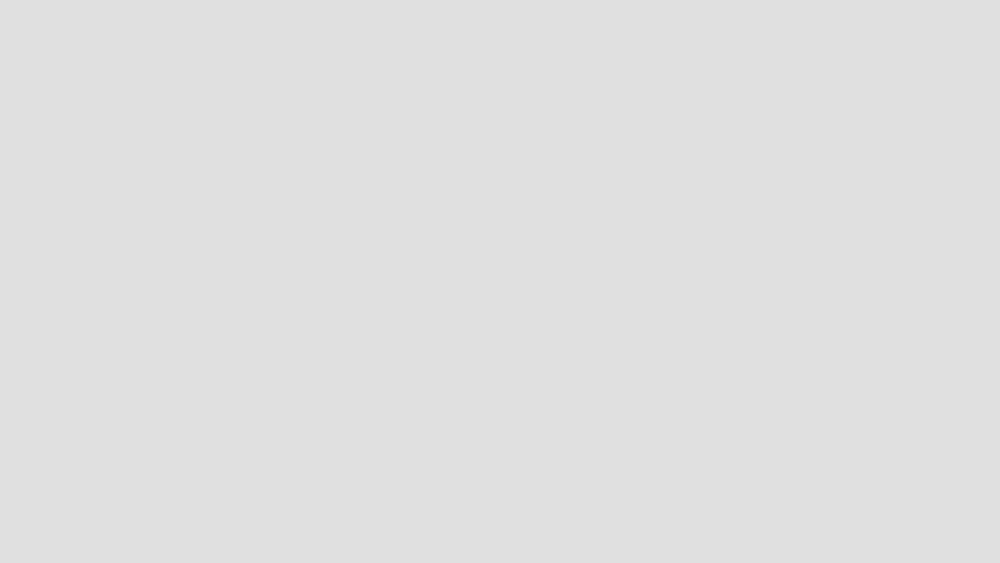Es klingt wie eine gute Nachricht für den Umweltschutz: Das Zeitalter der Kohle geht in Europa langsam zu Ende. In vielen großen Kraftwerken wird die Kohleverfeuerung eingestellt oder zurückgefahren. Das größte Kraftwerk Großbritanniens im nordenglischen Drax verbrennt Kohle nur noch in drei von ehemals sechs Kraftwerksblöcken; bald sollen es zwei sein. Aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Dänemark gibt es ähnliche Meldungen.
"Aus Sicht des Klimaschutzes und der Biodiversität ist es eine Schande", klagt dennoch Linde Zuidema von der Organisation Fern, die sich der europäischen Umweltpolitik widmet. Ihr Problem: Die Konzerne stellen die Kraftwerke nicht ab. Sie stellen um. Statt Kohle verbrennen sie jetzt Holz. Im südfranzösischen Gardenne etwa rüstet der deutsche Stromkonzern Uniper gerade einen Kraftwerksblock von Kohle auf Biomasse um; bald sollen dort pro Jahr 850 000 Tonnen Holz verbrannt werden. Auch in Drax wurde kein Block stillgelegt, auch dort landet jetzt Holz im Brenner.
Aus Holz erzeugte Elektrizität gilt in der EU ausnahmslos als Ökostrom. Die Mitgliedstaaten zahlen dafür hohe Subventionen an die Energiekonzerne. Während Europa dadurch seine Klimabilanz aufbessert, werden irgendwo auf der Welt Bäume gefällt und Wälder gerodet. Ist dem Klima damit wirklich geholfen?
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Ihn zu verbrennen, ist prinzipiell eine gute Idee. Das frei werdende CO₂ wird in den nachwachsenden Bäumen wieder gebunden. Und wenn die Bedingungen passen, lässt sich damit pro Anbaufläche mehr Energie erzeugen als mit anderen Biomasse-Trägern wie Mais, der in Süddeutschland als Energiepflanze weit verbreitet ist. Meist geschieht die Holzverstromung in Form von Pellets, die aus Abfällen wie Sägespänen oder Schnittresten bestehen. Weit über hunderttausend Haushalte in Deutschland haben eine Holzpellet-Heizung im Keller stehen. Dagegen wenden auch Umweltschützer wie Linde Zuidema nichts ein. Aber je mehr Großkraftwerke auf Holzverbrennung umsteigen, desto weniger bleibt von der guten Idee übrig.
Zwischen 2009 und 2014 hat sich die Herstellung von Holzpellets in der EU fast verdoppelt, auf 13,1 Millionen Tonnen. Weil sich der Bedarf aus den eigenen Wäldern längst nicht mehr decken lässt, kaufen die EU-Länder immer mehr Holzpellets im Ausland. 2014 importierten sie nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat acht Millionen Tonnen, ein Plus von 364 Prozent gegenüber dem Jahr 2009.
Die Umwelt wird vor allem dann geschont, wenn nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugt wird
Auf die großen Linien der europäischen Klimapolitik haben sich die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam verständigt: Bis 2020 soll der CO₂-Ausstoß um 20 Prozent sinken und der Anteil der erneuerbaren Energien auf 20 Prozent steigen. Jedes Land entscheidet für sich, wie es die Ziele umsetzt. In Deutschland ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dabei ein wichtiger Baustein. Es subventioniert regenerativ erzeugten Strom großzügig. Für Biomasse-Kraftwerke gibt es die Förderung aber nur bis zu einer Leistung von 20 Megawatt. Dafür braucht es eine überschaubare Menge Holz, die sich im Idealfall aus den benachbarten Sägewerken zusammensammeln lässt. Das Verbrennen von Holz gilt vor allem dann als ökonomisch und ökologisch sinnvoll, wenn damit sowohl Strom als auch Wärme erzeugt werden. Diese Kraft-Wärme-Kopplung funktioniert ebenfalls am besten mit kleinen Anlagen.
In anderen EU-Staaten gibt es keine Einschränkung der Kraftwerksgröße. Der auf Holzpellets umgerüstete Block des Uniper-Kraftwerks in Südfrankreich hat beispielsweise eine Leistung von 150 Megawatt. Die Pellet-Industrie hat in den vergangenen Jahren eine Dimension erreicht, bei der sie ihre ökologischen Versprechen nicht mehr einhalten kann.
An den Anlagen selbst müssen Energie-Erzeuger nicht viel ändern, wenn sie von Kohle auf Holz umrüsten. "Der Aufwand hält sich in Grenzen", sagt Hartmut Spliethoff, Inhaber des Lehrstuhls für Energiesysteme an der Technischen Universität München. Die meisten großen Kohlekraftwerke würden mit einer Staubfeuerung funktionieren, die Kohle wird vor dem Verbrennen also zu feinem Staub gemahlen und dann in den Kessel geblasen. So entsteht ein feines Kohle-Luft-Gemisch, das besonders gut brennt. Für den Umstieg auf Holz brauche man andere Mühlen, so Spliethoff. An den Kesseln selbst müsse man dagegen nur wenig verändern.
Etwa die Hälfte der in die EU importierten Holzpellets kommt aus den USA. Vor allem in den südöstlichen Bundesstaaten eröffneten in den vergangenen Jahren viele Pellet-Fabriken. Dort regt sich unter Wissenschaftlern und Umweltschützern inzwischen Widerstand gegen das Verheizen amerikanischen Holzes in Europas Kraftwerken. Reporter und Aktivisten berichten, dass eben nicht nur Abfälle in den Fabriken landen, sondern auch ganze Bäume, teilweise aus Kahlschlägen. "Jeden Morgen gehen Holzfäller-Teams entlang des Roanoke River in dicht bewaldetes Schwemmland, sie schlagen jeden Baum und jeden Strauch. Dutzende Lastwagen fahren täglich frisch geschnittene Eichen und Pappeln zu einer nahe gelegenen Fabrik, wo das Holz in kleine Pellets umgewandelt wird, um als Brennstoff in europäischen Kraftwerken eingesetzt zu werden", schreibt die Washington Post. Die Zeitung veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Holzlaster auf ein Fabrikgelände von Enviva einbiegen. Enviva ist der weltweit größte Hersteller von Holzpellets; der Konzern beliefert unter anderem das Kraftwerk im englischen Drax. Auch die Umweltaktivistin Sini Eräjää von der Organisation Birdlife sagt, sie hätte auf einer Reise in die USA mit eigenen Augen gesehen, wie ganze Baumstämme in einer Enviva-Fabrik gelandet seien.
Industrie und Politik verweisen darauf, dass die Waldfläche in den USA in den vergangenen Jahren sogar gewachsen sei. Enviva sagt, das Unternehmen betreibe nachhaltige Forstwirtschaft. Das sei zertifiziert, externe Gutachter würden die komplette Verarbeitungskette mindestens einmal jährlich untersuchen. Ganze Bäume verarbeite man nur, wenn es für diese keine andere Verwendung gäbe, etwa weil sie zu krumm gewachsen seien; oder sie ohnehin gefällt werden müssten, um anderen Bäumen Platz zu geben. Tatsächlich kommen mehrere Studien zu dem Ergebnis, dass eine höhere Nachfrage nach Holz zu einer Zunahme der Waldfläche führt. Die Nachfrage führe zu steigenden Preisen, wodurch mehr Bäume gepflanzt und weniger Wälder beispielsweise in Acker umgewandelt würden. Kritiker wenden ein, dass es sich bei den zusätzlichen Flächen häufig um schnell wachsende Plantagen mit wenig Artenvielfalt handle.
Holz verursacht sogar mehr Treibhausgas. Doch wenn es nachwächst, dreht sich die Bilanz
Unterm Strich ist eine ökologische Bewertung der Holz-Energie schwierig und von sehr vielen Faktoren abhängig: Woher kommt das Holz? Werden Reststoffe verarbeitet oder ganze Bäume? Schnellwachsende Plantagen oder wertvoller Urwaldbestand? Welche Holzsorten landen in der Presse? Wie werden die Pellets hergestellt und gelagert?
Die Europäische Union macht es sich bei ihrem Urteil bisher ziemlich einfach, zumindest was den Klimaschutz angeht. In den EU-Statistiken gilt Strom aus Biomasse immer als CO₂-neutral. Dabei verursacht Holz im Brennkessel zunächst sogar mehr Treibhausgase als Kohle. Nur wenn man einkalkuliert, dass die Bäume nachwachsen und dabei wieder Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden, dreht sich die Bilanz.
"Biomasse pauschal als CO₂-neutral einzustufen, ist falsch", sagt der Forstingenieur Sebastian Rüter vom Thünen-Institut für Holzforschung. "Das trifft nur zu, wenn der Wald nachhaltig bewirtschaftet wird." Es müsse also nachgewiesen werden, dass den bewirtschafteten Wäldern nur maximal so viel Holz entnommen wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. So ein Nachweis sei in der EU nicht erforderlich.
Ohne Subventionen lohnt sich die Holzverstromung jedenfalls nicht. In den USA selbst spielt sie deshalb kaum eine Rolle. Im US-Kongress gibt es zwar Bestrebungen, Holzpellets als CO₂-neutral einzustufen. Doch in einem Brief an Abgeordnete haben 65 amerikanische Wissenschaftler gefordert, von dem Vorhaben abzusehen. Das Weiße Haus hat sich in einer Stellungnahme gegen die Gesetzesänderung ausgesprochen.
Einige EU-Länder setzen dagegen stark auf Biomasse, um ihre Klimaziele zu erreichen. Allein das britische Drax-Kraftwerk erhielt 2015 laut Financial Times 540 Millionen Euro an öffentlichen Zuschüssen. "Aus meiner Sicht ist das höchst fragwürdig", sagt Michael Beckmann, Professor für Energieverfahrenstechnik an der TU Dresden. "Holz ist in erster Linie ein Rohstoff, darüber hinaus ein minderwertiger Brennstoff, Pellets haben etwa den halben Heizwert von Steinkohle. Energiewirtschaftlich ist das nicht der klügste Weg."
Inzwischen kommen auch den Europäern Zweifel an ihrer Bioenergiepolitik. Das geht aus einer Studie im Auftrag der EU-Kommission hervor, die im August erschienen ist. Darin steht, man müsse davon ausgehen, dass die steigende Nachfrage nach Holzpellets dazu führt, dass im Südosten der USA Wälder in Plantagen umgewandelt werden. Ob und wie die EU-Politik deshalb geändert werden sollte, sagt der Bericht allerdings nicht.