Eine Bank, die ihre Kunden nur einmal im Jahr über den Finanzstatus informiert? Und dann auch nur über den Saldo, nicht aber über die einzelnen Abbuchungen und Überweisungen? Undenkbar. Beim Bezug von Energie dagegen ist das die Praxis: Haushalte erfahren nur alle zwölf Monate, wie viel Strom, Gas oder Fernwärme sie verbraucht haben.
Doch so wie der regelmäßige Blick auf die Kontoauszüge hilft, die Finanzen im Griff zu behalten, können detailliertere Informationen zum Energieverbrauch Haushalte motivieren, sparsamer mit Strom, Gas oder Fernwärme umzugehen. Das haben mehrere Studien ergeben. Die Daten zeigen zum Beispiel, dass der Stromverbrauch auch dann relativ hoch ist, wenn niemand zu Hause ist. Vielleicht ein Grund, beim Verlassen der Wohnung darauf zu achten, dass alle Lampen und Elektrogeräte ausgeschaltet sind. "Die Rückkoppelung des Verbrauchs an die Haushalte hat im Allgemeinen Auswirkungen auf das Verhalten der Bewohner", erklärt Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Allerdings, so schränkt er ein, müsse man dabei fragen, ob der Aufwand für das Erheben und Bereitstellen der Daten und der Nutzen im Verhältnis stehen.
Vor allem die Versorger profitieren. Sie können neue, flexible Tarife anbieten
Bei der Wärme sind differenzierte Informationen über den Verbrauch noch in weiter Ferne. Anders beim Strom: Von 1. Januar 2017 an erhält jeder Haushalt einen digitalen Stromzähler, und zwar dann, wenn das alte, analoge Gerät turnusgemäß ausgetauscht werden muss. Auch Neubauten werden mit der neuen Technik ausgestattet. Die digitalen Zähler liefern Verbrauchsdaten im Viertelstundentakt, die die Bewohner je nach Konfiguration über ein Display, Webportal oder eine App abrufen können. Wobei das Stromsparen bei der Einführung der modernen Messtechnik nicht im Vordergrund steht: Vor allem soll sie den Versorgern ermöglichen, flexible Tarife anzubieten. Wenn zum Beispiel die Windräder gerade auf Hochtouren laufen, könnten sie ihre Energie günstiger verkaufen als bei Flaute.
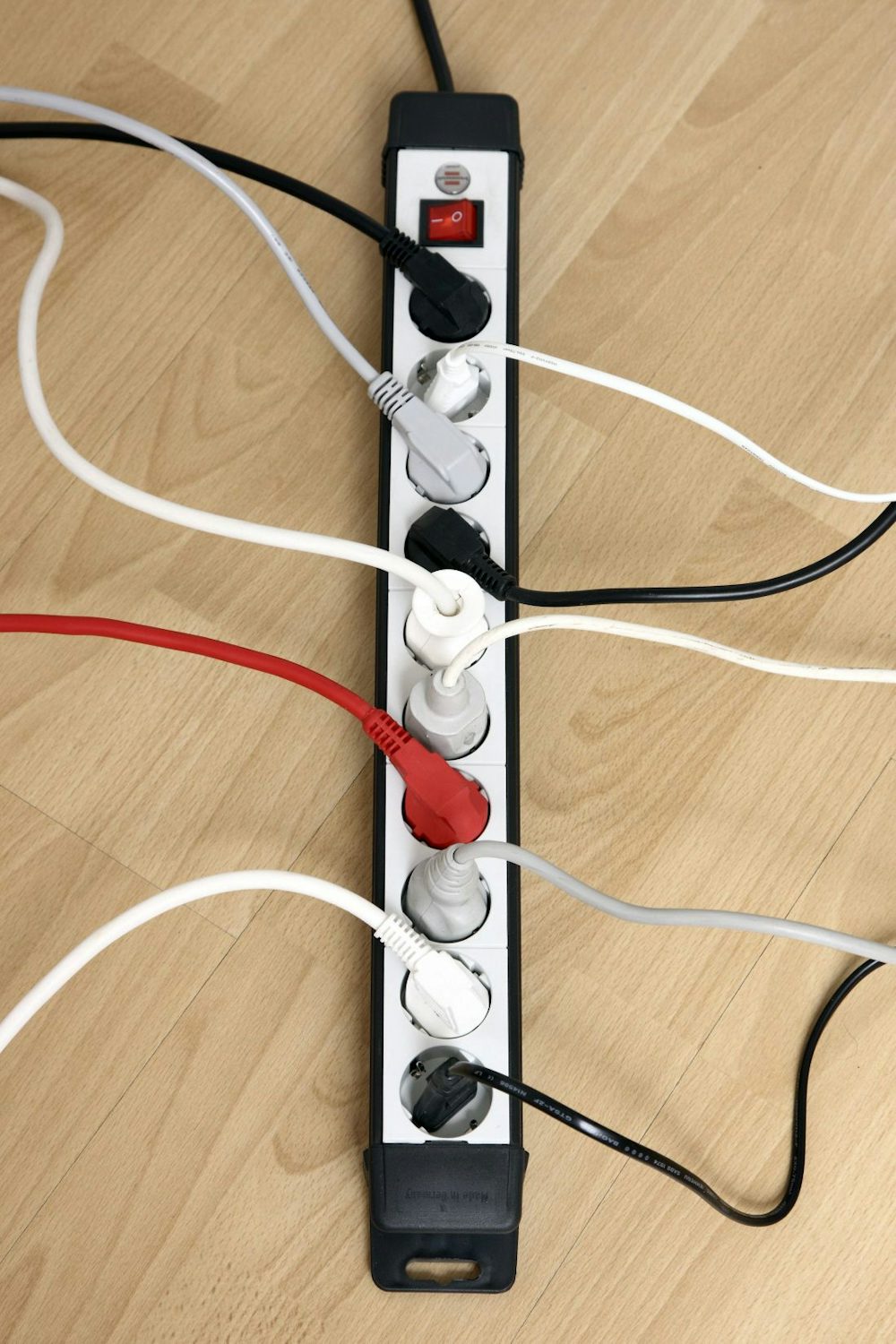
Von 2020 an müssen alle Haushalte mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden ein digitales Messsystem installieren. Neben dem Zähler umfasst es auch ein sogenanntes Gateway, das die Daten an das dafür zuständige Unternehmen überträgt. Doch auch wer weniger Strom bezieht, ist dann unter Umständen betroffen: Vermieter dürfen ihre Immobilien von 2020 an ohne Zustimmung der Mieter mit der neuen Technik ausrüsten. Auch Wohnungseigentümergemeinschaften können verpflichtend für alle Parteien den Umstieg beschließen. Zudem haben die Netzbetreiber das Recht, Haushalte in Eigenregie mit der neuen Technik auszustatten. Bereits ab Beginn des kommenden Jahres müssen Betreiber von Photovoltaik-anlagen mit mehr als sieben Kilowatt Leistung digitale Messsysteme installieren.
Während Haushalte für die alten, analogen Zähler kaum mehr als fünfzehn Euro im Jahr bezahlen müssen, sind die digitalen Systeme deutlich teurer. Dabei legt das Smart-Meter-Gesetz Obergrenzen fest. Bei einem für Vier-Personen-Haushalte typischen Jahresverbrauch zwischen 3000 und 4000 Kilowattstunden zum Beispiel dürfen die Kosten 40 Euro nicht überschreiten. Dazu kommen unter Umständen noch Gebühren für die Visualisierung der Daten.
Sind Stromkunden jedoch überhaupt in der Lage, ihren Energiebedarf so weit zu reduzieren, dass die Ausgaben für die neue Technik wieder hereinkommen? Nein, meint Aribert Peters. "Die Elektronik der Smart Meter ist viel zu aufwendig. Die Kosten sind weitaus höher als der Nutzen. Mir riecht das sehr nach Geschäftemacherei unter dem Deckmantel des Umweltschutzes." Auch Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sieht die Umstellung kritisch. "Die Kosten der digitalen Zähler werden die Einsparungen bei der Energie in der Regel deutlich übersteigen. Rein wirtschaftlich betrachtet ist die Einführung der Smart Meter für die meisten Haushalte daher von Nachteil", sagt Sieverding. Zwar gebe es für sie genug Ansatzpunkte zum Sparen - etwa den Austausch alter Kühlschränke. "Man braucht aber keinen Smart Meter, um zu wissen, dass ein 15 Jahre altes Gerät viel zu viel Energie benötigt", sagt er. Zudem bezweifelt er, ob die Bewohner überhaupt Lust haben, sich permanent mit ihrem Stromverbrauch zu beschäftigen.
Unternehmen wie Memodo, Smart Cost oder Smappee glauben das schon. Sie verkaufen Sensoren, mit denen Haushalte auch ohne Smart Meter ihren Energieverbrauch in Echtzeit überwachen können - und das heruntergebrochen auf die einzelnen Haushaltsgeräte. Der belgische Hersteller Smappee zum Beispiel nutzt dafür ein ähnliches Prinzip wie die Musikerkennungssoftware Shazam. "Der Verbrauch der elektrischen Geräte folgt typischen Mustern, die sich nach einer Lernphase zuverlässig identifizieren lassen", erläutert Firmengründer Stefan Grosjean. Der Sensor wird über eine Klemme im Sicherungskasten der Haushalte installiert. Ein Sendemodul überträgt die Daten dann per Wlan in eine App auf dem Computer oder Handy der Kunden. Neben dem Stromverbrauch zeigt das System auch die Kosten an. Die Kunden können dann auf den Cent genau erkennen, wie es sich auf ihre Stromrechnung auswirkt, wenn sie zum Beispiel nachts im Wohnzimmer das Licht brennen lassen.
"Unser System ist deutlich wirtschaftlicher als ein Smart Meter. Es amortisiert sich innerhalb von zwei Jahren", erklärt Grosjean. Bei einem Verkaufspreis von 229 Euro plus Installationskosten ist das allerdings eine recht optimistische Rechnung. Denn dafür müssten Haushalte ihren Jahresverbrauch um mindestens 400 Kilowattstunden reduzieren. Allein mit einer Änderung des Verbrauchsverhaltens lässt sich das kaum erreichen. Transparenz hat also auch hier ihren Preis.