Am Anfang war das Wort, ist immer das Wort. Aber nicht nur eines. Zehntausende von Worte, Tausende von Seiten umfassen Handelsverträge heute, und nur das ist wirklich neu. Das Instrument selbst ist alt, fast so alt wie das Bedürfnis der Menschen, Waren und Dienstleistungen zu handeln. Solche Verträge auszuhandeln, war schon immer ein mühsames Geschäft, denn es geht um Interessen, Macht, Geld, Wohlstand.
Das ist ein Job für Experten: Handelsspezialisten, Diplomaten, Politikprofis. Den letzten Haken muss, klar, der Souverän machen, früher der Herrscher, heute die Vertreter des Volks - aber der letzte Haken ist dann meist auch genau das: ein eher pauschales Votum über alles. So hat das Jahrhunderte lang funktioniert. Aber so funktioniert es nicht mehr. Das Volk begehrt auf, erstaunlicherweise vor allem in Deutschland, Österreich und einigen anderen, eher ausgewählten Ländern, in denen es eine Mehrheit gegen die aktuell geplanten Handelsabkommen gibt. Die Sachkritik im Konkreten, etwa von Gewerkschaften oder Umweltverbänden, trifft sich mit grundsätzlichem Misstrauen gegen eine weitere Globalisierung, gegen Einschränkungen der nationalen Souveränität.

Panama Papers, VW-Boni, Schlecker-Skandal - viele wollen es immer schon gewusst haben: Die Eliten sind gierig und enthemmt. Aber Wut alleine ändert nichts.
Wird die Welt nun schlechter oder besser, wenn man Grenzen öffnet?
So kommt es dann zu ungewöhnlichen Koalitionen von linken Attac-Aktivisten und rechten AfD-Vertretern. Sie alle eint das Misstrauen gegenüber "denen da oben". Man vertraut den Experten und auch den Politikern nicht mehr. Die einen gelten bei Bedarf als gekaufte oder naive Interessenvertreter des Großkapitals, die anderen als dumm und faul. Also muss man die Dinge selbst in die Hand nehmen und sich engagieren: gegen TTIP, das erst geplante europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen. Gegen Ceta, das bereits fertig ausgehandelte Abkommen mit Kanada. Gegen Tisa, das Abkommen über Dienstleistungen mit ausgewählten Industriestaaten.
TTIP, Ceta, Tisa: Zufällig werden die Handelsverträge, die so viel Ärger verursachen, überdurchschnittlich häufig mit vier Buchstaben abgekürzt: Eine dankbare Vorlage für die Gegner; kommt eben alles sehr ähnlich rüber. Ohnehin ist es eine hochprofessionelle Empörungsindustrie, die bereit steht, den Protest zu organisieren und zu orchestrieren. Sie hat gegenüber den Lobbyisten s der Wirtschaft deutlich aufgeholt. So viel Mobilisierung war selten, häufig durchaus auf hohem intellektuellem Niveau. Fragt sich nur, ob der Protest in seiner Rigorosität sinnvoll ist und der Druck, der dabei aufgebaut wird. Ist es wirklich hilfreich, wenn an diesem Samstag Zehntausende gegen die Vier-Buchstabenverträge auf die Straße gehen und den Eindruck vermitteln, Demokratie und Rechtssicherheit in Deutschland stünden kurz vor dem Ende? Manchmal tut die Selbstgerechtigkeit der Überzeugungstäter richtig weh.
Aber auch die andere Seite, um das gleich anzufügen, die Advokaten dieser Handelsverträge, vor allem Regierende und Wirtschaftsvertreter, sind von ihrer Position allzu sehr überzeugt. Auch sie sind manchmal bis zur Schmerzgrenze festgelegt, und vermutlich haben beide Seiten recht, wenn sie der jeweils anderen Arroganz, Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit vorwerfen. Unvergessen das abschätzige Wort eines früheren EU-Handelskommissars, der eine Petition von 470 000 EU-Bürgern mit den Worten kommentierte, das sei nett, aber er spreche für 500 Millionen Europäer.
Worum es in der Sache geht: Die einen sind für die Verträge, weil sie den Handel fördern und damit Wirtschaft ankurbeln, Produktion und Jobs schaffen sollen, Wachstum generieren, Wohlstand mehren. Die anderen sehen den Ausverkauf des eigenen Rechts- und Sozialsystems zugunsten des Profits internationaler Konzerne, aber es gibt viele weitere Argumente auf beiden Seiten. Sagen wir kurz: Die einen glauben, dass die Welt durch die internationalen Handelsverträge, die derzeit verhandelt werden, in der Summe besser wird. Die anderen glauben, dass sie schlechter wird. Wer also hat recht?
Der Autor dieser Zeilen könnte jetzt einen flammenden Appell für mehr wirtschaftlichen Freihandel folgen lassen. Er ist überzeugt davon, dass weniger Handelsbarrieren und mehr Globalisierung die Welt in der Summe angenehmer und sicherer machen und dass dabei auch, horribile dictu, viele Standards harmonisiert werden sollten. Freilich nicht in alle und nicht jene in für eine der beiden Seiten sensiblen Bereichen. Das kann man gut begründen - nur leider häufig auch das Gegenteil. Und vor allem: Was hilft es weiter, wenn denn so viele wohlmeinende Menschen so grundsätzlich zweifeln?

Exklusiv
Abstriche beim Verbraucherschutz, Schiedsgerichte für Konzerne: Vertrauliche Unterlagen zeigen, was USA und EU bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen wirklich fordern.
Am Ende heißt das Denkmuster: Bauchgefühl
Dazu einige Beispiele: Die allermeisten Ökonomen sehen erstens, die Vorteile internationalen Handels klar gegeben. Der möglichst unbeschränkte Austausch von Waren und Dienstleistungen nutzt langfristig allen Seiten, womöglich sogar jenen Mitspielern, die ihre Märkte selbst gar nicht liberalisieren. Allerdings: Das sind zunächst theoretische Überlegungen. Dann kommt es auf die konkreten Formulierungen an. Bei mehrtausendseitigen Verträgen keine leichte Sache. Und stehen die Ökonomen nicht spätestens seit der Finanzkrise unter Generalverdacht, die Welt nicht richtig zu verstehen und erklären zu können? Das stimmt so zwar nicht, und es entwertet auch nicht grundsätzlich ihre Argumente, aber es verhindert, dass sich Andersdenkende überzeugen lassen.
Zweitens fällt auf, dass Laien tendenziell gegen die Vier-Wörter-Verträge sind und Profis dafür. Politiker in der Opposition sind gerne dagegen, Politiker in Regierungsverantwortung dafür. Der arme Sigmar Gabriel muss das auch noch gleichzeitig, nicht sukzessiv aushalten: Als SPD-Parteivorsitzender führt er die faktisch oppositionelle Parteilinke, und gleichzeitig hat er als Bundeswirtschaftsminister Verantwortung; darüber kann man vermutlich fast verrückt werden. Ist Gabriel, der Minister, klüger, als Gabriel der Parteivorsitzende? Dafür spricht einiges, denn noch fast jeder schneidige Oppositionspolitiker hat im Amt dazugelernt. Aber auch das überzeugt nicht jeden, schon gar nicht jemanden, der glaubt, dass die Industrielobby jeden Minister oder Regierungschef ins ihnen passende Korsett zwängt.
Drittens wiederum kann man mit guten Gründen auf die bisherigen Erfolge von Handelsliberalisierungen verweisen. Das weltweite Wirtschaftswachstum ist seit dem zweiten Weltkrieg, seitdem die Märkte rund um den Globus systematisch geöffnet wurden, rasant gewachsen; viele Länder sind der Armut entkommen. Aber: Andere aber sitzen darin fest, und ihre Schätze werden von Staaten oder Konzernen ausgebeutet, die Freihandelsregeln profitzieren.
Man kann, viertens, vor allem bei dem noch längst nicht ausgehandelten TTIP-Abkommen über vieles diskutieren: Welche Errungenschaften des europäischen und deutschen Verbraucherschutzes wollen wir preisgeben, welche nicht? Was heißt das im konkreten Fall? Wie stellen wir sicher, dass sich ein Streitschlichtungssystem nicht der allgemeinen Gerichtsbarkeit entzieht? Aber auch dieser Hinweis fruchtet nichts, wenn die Kritiker überzeugt sind, dass hier ohnehin alle Mauern geschleift werden: wahlweise die europäischen (sagen die Deutschen) oder die amerikanischen (sagen die Amerikaner).
Am Ende landet man, ob man will oder nicht, bei einem Denkmuster, das man Vorverständnis nennen kann, Prinzipientreue oder schlicht: Bauchgefühl. Man vertraut den Experten und Politikern - oder eben nicht. Man will mehr internationale Offenheit - oder eben nicht. Man traut dem Markt etwas zu - oder eben nicht. Man will sich im Zweifel mehr Staat erhalten - oder im Gegenteil mehr Markt wagen. Die Grundannahme bestimmt den Blick aufs Thema und prägt den eigenen Standpunkt.
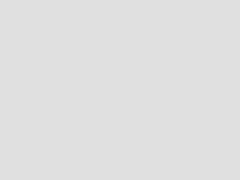
Reiche verschieben ihr Geld nach Panama. Normalbürger tricksen bei der Putzfrau. Gegen Steuerbetrug kann man nichts machen? Falsch! Der Staat muss für Ehrlichkeit sorgen und bei den Reichen anfangen.
Ein Vertrag in Etappen
Sehr schön lässt sich das an zwei streitbaren älteren Herrschaften zeigen, die man eigentlich für Herzensbrüder hielt: Peter Gauweiler und Joachim Starbatty. Der Renegat in der CSU, der sein Bundestagsmandat 2015 zurückgegeben hat, und der marx-bärtige Wirtschaftsprofessor aus Tübingen sind sich in der Ablehnung der Merkelschen Euro-Rettungspolitik einig, sie sind gemeinsam bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um einen Ausverkauf Deutschlands am Parlament vorbei, so sehen sie das, zu verhindern. Nun schwant Gauweiler auch bei TTIP und Ceta das Schlimmste: Es bestehe "die Gefahr, den Zusammenhang von Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Demokratie zu zerstören." Starbatty dagegen, Europa-Abgeordneter früher der AfD, jetzt von Alfa, kommt zu dem Schluss, man könne dem TTIP-Verhandlungsteam ruhig vertrauen, und, mehr noch: "TTIP ist die beste Medizin, der schwächelnden EU wieder auf die Beine zu helfen."
Wer diese Gegensätze ohne Machtworte und Brachialmaßnahmen auflösen will, die dauerhaft Schaden anrichten, der muss vom inhaltlichen auf den formalen Weg ausweichen. Die Lösung der Interessengegensätze, der Friedensschluss im Glaubenskrieg könnte über zwei prozedurale Stellschrauben funktionieren: Größtmögliche Transparenz: Wenn das Misstrauen so groß ist wie beschrieben, muss alles offengelegt werden. Muss die verhandlungsführende Kommission sich mehr als bisher mit den Mitgliedstaaten rückkoppeln, müssen die nationalen und die europäischen Parlamentarier mehr einbezogen werden als bisher.
Ein Vertrag in Etappen: Es empfiehlt sich, das TTIP-Abkommen aufzuspalten und in Stufen zu verhandeln und zu beschließen. Erst die Zollsenkungen und andere Maßnahmen, die weitgehend unstrittig sind, dann erst, in späteren Jahren und übrigens auch erst im Gespräch mit einer neugewählten US-Administration, die "heißen Eisen". Vielleicht gelingt es sogar, im Laufe der Zeit die gute alte Welthandelsorganisation zu reaktivieren, die im diplomatischen Wachkoma liegt. Die WTO hat nämlich, bei allen Schwächen, einige Prinzipien, die die Macht der großen Handelsnationen begrenzen und Verträge zulasten Dritter verhindern sollen: ein ausgefeiltes Regelwerk, ein faires Streitschlichtungsverfahren und das Prinzip "Ein Land, eine Stimme". Und nebenbei bemerkt: Ihr Kürzel hat nicht vier, sondern nur drei Buchstaben. Das wäre doch mal ein gutes Omen.

