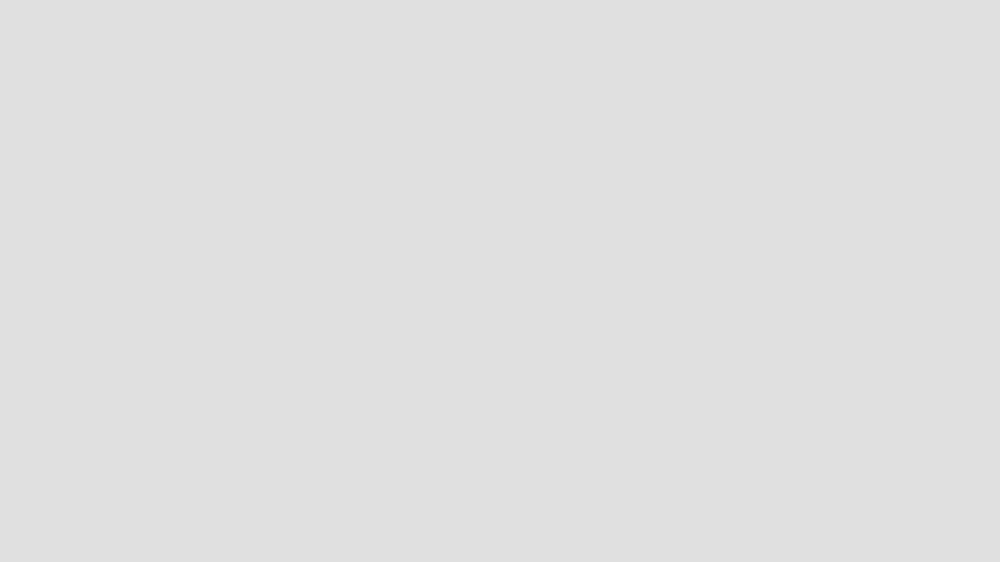Es war im Jahr 1988, da konzipierte eine Expertengruppe um den damaligen Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl die Struktur der künftigen Europäischen Zentralbank (EZB). Unabhängig müsse sie sein, nur der Preisstabilität verpflichtet - und keinesfalls den Regierungen als Krücke zur Geldbeschaffung dienen.
Pöhl wusste, dass die Mitgliedstaaten der künftigen Eurozone harte Jahre vor sich haben würden: Sparmaßnahmen, Marktliberalisierung und die Stabilisierung der eigenen Währung.
Frankreich passte dieser Zwang zur Disziplin nicht. Man plädierte für einen Europäischen Reservefonds. Das Geld sollte eingesetzt werden, um den Franc während der Übergangsphase im Notfall zu stützen. Pöhl blieb hart. Er fürchtete, dass so der Anpassungsdruck auf die Schuldnerländer geschwächt werde, "ihr Haus in Ordnung zu bringen". Pöhl und die Bundesbank konnten ihre Ablehnung durchsetzen.
Neue Machtverhältnisse
Der amtierende Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat diese Episode erzählt, im Rahmen der Gedenkfeier der Bundesbank für Pöhl, der im Dezember 2014 im Alter von 85 Jahren gestorben war. Weidmann, der Pöhl sehr schätzte, schlug in seiner Rede den Bogen zu heute. "Jetzt befinden wir uns mitten in einer europäischen Schuldenkrise und an den Argumenten auf beiden Seiten hat sich wenig geändert."
Die Gemütslage heute mag viel Ähnlichkeit mit der von damals haben, doch die Machtverhältnisse sind anders. Für die Bundesbank ist es heute sehr viel schwerer, ihre Überzeugungen durchzusetzen. Dieser Umstand dürfte am Donnerstag besonders deutlich werden, wenn die EZB den Beschluss fasst, Staatsanleihen der Eurozone zu kaufen. Diese Entscheidung gilt als wahrscheinlich. EZB-Präsident Mario Draghi möchte einer gefährlichen Deflation vorbeugen. Weidmann und einige wenige andere der insgesamt 25 Kollegen im EZB-Rat sind dagegen. Ihr Argument: Italien und andere Staaten können sich durch die EZB-Aktion noch billiger Geld leihen, was die Spar- und Reformneigung der Regierungen dämpfe.

Die Europäische Zentralbank nutzt ihre Unabhängigkeit anders, als die Deutschen sich das vorgestellt haben. Doch was darf die Bank, die mit ihren Entscheidungen das Leben der Bürger so extrem beeinflussen kann?
Auch Bundeskanzerlin Angela Merkel sorgt sich um die politische Wirkung einer solchen Maßnahme. "Der Druck auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa muss erhalten bleiben, sonst wird gar nichts, aber auch gar nichts uns helfen", sagte sie am Montagabend beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse.
Problem begann mit Finanz- und Schuldenkrise
Weidmann hat einmal gesagt, die Bundesbank sei die größte und wichtigste Notenbank im Euro-System. Das mag stimmen. Doch ihre Macht im Europäischen Verbund ist im Zuge der Finanzkrise geschrumpft. Natürlich wurde dieser Machtverlust schon mit der Aufgabe der D-Mark ab 1999 offenkundig. Damals nahm die EZB ihre Arbeit auf. Dieser politische Federstrich zur Gründung der Europäischen Währungsunion war ein "Kulturschock" für die Bundesbank, wie sich einer, der damals dabei war, erinnert. Plötzlich sollte man in der EZB nur noch "eine von vielen" sein. Die Bundesbanker wollten ihre eine Stimme dazu nutzen, um im EZB-Rat das althergebrachte Stabilitätsdenken der Bundesbank durchzusetzen. Die Philosophie der Bundesbank, so sahen es die Deutschen, sollte die Blaupause für die künftige Arbeit der EZB sein.
Vor der Finanzkrise funktionierte das noch: Nationale Egoismen wurden im Rat unterbunden, meist kamen sie gar nicht auf. Ganz im Gegenteil. Überliefert ist eine Episode aus der EZB-Präsidentschaft von Wim Duisenberg. Der EZB-Rat wollte den Leitzins für die Eurozone senken. Da meldete sich ein Notenbanker und sagte: "Für unser Land wäre es besser, den Leitzins zu erhöhen, aber da unser Gremium für die Geldpolitik im ganzen Euroraum zuständig ist, schließe ich mich der Entscheidung zur Zinssenkung an."
Solange es um klassische Geldpolitik ging, also um die Frage Leitzinssenkung ja oder nein, war der Dissens überschaubar. Das Problem begann mit dem Ausbruch der globalen Finanzkrise und der folgenden Euro-Schuldenkrise: Die EZB traf Entscheidungen, die nationale Bankensysteme begünstigte und die Kreditaufnahme von Staaten erleichterte. Das oberste Gremium der EZB wirkt seit 2009 politisiert. Die Bundesbank verlor in diesem Prozess die Richtlinienkompetenz, sie versuchte fortan, "das Schlimmste" zu verhindern.
Hoffnung für Draghi: Die Europäische Zentralbank könnte Kredite von Euro-Staaten aufkaufen - allerdings unter bestimmten Bedingungen. Dafür plädiert der einflussreiche Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs.
Axel Weber, der Vorgänger von Weidmann als Bundesbankchef, trat 2011 aus Protest zurück. Jürgen Stark, der damalige Chefvolkswirt der EZB, folgte wenige Monate später. Weidmann geht in den Clinch und weiß viele Deutsche hinter sich. Doch bei den ganz großen Entscheidungen macht Draghi mit einer komfortablen Mehrheit das, was er für richtig hält.
"Jens Weidmann ist dazu verurteilt, Stabilität zu predigen. Die Bundesbank wird immer mit einem erhobenen Zeigefinger auftreten. Europa braucht eine solche Bundesbank auch, als letzte Instanz", sagt David Marsh, der die Geschichte der Bundesbank seit Jahrzehnten verfolgt. "Die alte Bundesbank ist nicht mehr da. Die Mitarbeiter von heute haben keine nostalgischen Gefühle, das ist eine neue Generation. Aber der Geist ist nicht erloschen", sagt der frühere britische Journalist.
Die Bundesbank ist ein Mythos. In der Erinnerung vieler Deutscher steht die Institution bis heute für die Stabilität der D-Mark. Deutschland entwickelte sich von den 1950er Jahren an international zum wirtschaftlichen Riesen und blieb doch politisch ein Zwerg. Die Deutschen mögen im Ausland unbeliebt gewesen sein, doch die D-Mark war begehrt. Das gab Selbstvertrauen. "Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle an die Bundesbank", sagte Jacques Delors, Präsident der Europäischen Kommission, im Jahr 1992.

Der schwache Euro ist nicht unbedingt schlecht für Deutschland. Selbst die EZB fördert die Entwicklung. Gerade den kriselnden Euro-Ländern könnte der schwache Euro helfen. Für ein Ende der Krise ist aber mehr nötig.
Die Bundesbank steht nicht allein da mit ihrer Angst vor Bedeutungsverlust. Alle Nationalbanken kämpfen um ihre Pfründe. Viele Aufgaben, die früher jede nationale Bank vorgehalten hat, werden nun in Schwerpunkten gebündelt, dann übernimmt eine Notenbank die Arbeit aller. Und wer was machen darf, darüber wird hinter den Kulissen eisern gekämpft.
EZB hat die Hosen an
Als der französische Notenbankchef Christian Noyer im vergangenen Herbst gegen die EZB-Entscheidung votiert hat, Kreditverbriefungen (ABS-Papiere) zu kaufen, so tat er das nicht aus Prinzip. "Er hatte kein Problem mit dem ABS-Programm als solches, aber er wollte nicht, dass die EZB das zentral macht, sondern dass die Franzosen es umsetzen dürfen", sagt jemand, der in der Sitzung dabei war.
Die EZB hat auch auf dem Feld der Bankenaufsicht nun die Hosen an. Sie überwacht die wichtigsten Institute Europas. Das hatte auch Konsequenzen für die Bundesbank. Im Tagesgeschäft mit der EZB besitzt die Finanzaufsicht Bafin die Oberhoheit. Das hat der Bundestag so beschlossen. Bundesbank und Bafin sind nicht mehr gleichberechtigt.
"Weidmann ist beleidigt, dass die Bundesbank jetzt nur mehr die zweite Geige in der Bankenaufsicht spielt", sagt einer, der ihn gut kennt. Bundesbankvorstand Andreas Dombret fragte selbst jüngst öffentlich, "welche Rolle die Bundesbank eigentlich in der neuen Aufsichtsstruktur" einnehme und beklagte den Verlust von einem "Stück Einfluss" bei der Bankenaufsicht.
Bundesbank-Kenner Marsh bezeichnet das Verhältnis von Draghi und Weidmann als "Symbiose". Weidmann sei Draghis Gegenargument, wenn Politiker die Geldschleusen noch viel weiter öffnen wollten. "Wenn Draghi nüchtern darüber nachdenkt, sieht er, dass Weidmann mehr recht als unrecht hat."