Der Hirsch will nicht weichen. Stolz starrt er Adrian Ciurea an. Nur langsam trottet er mit erhobenem Geweih davon, als der Naturschützer aus seinem Geländewagen aussteigt. "Der hier fühlt sich wohl als Herr im Wald." Es scheint tatsächlich so zu sein, als fürchte er sich kaum vor dem Menschen. Ob er jemals einem Jäger begegnet ist?
Hier in den Făgăraș-Bergen, hoch über dem Dâmboviţa-Tal, fernab jeglicher Siedlung, mag der Mensch noch ein Fremdling im Revier der Rothirsche sein - oder besser: wieder. Seit acht Jahren ist das ehemalige Jagdgebiet ein streng überwachtes Naturreservat. Heute muss das Wild hier vor allem Wölfe fürchten, Luchse und Bären. Nirgendwo sonst in Mitteleuropa streifen so viele Großraubtiere umher. Nirgendwo haben sich so große Flächen mit Urwald erhalten wie in den Karpaten.
"Wir haben hier eine biologische Vielfalt bewahrt, die anderswo längst verschwunden ist", sagt Ciurea, "aber auch hier ist sie bedroht." Der 33-Jährige aus Zărnești arbeitet für die Fundaţia Conservation Carpathia (FCC). Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, in Transsilvanien den größten Wald-Nationalpark Europas zu schaffen. Zuvor war Ciurea Ranger im Piatra-Craiului-Nationalpark. Teile des im Deutschen Königsteingebirge genannten Höhenzugs der Südkarpaten stehen seit 1938 unter Naturschutz. Gemeinsam mit den angrenzenden Făgăraș- und Leaota-Bergen soll in Zukunft ein Schutzgebiet von mehr als 250 000 Hektar entstehen - mehr als zehnmal größer als der Nationalpark Bayerischer Wald. "Viele Leute sind uns gegenüber noch immer skeptisch", sagt Ciurea, "aber sie beginnen langsam zu verstehen, dass am Ende auch der Mensch vom Schutz der Natur profitiert."
Nicht weit von der Stelle, an der Ciurea auf den Rothirsch getroffen ist, besucht er einen Ranger in einem neuen Fotoversteck für Touristen. Die Bunea-Blockhütte liegt auf einem Bergrücken mit Blick auf eine kleine Lichtung über dem Dâmboviţa-Tal und den dicht bewaldeten Hängen des Făgăraș-Massivs als Kulisse. So weit das Auge reicht: nichts als Wildnis. Früher gehörte für Naturfotografen in den Karpaten eine gehörige Portion Glück dazu, um jemals ein Foto von einem Braunbär zu schießen. Die Bunea-Hütte bietet nun beste Chancen und ist sehr komfortabel: Sie hat nicht nur einen Holzofen, sechs Betten und sogar eine Dusche - hier bekochen die Ranger ihre Gäste, und zum Abendessen vor dem Auftritt der Bären gibt es Rotwein. Vor den großen Fenstern finden sich in der Dämmerung Dutzende verschiedene Tierarten ein: neben den Braunbären auch Rehe, Rothirsche, Wildschweine, Füchse, Marder und etliche Vogelarten. Hin und wieder tauchen sogar Wölfe auf oder ihr Heulen ist zu hören.
Die Touristen wähnen sich in dieser einsamen Bergwelt in einem vom Menschen unangetasteten Naturparadies. Doch weniger als eine halbe Stunde auf abenteuerlichen Schlammpisten entfernt geben Nebelschwaden den Blick auf ein völlig anderes Panorama frei. Als hätte eine Lawine den Hang überrollt, klafft inmitten des Waldes eine kahl geschlagene Bergflanke. Einsame, zurückgebliebene Baumstümpfe in der gigantischen Lichtung lassen erahnen, dass hier vor Kurzem noch ein uralter Wald gestanden haben muss.
Andernorts geht der Kahlschlag weiter
In den 2000er-Jahren wurden mehrere Tausend Quadratkilometer Land aus Staatsbesitz an die Bevölkerung zurückgegeben. Viele der neuen Waldbesitzer hatten jedoch nur wenig Bezug zu ihrem Eigentum. So kauften Holzhändler ihnen für wenig Geld riesige Flächen ab und ließen sie roden. Eine regelrechte Mafia entwickelte sich und verkaufte - gedeckt durch korrupte Politiker - das Holz an inländische Holzeinschlagunternehmen und ausländische Konzerne. Umweltschützer erheben seit Jahren Vorwürfe gegen die österreichischen Unternehmen Kronospan und Schweighofer, die bestreiten, in illegale Holzgeschäfte verwickelt zu sein.
"Die Holzfäller machten selbst vor den Schutzgebieten keinen Halt", sagt Ciurea, "so gingen innerhalb weniger Jahre riesige Flächen wertvoller Waldbiotope verloren." Abertausende Hektar Wald wurden vor allem zwischen 2005 und 2010 in den Karpaten illegal gerodet. Niemand kennt die genauen Zahlen. Laut der Naturschutzstiftung Euro Natur soll von den mehr als 200 000 Hektar unberührter Wälder, die im Jahr 2004 kartiert wurden, gerade noch die Hälfte intakt sein. Die FCC konnte den Holzeinschlag in dem von ihnen kontrollierten Teil der Făgăraș-Berge inzwischen weitgehend aufhalten. Andernorts geht der Kahlschlag weiter. Die staatlichen Kontrollen funktionieren oft nicht, die Verantwortlichen sehen weg oder sind selbst an dem Geschäft beteiligt. Ob andauernde Proteste von Umweltschützern, wie etwa die gegen ein gigantisches Straßenbauprojekt im Unesco-Welterbe Domogled-Valea Cernei im Südwesten Rumäniens, etwas ausrichten können, bleibt unklar.
"Wir waren schockiert, dass kein Mensch etwas unternommen hat", sagt Christoph Promberger über die Situation in den Făgăraș-Bergen. "Alle haben weggeschaut, während selbst im Nationalpark Flächen gerodet wurden." Der deutsche Forstwissenschaftler und Wildbiologe hat 2009 gemeinsam mit seiner Frau Barbara die FCC gegründet. Von ihrem Reiterhof in Șinca Nouă jenseits der Zweitausender blickt man auf die Ausläufer der Făgăraș-Berge - auf blühende Wiesen vor Waldhängen. Der künftige Nationalpark würde sich bis fast vor ihre Haustür ausdehnen. 1993 kam Promberger aus München nach Rumänien, um über die Großraubtiere der Karpaten zu forschen. Hier lernte er Barbara Fürpaß kennen, die ihre Diplomarbeit über Wölfe schrieb. Sie entschieden, in Rumänien zu bleiben und gründeten nach dem Abschluss ihrer Forschungen den Öko-Reiterhof Equus Silvania.
Einer glücklichen Fügung verdanken es die Prombergers, dass sie unverhofft zu Begründern eines riesigen Schutzgebiets wurden. Sie erzählten einem Gast, der Schweizerin Hedi Wyss, von dem dramatischen Kahlschlag in den Karpaten. Die einzige Möglichkeit, die Wälder zu retten, sahen sie darin, sie für den Naturschutz aufzukaufen. Wyss bat ihren Bruder um Hilfe. Die Stiftung des Mäzens Hansjörg Wyss fördert weltweit Naturschutzprojekte. Die Prombergers luden ihn nach Rumänien ein. Der Milliardär war begeistert - und hatte gleich größere Pläne: am besten das gesamte Făgăraș-Gebirge mit den höchsten Gipfeln Rumäniens sollte zum Schutzgebiet werden. Inzwischen haben sich um die Prombergers viele bekannte Umweltschützer geschart. Unterstützt werden sie von Unternehmern wie dem langjährigen Vorsitzenden von Outdoor-Bekleidungs-Hersteller Jack Wolfskin, Manfred Hell, und dem dänischen Mode-Milliardär Anders Povlsen. Bis heute wurden mehr als 23 000 Hektar Land gekauft. Die Ranger der Stiftung überwachen weitere 30 000 Hektar. Einige Quadratkilometer, die bereits abgeholzt worden waren, wurden wieder aufgeforstet. In Rumänien soll, so hoffen die Umweltschützer, einmal ein europäisches Yellowstone entstehen.
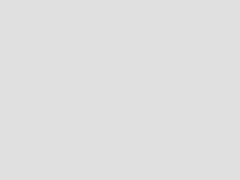
Die Nationalparks in den USA sollen die Natur bewahren. Das ist nicht leicht unter einem Präsidenten, der sich über den Klimawandel lustig macht.
"Yellowstone ist ein Symbol, eine Ikone", sagt Promberger. "Amerika und Afrika haben solche Nationalparks, die wirklich jeder kennt. In Europa sticht jedoch keiner heraus. In zwei oder drei Jahren ist das nicht zu schaffen", sagt Promberger, "aber vielleicht in 20."
Ein Ausflug in das Stramba-Tal, nicht weit vom Hof der Prombergers gelegen, gibt einen Eindruck von der einzigartigen biologischen Vielfalt, die der zukünftige Park bewahren soll. Durch das von Mischwald gerahmte Wiesental plätschert ein Bach. Perlmuttfalter und Blauflügel-Prachtlibellen fliegen entlang der Ufer. Seltene Pflanzen wie Lichtnelken und Knabenkraut wachsen hier, das dumpfe Quaken der Gelbbauchunken und das knarrende Rufen des in Westeuropa bedrohten Wachtelkönigs sind zu hören.
Herrmann Kurmes sucht mit seinem Fernglas den Waldrand nach seltenen Vögeln ab. Der Siebenbürger Sachse aus dem nahen Vulcan - auf Deutsch: Wolkendorf - hat im Stramba-Tal unzählige Male nach besonderen Arten Ausschau gehalten. "Wenn wir Glück haben, erwischen wir auch einen Schreiadler oder Neuntöter", sagt er. Kurmes war einer der Initiatoren der rumänischen Vereinigung für Ökotourismus und ein Pionier für Naturreisen in den Karpaten. Wiedehopf, Wespenbussard, Habichtskauz - in Mitteleuropa allesamt längst selten gewordene Vogelarten - hier lassen sie sich häufig blicken.
Die meisten Touristen jedoch kommen wegen der Braunbären. Am Ende des Tals, wo der Wald immer näher an das Flüsschen rückt und es schließlich fast ganz verschluckt, werden die Tiere regelmäßig gesehen. "Am Anfang sagten die Leute: Ihr seid verrückt!", erzählt Kurmes und lacht. Als er Ende der Neunzigerjahre gemeinsam mit seiner deutschen Frau Katharina, die er als Biologiestudent in Göttingen kennengelernt hatte, begann, Wanderungen auf den Spuren der Wölfe, Bären und Luchse anzubieten, glaubten sie selbst noch nicht so richtig an den Erfolg. Es waren die Prombergers, die sie dazu motivierten.
"Der Wolf gilt für viele hier noch immer als Hauptfeind des Menschen. Bären waren in der Ceaușescu-Zeit die größten Devisenbringer durch die Trophäenjagd", sagt Kurmes. "Das macht es schwer, einem Schäfer oder Jäger den Nutzen von Ökotourismus zu erklären." Aus der Idee wurde trotzdem ein Erfolgskonzept. Inzwischen locken die Großraubtiere eine schnell wachsende Zahl von Touristen in die Karpaten. "Irgendwann haben die Leute verstanden: Zum Bergwandern können die Touristen auch nach Österreich oder in die Schweiz", sagt Kurmes, "die Chance, Wölfe oder Bären zu beobachten, haben sie jedoch nur hier."

Im Stramba-Tal hat die Dämmerung eingesetzt. Kurmes folgt einem Ranger durch das Halbdunkel des Waldes. Vor einer Lichtung steigt er auf einen speziell für die Tierbeobachtung gebauten Hochstand. Hier haben mehr als zehn Touristen Platz, doch an diesem Abend ist nur ein französisches Paar gekommen. Mit dem Fernglas verfolgen sie einen Fuchs, der sich von den ausgelegten Schlachtabfällen die ersten Happen holt. Bald taucht tatsächlich ein Bär auf und macht sich über eine Schweinehälfte her. Ihm folgen acht weitere, darunter auch eine Mutter mit ihrem Jungen. Zeitweise sind sechs Bären gleichzeitig auf der Lichtung.
"Ich bin ein wenig reserviert gegenüber diesen Fütterungen", sagt Christoph Promberger am Tag danach auf seinem Hof. "Natürlich wollen die Touristen die Bären sehen. Aber müssen sie unbedingt mit Süßigkeiten und Keksen gelockt werden? Wir wollen, dass die Leute Wildnis erleben. Das da geht aber schon in Richtung Zoo." Er nennt den Bärenhochstand im Stramba-Tal ein "Opfergebiet" - ein Ort, nach dem die Touristen verlangen, ohne deren Geld kaum noch ein Nationalpark auskommt. Naturschutz und Tourismus bilden eine Zweckgemeinschaft. "So wie der Old-Faithful-Geysir in Yellowstone, an dem sich die meisten Besucher drängen. Wenn 95 oder 99 Prozent des übrigen Parks Wildnis sind, kann ich mit solchen Orten leben", sagt Promberger.
Im Oktober soll das Carpathia-Schutzgebiet Yellowstone noch ähnlicher werden. Während dort Bisons Touristen anlocken, sollen in den Făgăraș-Bergen bald wieder ihre eurasischen Verwandten durch die Wälder streifen: Wisente. Die zotteligen Urrinder waren in Rumänien im 19. Jahrhundert ausgestorben. "In den nächsten fünf Jahren sollen 75 Tiere in die Wildnis zurückkehren", sagt Promberger. Dass sich, wie in Yellowstone, irgendwann einmal Autoschlangen um Wildrinder und Bären bilden, fürchtet Promberger allerdings nicht. "Wir werden einen langen Atem brauchen. Aber die Făgăraș-Berge werden eine echte Wildnis bleiben."

