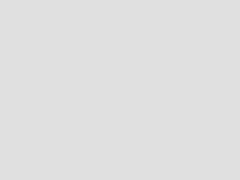Amerikas Zukunft beginnt gleich hinter Disneyworld. Kissimmee ist keine Märchenwelt, in dem Vorort von Orlando blinken nur die Schilder der Imbiss-Läden und Tätowierstudios.
Hier im Osten Floridas lässt sich bereits erleben, wie sich die USA verändern: In der Cafeteria des örtlichen Sedano's, der Supermarktkette einer kubanischen Familie, hallen spanischen Wortfetzen durch den Raum. Hier treffen sich die legalen und illegalen Einwanderer, die in den USA Geborenen und die hierher Geflohenen. Sie, ihre Eltern oder Großeltern kommen aus Kuba, Nicaragua, Mexiko, El Salvador - oder Puerto Rico, so wie Victor.
Er kam 1992 nach Kissimmee. Seitdem hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt, die Stadt ist mittlerweile auf 60 000 Einwohner angewachsen. Jeder zweite Bewohner ist ein Latino."Ich kann mich noch daran erinnern, als es hier in der Gegend nur eine einzige große Straße gab", erzählt Victor, während sich draußen die Autos im dichten Verkehr beinahe stapeln.
Kissimmee liegt nahe der Autobahn "Interstate 4", jenem Korridor zwischen Tampa und Orlando, in dem fast die Hälfte der registrierten Wähler Floridas wohnt. Die Gegend wird bei den Vorwahlen der Republikaner am Dienstag, aber auch in der Präsidentschaftswahl maßgeblich darüber entscheiden, welche Partei das Weiße Haus übernimmt. "Niemand kann Präsident werden, ohne hier zu gewinnen", sagt die Politologin Susan MacManus. Barack Obama konnte den Wechselwählerstaat Florida zwei Mal für sich verbuchen, weil er acht von zehn Latinos hinter sich versammelte.
Große Armut, viel Kriminalität
Für Victor aus Kissimmee ist der Wahlkampf das letzte, was ihn interessiert. "Hier gibt es nicht genug Jobs", klagt der 24-Jährige, der sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser hält. "Was sind schon neun Dollar Lohn in der Stunde? Nichts!" Die begehrten Stellen im Dienstleistungssektor rund um die Freizeitparks reichen nicht, und nur wenige Puerto Ricaner möchten weiter westlich auf den Feldern arbeiten, wo die Einwanderer aus Mittelamerika schuften. Latino ist nicht gleich Latino, Kultur und Perspektiven unterscheiden sich je nach Herkunftsland.
Schätzungen zufolge leben inzwischen mehr als fünf Millionen Puerto Ricaner in den USA, weil die Insel von Wirtschaftskrise zu Wirtschaftskrise taumelt. Jede Woche reisen 1000 Neuankömmlinge ein. Die Boricuas, wie sich die Bewohner der Karibikinsel nennen, haben es zunächst einfacher als Latinos mit anderen Wurzeln: Sie sind von Geburt an US-Bürger und haben sofort alle Rechte. Doch Franklin Cortez winkt ab: "Den amerikanischen Traum gibt es nicht mehr, schon gar nicht für uns Latinos", sagt er mit leiser Stimme. Er sitzt in der Cafeteria vor einem Bagel und Kaffee, schiebt sich seine Schirmmütze in den Nacken.
Der 68-Jährige ist vor zehn Jahren in die USA gekommen, hoffnungsvoll klingt er nicht: Die Jungen müssten hart arbeiten und könnten es trotzdem zu nichts bringen, meint er. Die Armutsrate in Kissimmee liegt bei 30 Prozent."Mehr Menschen, mehr Arbeitslose, mehr Kriminalität, mehr von allem" gebe es nun, wie ein anderer Gast der Cafeteria ruft. Die Republikaner versprechen Sicherheit und Jobs, aber ihre harte Abschiebepolitik hat die Chancen der Partei nicht gerade gesteigert. "Hier sind alle für Hillary", behauptet zumindest Cortez.
Trump - der Alptraum der Latinos
350 Kilometer weiter südlich: Der sonnige Nachmittag in Little Havana, Miami, riecht nach gut gewürztem Hühnchen und Zigarren. Ab und zu spuckt ein Sightseeing-Bus blasse Kurzhosen-Träger vor dem Platz an der Calle Ocho aus, wo sich die Kubaner zum Domino treffen. Zwei ältere Kubano-Amerikaner sitzen auf einer Bank im Schatten und brechen in solch herzhaftes Gelächter aus, dass ihnen fast die Stumpen ihrer Julieta-Zigarre aus der Hand fallen. Donald Trump? Sie winken ab.
Exil-Kubaner in den USA gelten traditionell als konservativ und Sympathisanten der Republikaner. In Florida konnten sich bislang alle Präsidentschaftskandidaten von Richard Nixon bis George W. Bush auf sie verlassen, sogar Mitt Romney gewann in Little Havana noch eine Mehrheit. Doch 2016 ist selbst die ältere Generation skeptisch, die anders als ihre Kinder nicht für die Obama-Botschaften empfänglich war und die Kuba-Politik der Demokraten immer kritisch beäugte.
"Trump es un loco", heißt es hier, Trump sei ein Verrückter. Ein Albtraum für alle Latinos, unwählbar. Auch Marco Rubio und Ted Cruz, beide immerhin Söhne kubanischer Einwanderer, finden hier nach ihren Abschiebe-Parolen wenig Zuspruch. "Das sind keine von uns. Sie sind nicht für uns, sondern gegen uns", sagt der 71-jährige Neicar, einer der Männer auf der Bank im Schatten.
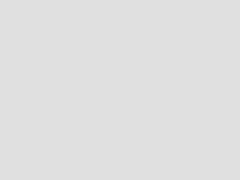
Tränengas, Demonstranten als "Müll": Sind die Tumulte während der Auftritte Donald Trumps ein Vorgeschmack auf das, was die USA im Herbst erwartet?
Hispanics machen inzwischen die Hälfte von Miamis Einwohnern aus. Nach den "Cuban Americans", von denen die ersten Ende der Fünfziger vor Castro flohen, kamen Einwanderer aus Nicaragua, Honduras, Venezuela oder Kolumbien. Hier sind die Hispanics am weitesten gekommen, haben erfolgreiche Geschäftsmänner, Politiker und Fernsehstars hervorgebracht. Sie sind Teil der Gemeinschaft, mehr noch: Spanisch ist die anerkannte Verkehrssprache der Stadt.
Selbstverständlich ist diese Entwicklung nicht. Hectór, der gerade mit seinen Freunden im Domino-Club die Steine mischt, zögert kurz und wirkt nachdenklich. "Amerika war bisher immer gut zu uns. Doch das ändert sich gerade. Wir alle haben Angst, was die Zukunft bringt."
Schleppende Mobilisierung gegen Trump
Ana Clara Parquero aus Costa Rica und Maria Cecilia Briones aus Nicaragua sind keine ängstlichen Frauen. Sie leben seit 15 Jahren ohne Papiere in Miami und arbeiten als Haushaltshilfen. Doch die Bedingungen sind nicht einfach. "Wir bekommen nur fünf Dollar Stundenlohn, und oft bezahlt man uns einfach gar nichts", erzählen sie. Hinter ihnen rauscht der niemals endende Abendverkehr durch den Stadtteil Coral Way. "Die wissen, dass wir als Illegale nicht zur Polizei gehen."

"Wer mich angegriffen hat, ist untergegangen", sagte er neulich. Seine Rivalen scheinen das einzusehen - und attackieren ihn kaum noch.
Auch das sind die Geschichten der Latinos in den USA: Menschen, die illegal ins Land kamen und seit Jahrzehnten als billige Arbeitskräfte geduldet werden, weil sie die Jobs erledigen, die Amerikaner nicht mehr machen wollen. Ana Clara und Maria Cecilia haben Kinder, die hier geboren wurden und dadurch US-Bürger sind. Sie sollen es einmal besser haben, doch plötzlich geht es darum, das Erreichte nicht zu verlieren.
Die Latino-Community, so der Eindruck, rückt deshalb trotz aller Unterschiede zusammen. Im ganzen Land gibt es Bemühungen, Einbürgerungen voranzutreiben, um als ordentlicher US-Bürger wählen zu dürfen - mit dem Ziel, Donald Trump zu verhindern. Welcher US-Latino würde schon für einen Kandidaten stimmen, der die Mutter oder Freunde deportieren möchte?
Die politische Mobilisierung der Latinos verläuft mitunter schleppend, obwohl sie inzwischen einen stattlichen Teil der Bevölkerung ausmachen: Lebten 1950 insgesamt nur drei Millionen Menschen mit hispanischem Hintergrund in den USA, sind es heute 55 Millionen. Bis zum Jahr 2050 werden es 106 Millionen sein. 900.000 Hispanics erreichen jedes Jahr das wahlfähige Alter.
10.45 Uhr, erste Pause an der Liberty Highschool in Kissimmee: 2000 Schüler stürmen auf den Pausenhof, zwei Drittel von ihnen haben hispanischen Hintergrund. In einer Ecke warten bereits Esteban Garces und seine Helfer: Am Stand von "Mi Familia Vota" können sich Teenager über ihr Wahlrecht informieren. Wenn sie im November 18 Jahre sind, können sie sich gleich registrieren - nur dann dürfen sie über den nächsten Präsidenten abstimmen. "Wir versuchen, die Jungwähler immer wieder zu mobilisieren, anders geht es nicht", erzählt Garces, "dieses Jahr wollen wir 33 000 Erstwähler registrieren." Neben Florida ist "Mi Familia Vota" deshalb in Nevada, Colorado, Kalifornien, Arizona und Texas aktiv, jene Staaten mit hohem Anteil an Hispanics.
Die Schüler versammeln sich um die Listen, sprechen mit den Helfern, die kaum älter als sie selbst sind. Wählerregistrierung bedeutet in den USA, sich für eine Partei zu entscheiden oder als "unabhängig" einzuschreiben. Die hispanischen Wähler sind zu 38 Prozent Demokraten, mit 25 Prozent ist der Anteil der Unabhängigen inzwischen höher als der an Republikanern. Wer als Latino in den USA geboren wurde, ist im Schnitt jugendliche 18 Jahre alt. Republikanische Strategen hoffen immer noch darauf, dass die Latinos einmal der klassischen, weißen Arbeiterschicht ähnlich werden. Religiosität spielt bei den Hispanics eine größere Rolle, die Ablehnung von Abtreibung ist höher als in jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Zugleich aber sind sie für Waffenkontrolle und den Mindestlohn - klassische Anliegen der Demokraten.
Die Schüler, die dieses Jahr zum ersten Mal wählen dürfen, erzählen, dass sie für Hillary Clinton sind. Anders als viele ältere Hispanics kennen sie aber auch Bernie Sanders. Aber eigentlich wollen sie nur das, was sich alle in ihrem Alter wünschen: Eine Zukunft, eine gutes Leben und einen Job, der sie ernährt. Das ist nicht selbstverständlich: Latinos haben ein größeres Risiko, die Schule abzubrechen und erreichen mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Uni-Abschluss.
Und dann stehen dort auf dem Pausenhof auch noch die Illegalen. Äußerlich unterscheiden sie sich nicht von den anderen, doch sie sind schlechter gestellt: Sie sind als Kinder mit ihren Eltern gekommen und haben nie etwas anderes kennengelernt als ein Leben in den USA. Und doch haben sie offiziell kein Recht darauf, hier zu sein.
"Dreamer" werden diese Kinder ohne Papiere genannt. Nach der Schule ist der Weg für sie steiler als für den Rest, weil dann ihr illegaler Aufenthaltsstatus wieder eine Rolle spielt. US-Präsident Obama ermöglichte immerhin, dass sie Sozialversicherungsnummern und damit leichter Job und Führerschein bekommen. Doch was hat der Mensch vor, der im Januar 2017 ins Weiße Haus einzieht? Nicht nur in Kissimmee und Miami warten sie nervös auf eine Antwort.