Hoffnungsvoll fällt die politische Inventur aus, trotz allem, was in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist: Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration, kurz SVR, hat sein Jahresgutachten vorgelegt. Es bilanziert die Flüchtlings- und Integrationspolitik in Deutschland und Europa, und zeigt auf, wie es besser laufen könnte. "Für einen Neustart in der EU-Flüchtlingspolitik brauchen wir mehr Europa und ein anderes Europa zugleich", sagte Thomas Bauer, Vorsitzender des Sachverständigenrats.
Europäische Arbeitsteilung
Um dieses "andere Europa" zu realisieren, versuchen die Wissenschaftler, ein großes Rad zu drehen. Sie plädieren für eine Arbeitsteilung in Europa: Die Staaten am EU-Rand, wo die Asylsuchenden ankommen, sollen vor allem für die Asylverfahren verantwortlich sein. Aufnehmen aber sollen die anderen EU-Mitglieder die Migranten.
Die Idee folgt aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen sich in Europa nicht weniger als "Asylanarchie" entwickelt habe. Latent bestehe die Krise des Systems zwar schon länger, das Jahr 2015 aber habe endgültig "gravierende Konstruktionsfehler" offenbart.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Dass man den Staaten an den EU-Außengrenzen die "alleinige Verantwortung" für alles, also für die Asylverfahren, die Rückführung abgelehnter und die Integration anerkannter Asylbewerber zuweise, sei "ursächlich für den kalten Boykott" des europäischen Asylsystems durch diese Erstaufnahmeländer. Festgelegte Standards für Aufnahme und Verfahren würden nicht mehr erfüllt, die Flüchtlinge zögen teils unkontrolliert weiter. Dass Brüssel versuche, das System zu reparieren, sei deshalb völlig richtig: Sobald ein Land sein Aufnahmekontingent erfüllt habe, sollen die Flüchtlinge in andere Länder weitergeschickt weiter, so die Überlegung der EU.
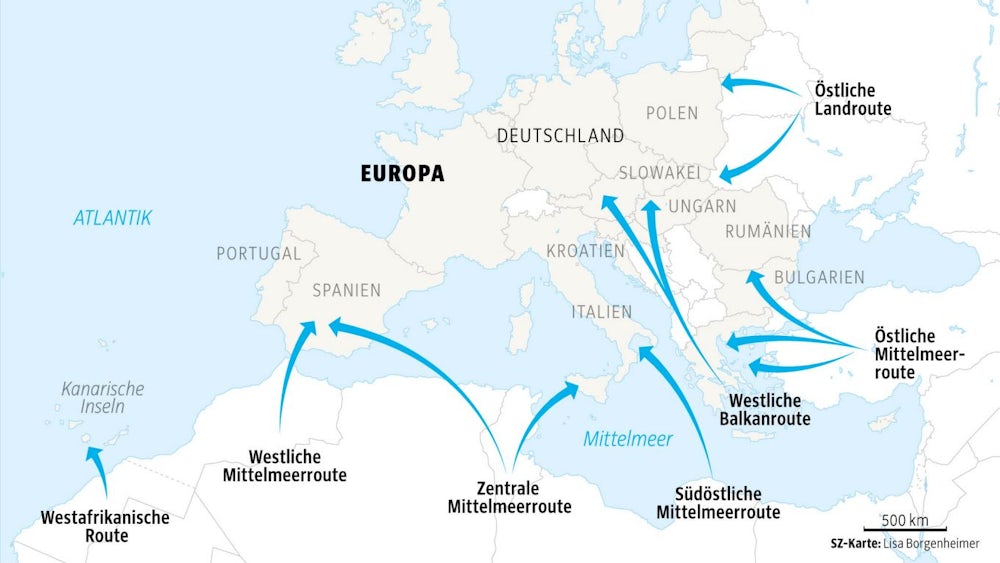
Der SVR geht allerdings noch deutlich weiter. Wenn ein Flüchtling sein Erstaufnahmeland Richtung Wunschziel verlassen will, soll er das tun dürfen. Das würde viel Bürokratie sparen, weil dann die Zwangsverteilung überflüssig würde. Ein solches "Free-Choice-Modell" könnte allerdings dazu führen, dass die meisten Flüchtlinge, wie bisher schon, nach Deutschland, Schweden, Österreich und in die Benelux-Staaten weiterziehen. Die EU würde sich so aufspalten in einen weitgehend flüchtlingsfreien Teil im Osten und Süden sowie Länder mit vielen Aufgenommenen.
Recht auf Freizügigkeit wie EU-Bürger
Eine solche Entwicklung könnte von manchen Ländern wohl als ungerecht empfunden werden. Dem soll das neue System, das der SVR vorschlägt, mit einer Art Arbeitsteilung und entsprechender Finanzierung begegnen: Die Staaten an den Außengrenzen sollen vorwiegend die Asylverfahren managen, und zwar nach zentralisierten, EU-weiten Vorgaben. Außerdem sollen sie die Rückführung abgelehnter Flüchtlinge organisieren.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Flüchtlinge, die bleiben dürfen, würden von der EU ähnliche Rechte auf Freizügigkeit eingeräumt wie EU-Bürgern - sie könnten, sofern sie eine Arbeitsstelle haben, in ihre Wunschstaaten weiterziehen, die dann für ihre Integration zuständig wären. Damit die Staaten nicht ungleich belastet werden, schlägt der SVR einen EU-internen Finanzausgleich vor: Jene Länder, die sich die Verfahren, die Abschiebungen und die Integration viel kosten lassen, bekommen einen Teil aus einem Solidartopf erstattet.
Der SVR lobt seine Idee gleich selbst: Im Vergleich zum "chaotischen aktuellen Zustand" in Europa, wo Asylrecht de facto wieder von den Nationalstaaten abhänge, "erscheint dieses stärker arbeitsteilige Modell überzeugend".
Aufnahmezentren in Nordafrika
Der EU-Türkei-Deal sei gar nicht so schlecht, sagen die SVR-Experten, zumindest nicht so schlecht, wie er in der öffentlichen Diskussion rüberkomme: Wer illegal nach Griechenland kommt, wird in die Türkei zurückgeschickt; dafür nimmt die EU der Türkei syrische Flüchtlinge ab. Die Einwände gegen den Deal (von Zweifeln am griechischen Asylsystem bis zur Angst der Erpressbarkeit durch die Türkei) seien zwar "nicht unberechtigt", heißt es im SVR-Gutachten, aber es wäre falsch, den Pakt "pauschal zu verdammen". Immerhin breche er "mit einer perversen Logik", die derzeit noch gilt: Nur wer es auf irregulärem Wege nach Europa schafft, kann hier sein Recht auf Schutz wahrnehmen.

Zehntklässler setzten sich für einen jungen Afghanen ein, der im Weßlinger Containerdorf lebt. Der 18-Jährige spielt Handball im Sportverein und kann schon gut Deutsch. Nun droht ihm die Abschiebung
Die Wissenschaftler lassen Sympathie dafür erkennen, das System des EU-Türkei-Deals auf Nordafrika auszudehnen: in Aufnahmezentren gleich an der Mittelmeerküste Asylverfahren durchzuführen. Wem Schutz zugesprochen wird, der soll auf sicheren Wegen nach Europa weiterreisen dürfen. Das würde die Zahl der Toten im Mittelmeer reduzieren, und man könnte die Schutzbedüftigsten auswählen: Frauen, alleingelassene Kinder, Kranke, Alte. Allein, und das ist auch für den SVR ein ungelöstes Problem: Die Standards in diesen Aufnahmezentren müssten europäischen Menschenrechtsstandards entsprechen. Bis dies garantiert sei, würde es dauern. Das Projekt lasse sich also "nicht von heute auf morgen umsetzen".
Zu einem funktionierenden Asylsystem, das auch von der einheimischen Bevölkerung akzeptiert werde, gehört den Wissenschaftlern zufolge, dass abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat zurückkehren.
Wer nicht freiwillig geht, müsse abgeschoben werden, fordert der SVR, und fügt hinzu, dass dies auch dann passieren müsse, wenn "die Zivilgesellschaft", sprich: die Asylaktivisten, protestieren und ein Bleiberecht für diesen und jenen fordern. Wichtig aber sei, dass zwischen ablehnendem Bescheid und Abschiebung "nicht zu viel Zeit vergeht". Je länger ein Flüchtling im Land ist, desto schwieriger sei seine Zwangsausreise zu legitimieren.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Kein Spurwechsel zwischen Arbeitsmigration und Asyl
Die verschiedenen "Einwanderungspfade" sollten nicht vermischt werden, fordert der SVR. Hier die Schiene der Arbeitsmigration, dort die des Asyls, ein Spurwechsel sollte nur in Ausnahmen möglich sein. Dann zum Beispiel, wenn ein Asylverfahren ohne Schuld des Flüchtlings zu lange dauert. Werde der Spurwechsel aber zum Regelfall, die Asyl- also zu eng mit der Arbeitsmarktpolitik verknüpft, könnte dies der Akzeptanz des Flüchtlingsschutzes in der Bevölkerung schaden. Gibt es irgendwann ein Überangebot an Arbeitskräften, könnte die Forderung laut werden, das Recht auf Asyl einzuschränken.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Gegen eine Schutzlotterie bei "sicheren Herkunftsländern"
Das Instrument, bestimmte Staaten zu "sicheren Herkunftsländern" zu erklären, ist für den SVR ein Versuch, die Zuwanderungspfade Arbeitsmigration und Flucht getrennt zu halten. Das funktioniere aber nur, wenn Europa einheitliche Kriterien anlege. Bislang aber gleiche die EU einem "Flickenteppich", auf dem sich Flüchtlinge schnell in einer "Schutzlotterie" wiederfinden. Ein Flüchtling, der für die Behörden des einen EU-Landes aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, kann im nächsten EU-Land die Chance haben, zu bleiben, weil dort sein Heimatland nicht auf der Liste der "sicheren" Staaten steht.
Der SVR unterstützt EU-einheitliche Listen sicherer Herkunftsstaaten, warnt aber zugleich davor, sie überzubewerten. Weder seien sie zu verteufeln, noch dürfe man sie als Allheilmittel der Steuerung ansehen. Wenn, dann wirkten diese Listen symbolisch: Sie signalisierten potenziellen Flüchtlingen aus diesen "sicheren" Ländern, dass sich eine teure Reise nicht lohne. Und sie sollten der einheimischen Bevölkerung vermitteln: Die Politik steuert die Zuwanderung.
Abgelehnte Asylbewerber sollen abgeschoben werden, obwohl die Lage in dem Land am Hindukusch gefährlich ist. Doch die Schutzquote für Afghanen sinkt kontinuierlich - mittlerweile auf unter 50 Prozent.
Integration über Schulen
Schulen werden immer mehr zu den zentralen Integrationsinstitutionen, zumal viele der neu Zugewanderten minderjährig sind. Der SVR warnt davor, für Flüchtlingskinder eine spezielle Schul-Infrastruktur zu schaffen. Stattdessen sollte daran gearbeitet werden, im bereits bestehenden System ethnische und soziale Segregation zu vermeiden. Vor allem kritisiert der SVR, dass einige Bundesländer die EU-Aufnahmerichtlinie missachten, wonach Flüchtlingskinder spätestens drei Monate, nachdem sie ihren Asylantrag gestellt haben, eine Schule besuchen.
Zwangsheimat in Deutschland
In der umstrittenen sogenannten Wohnsitzauflage sieht der SVR eine Chance. Die Bundesländer können anerkannte Flüchtlinge für drei Jahre dazu zwingen, an einem bestimmten Ort zu leben. So sollte der ungesteuerte Zuzug in Ballungsgebiete gemindert werden, wo Wohnungen ohnehin schon knapp sind. Der SVR rät ländlichen Regionen und solchen, die mit Abwanderung zu kämpfen haben, diese Chance zu nutzen. Sie sollten alles tun, damit sich anerkannte Flüchtlinge in ihrer Zwangsheimat heimisch fühlen, zum Beispiel, indem man sich um Arbeitsplätze bemüht und sie in der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein mit offenen Armen empfängt.
Übernahme von Werten lässt sich nicht erzwingen
Spätestens seit der Kölner Silvesternacht mit ihren Übergriffen wird viel über Werte gesprochen, die es den Zuwanderern zu vermitteln gelte. Deshalb wurde in den Integrationskursen der sogenannte Orientierungsteil von 60 auf 100 Stunden aufgestockt. Das sei gut, sagt der SVR, warnt aber davor, die Wirkung auf den "Wertehaushalt" von Flüchtlingen zu überschätzen. Es sei wichtig, diese Werte zu vermitteln und sie auch einzufordern. "Eine echte Übernahme dieser Werte lässt sich aber nicht erzwingen."

Die aktuelle Kriminalstatistik besagt, dass mehr Asylsuchende straffällig werden. Doch ein Blick auf die Feinheiten der Zahlen lohnt sich, ehe man Vorurteile bedient.
Hilfreich sei dafür, dass sich die Zuwanderer eingliedern und diese Werte im Alltag erleben. Wenn dann aber die Fremdenfeindlichkeit zunimmt, ebenso wie Übergriffe auf Flüchtlinge, dann hintertreibe dies nicht nur die Bemühungen um Integration. Es untergrabe auch den Wertekanon, an den sich alle halten sollen.

