Unsere Welt ist eine, in der es Fußballnationalmannschaften und Frauenfußballnationalmannschaften gibt. Eine, in der Schutzmasken nicht richtig über die Gesichter von Frauen passen und Sicherheitsgurte nicht richtig über Brüste, in der Spracherkennungssoftware hohe Stimmen schlechter versteht, in der Smartphones sich mit kleinen Händen schwieriger bedienen lassen. Eine, in der Frauen mit Herzinfarkt schlechter behandelt werden, weil sie oft untypische - das heißt, nicht-männliche - Symptome zeigen.
Schon in guten Zeiten werden Frauen zu oft übersehen. In Krisen wächst ihre Unsichtbarkeit, weil ein altes Vorurteil umso berechtigter erscheint: Erst einmal gehe es um Menschenleben, dann um Geschlechtergerechtigkeit. Die Rechte der halben Bevölkerung werden als Interesse einer Minderheit missverstanden. Dabei zeigen die wenigen Daten, die wir haben, dass Frauen überproportional betroffen sind von Konflikten, Naturkatastrophen - und Pandemien. In Pandemien sterben generell mehr Frauen als Männer. Laut WHO kann die Überzeugung, Geschlecht sei unbedeutend, Präventions- und Eindämmungsmaßnahmen behindern und Verbreitungswege verschleiern. Frauen kümmern sich zuhause häufiger um Kranke und stellen auch in Kliniken den Großteil der Pflegerinnen sowie Putz- und Waschkräfte, die weniger Schutz und Unterstützung erfahren als (traditionell männliche) Ärzte. Vielerorts bereiten Frauen die Leichname auch Infizierter für Beerdigungen vor. Frauen können nicht immer autonom entscheiden, Gesundheitsratschlägen zu folgen. Inmitten von Chaos und gesellschaftlichem Zusammenbruch verstärkt sich die Gewalt gegen Frauen.
Manchmal ist es schwierig, zu erklären, warum es Feminismus noch braucht; warum auch die Sache mit den Fußballnationalmannschaften keine Kleinigkeit ist, sondern Ausdruck eines fundamentalen Problems. Das fundamentale Problem: Frauen sind keine Abweichung, und sie sind auch keine kleinen Männer; sie machen die Hälfte aller Menschen aus und sollten auch so behandelt werden.
Es war schwierig, das zu erklären. Dann erschien Caroline Criado-Perez' Buch "Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert", dem die obengenannten Informationen entnommen sind. 2019 kam es auf Englisch heraus, im Februar 2020 in der deutschen Übersetzung von Stephanie Singh. Die Autorin und Aktivistin beschreibt verständlich und überzeugend, wie Frauen im Alltag und im Beruf, in Design und in der Medizin, im öffentlichen Leben und in Krisen benachteiligt werden, weil Daten über Männer den Großteil unseres Wissens ausmachen. Frauen sind unsichtbar - außer, wenn es um Sex und Care-Arbeit geht. Criado-Perez plädiert für einen Systemwandel; sie zeigt, dass Frauen nicht vergessen werden, wenn sie in der Forschung, in Unternehmen und in der Politik vertreten sind. "Unsichtbare Frauen" stand in Großbritannien 16 Wochen auf der Bestsellerliste, gewann zwei Preise und wurde mittlerweile in 13 Länder verkauft. Das Buch ist ein Mammutwerk, ambitioniert, akribisch recherchiert, voll entsetzlicher, nützlicher Studien und Statistiken; eine Fundgrube an Argumenten für Feministinnen und Feminismus.
Criado-Perez wirft anderen vor, Frauen zu ignorieren, ignoriert aber selbst nicht-binäre und trans Menschen
Dabei lässt sich einiges gegen das Buch einwenden. Criado-Perez betont, dass es fundamentale biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, und übersieht dabei, dass biologisches wie soziales Geschlecht ein Spektrum sind. Dass es verschiedene biologische Marker für Geschlecht gibt, die unterschiedlich kombiniert sein können - Chromosomen, Hormone, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, und so fort. Biologinnen wie Anne Fausto-Sterling weisen darauf seit Jahrzehnten hin; auch das deutsche Personenstandsrecht kennt seit gut einem Jahr die Option "divers". Criado-Perez wirft anderen vor, Frauen zu ignorieren; sie ignoriert nicht-binäre und trans Menschen. Und sie macht ebenjenen Unterschied stark, den andere für ohnehin viel zu prominent halten; den zwischen Männern und Frauen.
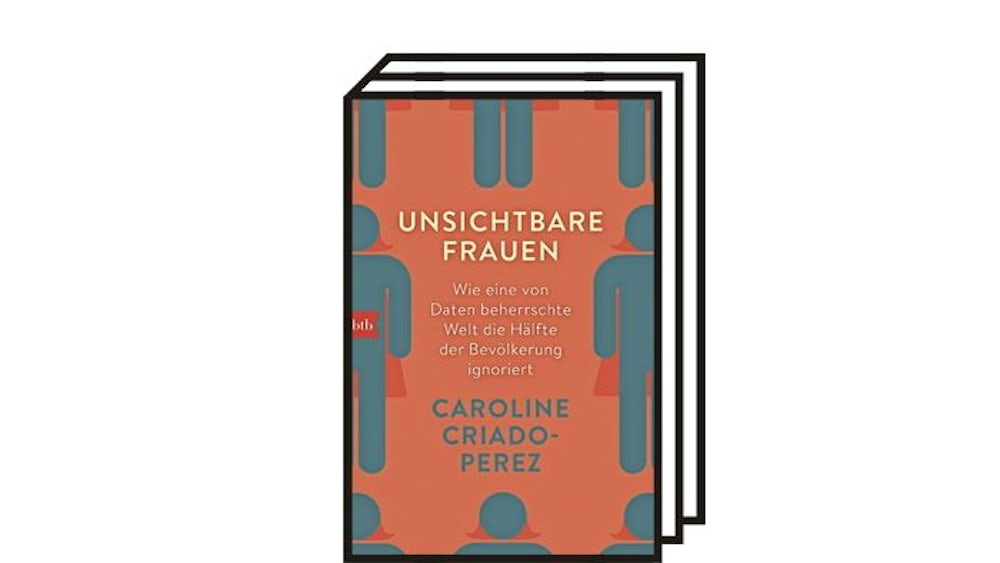
Gerade in der Medizin könne darüber hinaus das Beharren auf die Verschiedenheit der Geschlechter andere wichtige Faktoren verdecken, warnt der Soziologe Steven Epstein: sozialer Hintergrund, Fitness oder Familiengeschichte zum Beispiel. Und: Nicht immer wurden Therapien hauptsächlich an weißen Männern getestet; versklavte Menschen etwa mussten medizinische Experimente über sich ergehen lassen, Männer und Frauen.
Das muss weiter diskutiert werden, ändert aber nichts daran, dass Criado-Perez mit ihrem Hauptanliegen Recht hat: Es muss Schluss sein damit, dass eine Bevölkerungsgruppe auf Kosten anderer zur Norm erhoben wird. Dieses Buch ist ein Wendepunkt.

