Der Perfekten saß ich mal im Zug gegenüber. Sie war 15, sie hatte schulterlange blonde Haare, rote Wangen und erlesenen Geschmack. Sie trug lässige Klamotten, sie aß kein Fleisch, sondern Sojawürstchen und Obst und Gemüse. Sie überlegte mit ihrer Freundin, welche Ausbildung sie nach der Schule machen sollte. Ich war gebannt von ihrer Anmutung, sie war durchdrungen von Pragmatismus, Nachhaltigkeit und Freundlichkeit. Sie sprach nicht über Jungs, nicht über Partys, schon gar nicht über Drogen. Sondern darüber, was mal aus ihr werden sollte. Hin und wieder reichte die Perfekte ihrem kleinen dicken Bruder Apfelschnitze. Sie war betörend.
Und ich dachte: Hoffentlich werden meine Kinder nie so! So brav, vorhersehbar und steuerbar, so leistungsstark und angepasst. Und später dann, in 20, 30 Jahren: überdreht und erschöpft. So wie wir. Die Frauen von heute.
Frauen, die alles wuppen wollen und sich permanent selbst optimieren. Frauen, die funktionieren. Die performen. Und deren Funktionstüchtigkeit und Overperformance jetzt - mal vorsichtig, mal vehement - kritisiert wird. Beispielsweise von der wütenden jungen Feministin Laurie Penny, die gegen den Neoliberalismus und die Anpassung der Frauen wettert. Vielleicht hat die Autorin einfach nur erkannt, dass man als Frau heute doch nicht immer alles haben kann, alles auf einmal, sofort.
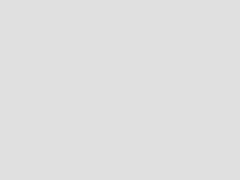
Der Feminismus sei zur Hochleistungsmaschine verdreht worden, sagt Laurie Penny in ihrem Buch "Unsagbare Dinge". Das hängt zusammen mit der Krise des Kapitalismus.
Die Frau von heute jongliert mit 34 Bällen, aber lächelnd
Die Frau von heute saß mir gerade beim Elternabend gegenüber, ich kenne sie schon lange, mit all ihren Vorzügen und Fehlern. Sie strahlt, sie sprüht, sie quasselt rasend schnell, man ist überwältigt. Sie kommt direkt vom Job, sie macht was mit Medien, und trinkt schnell schweren Wein, will aber kein Brot, nein danke, low-carb. Sie lächelt, sie sieht gut aus. Morgen muss sie wie immer früh raus. Um halb sieben steht sie auf, verabschiedet ihre Kinder, die bloß nicht krank werden dürfen, den Großen "schickt" sie jetzt sogar den ganzen Tag in die Schule, bis vier, und hat ein schlechtes Gewissen, so wie sie auch ein schlechtes Gewissen bei dem Kleinen hat, wenn er mittags um halb zwei aus der Schule kommt, weil es dort keinen Hort gibt und sie nicht da ist und er versucht, an Bildschirmen rumzudaddeln. Dann macht sie schnell die Wäsche, läuft schnell eine Runde und um halb neun sitzt sie am Schreibtisch und versucht, sich zu konzentrieren, es plingt, blobbt, Tropfengeräusche. Mails, SMS, Anrufe. Sie bleibt dran, sie jongliert mit 34 Bällen, aber lächelnd.
Mittagessen ist nicht drin. Sie ernährt sich gesund, macht Yoga, hat längst mit dem Rauchen aufgehört, wenn ein Arbeitgeber meckert, sagt sie brav Ja-kein-Problem-ich-mach-das, Sex findet, wenn überhaupt, im Hellen statt, und weil der Mann an ihrer Seite stichelt, der Rotwein am Abend sei als Alkoholismus zu interpretieren, trinkt sie auch Tee. Kräutertee, bio, ist ja klar. Sie kauft ein, kocht, macht Hausaufgaben, bringt die Tests ihrer Kinder durcheinander, sie macht die Wäsche. Vor dem Fernseher schläft sie ein, nach dem "Heute-Journal" liegt sie im Bett.
Sie hat viele Freunde, aber Einladungen selten, sie macht das jetzt nicht mehr, so ein Aufwand und dann der Kater. Sie überlegt, ob sie die Apps runterladen soll, mit denen sie noch effizienter haushalten könnte: mit Gewicht, Geld, Zeit, Kraft. Sie ist diszipliniert, effizient, erfolgreich. Sie ist die Frau von heute.
Nachts kommt sie nicht mehr runter
Der Begriff Selbstoptimierung erregt bei ihr dennoch Würgreize. Sie ist ja nicht dumm. Er klingt, als wäre sie nur "Human Capital" in einer nach Gewinnmaximierung strebenden Wachstumsideologie. Als habe sie kein Mensch, sondern eine Maschine zu sein. Die sich in die Mechanismen des Marktes einklinkt. Würde jemand sagen: Die Marmelade ist noch optimierbar - sie würde lachen. Über den Manager-Jargon. Über sich selbst lacht sie nicht. Sie muss dran bleiben, sie schafft das! Beruf, Kinder, Mann, Haushalt, Freundinnen, Liebhaber, Sport, Termine, abends am Laptop ordert sie sich für den Kick ein Paar Schuhe.
Nachts kommt sie nicht mehr runter. Kurz vor dem Einschlafen und manchmal mitten drin wird sie schlagartig wach. Die Frau bekommt Angst. Und Angst vor der Angst. Die Frau weiß von Experten, die sich mit Erschöpfung und "Anpassungsstörungen" befassen, dass dies ein Alarmsignal ist. Ihre erste Erschöpfung mit depressivem Touch hatte sie mit Mitte 20, davor die Magersucht, die zweite fünf Jahre später. Ihr Rücken schmerzte, sie konnte zwei Jahre kaum stehen, Zellen ihres Körpers veränderten sich ungut, es tickte eine Zeitbombe. Aber weiter, sie war am Start, die Welt stand ihr doch offen. Sie war dreißig, eine vielversprechende junge Frau. Sie bekam Kinder, zwei hintereinander, und arbeitete durch, sie war eine Ich-AG und die hatte keine Elternzeit. Aber einen Mann an ihrer Seite, der ihr all das erlaubte. Sie wollte alles teilen, sie wollte es allen beweisen, ihren Freundinnen, ihrer emanzipierten Mutter, den Männern und vor allem sich selbst: Seht her, geht doch!

Achselhaarassoziation, Ekelhürde, Männerfeindlichkeit: Über Feminismus wird viel diskutiert, doch viel zu sehr darüber, wie und worüber geredet werden sollte. Damit dreht sich die Debatte um sich selbst - und viel zu wenig um Gerechtigkeit.
Manchmal wurde ihr Ton schrill. Sie selbst hörte ihn nicht. Sie wütete, wenn ihr Mann, ihre Eltern oder ihre Freundin sagten: Wie redest du mit mir, in diesem grässlichen gouvernantenhaften Ton? Sie brüllte: Ihr habt ja keine Ahnung! Ich reiß' mir hier den Arsch auf! Ohne mich würde alles zusammenbrechen! Fasst mich jetzt bloß nicht an! (Und flüsterte: Ich bin so alle.)
Sie sah die anderen. Vier Kita-Erzieherinnen, die über Monate im Burnout verschwanden. Zwei Lehrerinnen, die wegen anhaltender Erschöpfung ein Jahr ausfielen. Ihre Freundin, alleinerziehend, die über Monate jeden Vormittag in eine Klinik eincheckte, um den Nervenzusammenbruch abzuwenden; nachmittags war sie wieder für ihre beiden Mädchen da, morgens rannte sie durch den Park. Die andere, Oberärztin, zwei Kinder, die einmal jedes halbe Jahr Zeit fand auf einen Kaffee, zuletzt zwischen acht und acht Uhr vierzig am Morgen. Und - den Nachbarn, der anhand von vom Arzt verschriebenen Meditationstrainings versuchte, einen Sinn in seiner Arbeit zu finden, er wollte lieber zu Greenpeace, als online Schuhe verkaufen. Den Mann an ihrer Seite, der, wie die meisten Männer, oft ähnlich erschöpft war wie sie. Es sich aber nie eingestehen würde. Und der sich, immerhin, manchmal einfach so hinter seiner Zeitung ausklinkte.
Sie hingegen musste immer was tun. Im Hamsterrad. Wer, fragte sie sich in der Nacht, ist dieser Hamster? Bin das ich, die Frau von heute? Oder ist es das System? Was treibt mich? Die Kommunikationswissenschaftlerin Angela McRobbie sagt jetzt über die Frauen von heute: "Ihre Selbstkontrolle ist strenger als jede Kontrolle von außen. Damit sind sie die perfekten Mitglieder einer neoliberalen Gesellschaft." Da hat sie recht.
Trotzdem bin ich erschrocken. Ich erinnerte mich an Sheryl Sandbergs Appell: Frauen sollten sich mehr reinhängen, lean in! Yes, hatte ich gedacht, wie recht sie hat. Wenn wir nur wollen, kriegen wir alles hin, lasst uns mal machen! Das Klingeln im Hinterkopf hatte ich verdrängt, jetzt wird es laut: Sheryl Sandberg ist Managerin von Facebook. Ihr sollen Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar gehören. Damit hat sie es geschafft, zu dem einen Prozent der Welt zu gehören, das mehr als die Hälfte des weltweiten Vermögens besitzt. Unsere Sheryl ist verantwortlich für das Unternehmen, dessen Allmachtstrategie, Intransparenz und Gewinnstreben ich ekelerregend finde. Und diese Frau sollte mein Vorbild sein?

Schnelles Rechenzentrum im Kopf: Facebook-Finanzvorstand Sheryl Sandberg hat 48 Stunden Zeit für Deutschland. Die nutzt sie auch für ein Gespräch über Merkels Karriere, das Vorurteil, Mädchen könnten nicht führen - und die Frage, ob die Desperate Housewives etwas für den Feminismus tun können.
Wie konnte es so weit kommen? Ich erinnere mich, es begann Mitte der Neunziger, zu der Zeit, als ich zu arbeiten begann. Da nahmen drei Entwicklungen Fahrt auf: 1. Der Markt wurde seiner sozialen "Fesseln" entledigt. 2. Die Kommunikation wurde beschleunigt und verdichtet, digital, global, surreal. 3. Viele Frauen hatten erstmals in der Geschichte die Chance mitzumachen und wollten, selbstverständlich, auch die Top-Posten. Also begann das Kräftemessen, nicht nur mit Männern, sondern auch unter uns Frauen: Spieglein, Spieglein an der Wand - wer ist die Beste im ganzen Land? Die Beste der Klasse, die Beste im Studium, die Beste im Job, die beste Mutter mit dem besten Body, dem besten Mann?
Unser Treiben bekam eine hysterische Note
Also drehten wir auf, wir erschöpften unsere "Ressourcen", und unser Treiben bekam, mhm ja, so hätte man es früher abschätzig bezeichnet: eine hysterische Note. Hysterisch zu sein, das hatte ich vor meinem Arbeitseinstieg bei der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun gelernt, bedeutete für eine Frau: sich den Idealvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft in einem solchen Übermaß anzupassen, dass sie zur Karikatur dessen wird, was die Gesellschaft von ihr erwartet. Und weil es zumeist Männer waren, die die Macht hatten, kulturelle Ideale zu bestimmen, waren es häufig Frauen, die guten Töchter, die zu solchen Überzeichnungen neigten. Und der Ideologie am eigenen Körper ihren Zerrspiegel vorhielten. Wenn auch unbewusst.
Die junge britische Journalistin Laurie Penny sagt jetzt, mit 27, in ihrer Streitschrift "Unsagbare Dinge", dass ihr das alles gehörig auf die Ketten geht. Ihr deutscher Verlag ist überwältigt von der Resonanz. Als hätten alle darauf gewartet, oder zumindest viele junge Frauen. Dass eine mal sagt, was gar nicht wirklich noch nie gesagt wurde. Aber im "Mainstream-Feminismus" der letzten 20 Jahren offenbar in Vergessenheit geriet, so wie in der Kapitalismuskritik auch. Jetzt kommt beides wieder, und zwar mit der Attitüde des Punk.

SZ Magazin
Leistung, Erfolg, Führungsanspruch - und dabei immer schön locker bleiben: Die Wissenschaftlerin Angela McRobbie findet, dass Feminismus neuerdings sehr männlich wirkt.
Auch Angela McRobbie, 66, verweist auf die vorbildlichen "Frauen in der Post-Punk-Ära" der Achtziger. Da seien Gender-Fragen so offensiv und radikal gestellt worden wie weder vorher noch nachher in der Popkultur. Und so wettert Laurie Penny gegen Karrierefrauen: "Von den Titelseiten der Promimagazine kreischt uns ein Chor erfolgreicher Frauen entgegen, die am Rande des psychischen und physischen Zusammenbruchs stehen." Mein Sohn kennt sie auch schon aus der Schule. Sie machen nie Fehler und schreiben nur Einsen. Er nennt sie in einer Mischung aus Ehrfurcht und Befremdung: Roboter.
Sich reinhängen - ja. Aber wissen, wofür
Bei mir kam dann mitten im Leben die Leere. Nachts und immer öfter am Tag. Ich sah mir dabei zu, wie ich durch mein hippes Berliner Viertel lief, alles nett, alles adrett. Ich schaute hinter die Fassaden und sah da all die Leute, uns, auf dem Sofa sitzen. Wie wir nach vollbrachtem Tagwerk - müde, selbstbezogen und zu nichts anderem mehr fähig - der Welt beim Untergehen zusahen, in weiter Ferne, so nah.

Immer noch werden überall Schokoriegel lustvoll in weibliche Münder geschoben: In ihrem zornigen Manifest "Fleischmarkt" analysiert die 25-jährige britische Bloggerin Laurie Penny Themen von sexistischer Werbung bis hin zu Schlankheitswahn und Pornografie - und fordert den weiblichen Widerstand.
Ich blieb stehen und dachte: Dein Leben ist halb rum. Du musst jetzt ernst machen. Mit dem, was du eigentlich wolltest. Die Zeit tickt. Nimm Haltung an! Jetzt! Eine Hälfte liegt noch vor dir! Tu was! Raus hier!
Was ich getan habe? Ich bin raus aus meinem Viertel, in die anderen mit den Dicken und Armen. Ich bin raus aus der Rama-Familie, aus dem Ideal, an dem all meine Freundinnen verzweifeln. Raus aus einer Erziehung, die sich nur an Leistung orientiert - damit meine Kinder nicht mit 17 in die Top-Posten des Kapitals streben. Und raus aus unserer Kultur, rein in solche, die auch noch andere Werte achten: Gastfreundschaft, Lebensfreude.
Manchmal habe ich Rückfälle. Aber ich weiß jetzt: Es geht. Ich muss mir die Zeit nehmen zu überlegen, was ich will. Ich kann NEIN sagen. Und: Da will ich nicht mitmachen! Und JA zu dem, was ich eigentlich für richtig und gut halte. Ich muss dafür leider auf Geld und Komfort verzichten. Und mich öfter mal ausklinken. Dafür habe ich mir auch ein Beispiel genommen an den Männern um mich herum. Denn die Guten unter ihnen haben das schon länger drauf als wir Frauen von heute. Also lasse ich eben auch mal die Wäsche liegen. Was ist mir wichtig, überlege ich: Was macht keine Angst, keine Leere - sondern Sinn?
Selbstverständlich kann die Frau von heute sich reinhängen. Aber sie sollte auch wissen, wofür.
