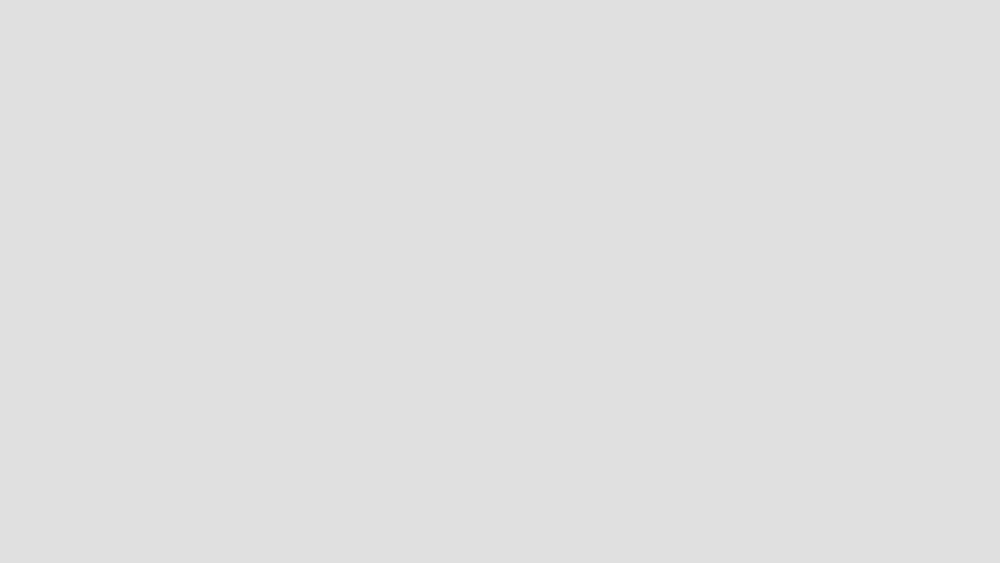Murat und Fayola sollten ein Foto in ihre Bewerbung kleben, wenn sie den Job als Mechatroniker oder Hotelfachfrau bekommen wollen. Es nützt ihnen auch nichts, ihren Namen geheim zu halten, weil sie das bloß verdächtig macht. Die anonyme Bewerbung, das legt eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin nahe, schadet denjenigen, denen sie nützen soll: Menschen mit Migrationshintergrund, die hierzulande länger als andere nach einer Stelle suchen müssen und häufiger Absagen kassieren. Mit einer großen Feldstudie haben die Wissenschaftler mehr darüber herausgefunden, weshalb Arbeitgeber sie so oft benachteiligen.
Das Forscherteam um den Soziologen und Migrationsforscher Ruud Koopmans hat über zwei Jahre hinweg Tausende Bewerbungen geschrieben - für Bewerber, die es nicht gibt, aber die es durchaus geben könnte. Nach Ausbildung und ersten Berufserfahrungen wollten die jungen Männer und Frauen erstmalig den Arbeitgeber wechseln und neue Stellen als Köche, Hotelfachleute, Anlagenmechaniker, Mechatroniker, medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte, Verkäufer oder Industriekaufleute antreten. Alle fiktiven Jobanwärter wurden 1992 in Deutschland geboren und sind hier zur Schule und in die Lehre gegangen.

Wer auf Gleichbehandlung klagt, wird als Schmarotzer dargestellt: Anwältin Asma Hussain-Hämäläinen gibt Politik und Justiz Schuld an Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt.
Die Namen, Bewerbungsbilder und Angaben zu sozialem Engagement einiger Scheinbewerber ließen aber darauf schließen, dass ihre Vorfahren aus einem anderen Land stammen oder sie muslimischen Glaubens sind - Informationen, die für Arbeitgeber, die möglichst begabte und gut ausgebildete Mitarbeiter suchen, irrelevant sein sollten. Oft schien das auch der Fall zu sein.
Spanisch, polnisch, japanisch? Ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt
"Wir konnten feststellen, dass Bewerber mit Vorfahren aus vielen europäischen, ostasiatischen und nordamerikanischen Ländern auf dem Arbeitsmarkt genauso behandelt werden wie Menschen ohne Migrationshintergrund", sagt Ruud Koopmans. Die fiktiven Bewerber mit spanischen, polnischen und japanischen Namen bekamen sogar etwas häufiger Einladungen zum Vorstellungsgespräch oder Nachfragen auf ihre Bewerbungsunterlagen, als die Kandidaten mit deutschen Namen.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Die geringen statistischen Vorteile dürfe man aber nicht überbewerten, sagt Koopmans. Der spanische Opa ist weder Trumpf noch Schwarzer Peter im ernsten Spiel um die Arbeitsplätze. Anders sieht es freilich aus, wenn die Wurzeln eines Bewerbers in Afrika liegen. "Personen, die aus afrikanischen und muslimischen Ländern stammen, sind eindeutig von Diskriminierung betroffen", sagt Koopmans. Während die Arbeitgeber sechs von zehn deutschstämmigen Bewerbern positiv antworteten, galt das nur für vier von zehn Kandidaten mit Vorfahren aus Albanien und Marokko.
Arbeitgeber verlassen sich nur ungern allein auf Zeugnisse. Lehrer können mal strenger, mal milder bewerten, Bundesländer stellten unterschiedliche Anforderungen, Prüflinge hätten am Prüfungstag Schnupfen, da ließen sich Arbeitgeber nicht so leicht täuschen, wie manch einer denkt, erklärt der Soziologe. Deshalb ist für sie häufiger relevant, was nicht in der Bewerbung steht, sich aber zusammenreimen lässt.
Was wissen Arbeitgeber über einen Mehmet, den sie nicht kennen? Dass seine Eltern wahrscheinlich aus der Türkei eingewandert sind und er demnach zu den Nachfolgern der Gastarbeiter gehört, über die Medien berichten, dass sie in der Schule immer noch nicht die gleichen Leistungen erbringen wie ihre deutschstämmigen Mitschüler. Und über jemanden, der sich für einen muslimischen Bürgerverein engagiert? Dass es dort Menschen gibt, die vor Frauen wenig Respekt haben. "Was Arbeitgeber über die jeweilige Gruppe denken, ist, was den Gruppendurchschnitt anbelangt, relativ realitätsnah, aber sie nehmen an, dass jedes Mitglied diesem Stereotyp entspricht, und liegen damit natürlich falsch", sagt Koopmans.

Leser Fabian G. ist zweimal durch das juristische Staatsexamen gefallen. Jetzt fragt er sich, wie er damit bei einer Bewerbung umgehen soll.
Die Forscher wollten es aber noch genauer wissen und haben mehr als 5800 der fiktiven Bewerbungen sowie ihre Rücklaufquoten immer wieder in verschiedenen Rechenverfahren miteinander verglichen. Waren es eher die Vorurteile hinsichtlich des Bildungsniveaus - der vermeintlich arme, ungebildete Afrikaner und die ehrgeizige, hochgebildete Chinesin - die bei der Entscheidung über Einladung oder Absage ausschlaggebend waren? Oder die vermuteten kulturellen Unterschiede, die Sorge, muslimische Frauen legten keinen Wert auf ihre eigene Karriere oder würden von ihrem Mann bald zum Kinderhüten verdonnert?
Deutsche Bewerbungskultur bietet auch Vorteile für Migranten
Nach vielen Rechenoperationen können sich die Wissenschaftler festlegen: "Das Bildungsniveau der Herkunftsgruppe spielt eine Rolle, aber entscheidend ist die kulturelle Distanz", sagt Koopmans. Die Effekte überlagern sich, weil ausgerechnet in Weltregionen mit für deutsche Maßstäbe sehr fremden Kulturen auch das Bildungsniveau nicht sehr hoch und die Modernisierung noch nicht so weit vorangeschritten sei. "Die Gruppen mit großer Wertedistanz sind häufig auch Gruppen mit niedriger Bildung", sagt Koopmans.
Die gute Nachricht für all diejenigen, die von dieser Pauschalisierung betroffen sind: Es gibt Möglichkeiten, den Arbeitgebern ihre diffusen Ängste zu nehmen. "Migranten in Deutschland profitieren davon, dass hier eine Bewerbungskultur gelebt wird, die relativ viele Informationen über den Bewerber bietet", sagt Koopmans. Wenn Murat angibt, dass er sich als Jugendtrainer einer Fußballmannschaft engagiert hat und seinen Gruppenleiterjob in einer muslimischen Jugendgruppe weglässt, dann könnten Arbeitgeber ihn in die Gruppe derjenigen Mitbürger einordnen, die sich integriert haben und soziale Verantwortung übernehmen. Und wenn Fayola sich im Hosenanzug ablichten lässt, geht sie als Karrierefrau ins Rennen.