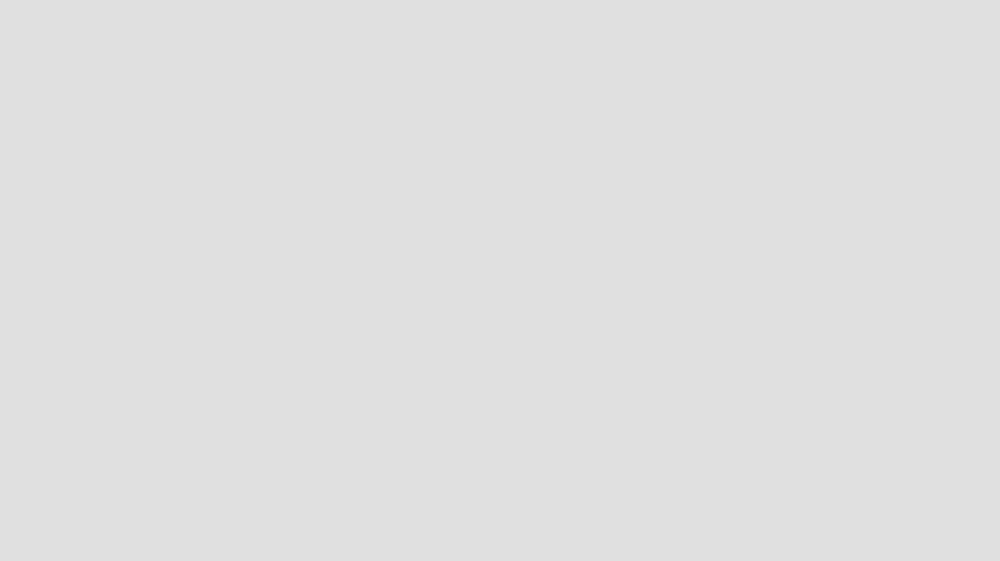Bei der Gehaltsverhandlung zockt jeder, heißt es. Die Frage nach dem aktuellen Verdienst ist für viele Bewerber daher reine Formsache: Ihrer Ansicht nach soll damit bloß die Untergrenze des Verhandlungsspielraums festgelegt werden. Und die darf man ruhig ein bisschen höher ansetzen, oder?
Mit einer eindeutigen Antwort tun sich auch Arbeitsrechtler schwer. Denn das bisherige Gehalt gehört nicht eindeutig zu den Tabu-Fragen, auf die Arbeitnehmer notfalls lügen dürfen. Wenn die neue Stelle ähnliche Kenntnisse und Fähigkeiten des Kandidaten erfordert wie die alte, darf sich der Arbeitgeber nach der aktuellen Bezahlung erkundigen. Erlaubt ist die Frage auch dann, "wenn der Bewerber die bisherige Vergütung als Grund für seine Gehaltsforderung anführt", sagt Tatjana Ellerbrock, Fachanwältin für Arbeitsrecht - also zum Beispiel, wenn ein Bewerber sagt, dass er sich mit einem Jobwechsel finanziell nicht verschlechtern will.

Denn die besten Jobs werden dort nur selten vergeben. Vor allem für Quereinsteiger ist der verdeckte Stellenmarkt viel interessanter.
"Der Bewerber kann immer sagen, dass er keine Auskunft geben möchte oder über Vertragsbedingungen Stillschweigen vereinbart wurde, aber mit klaren Lügen sollte er vorsichtig sein", sagt Arbeitsrechtler Daniel Hautumm. Denn die gelten als arglistige Täuschung und berechtigen den Arbeitgeber noch bis zu zehn Jahre später, den Arbeitsvertrag anzufechten, wenn er davon erfährt.
Ein paar Freiheiten zur Verhandlung lässt die Rechtsprechung aber dennoch: Schummeln wird nämlich erst dann zur Gefahr, wenn der Bewerber damit rechnen muss, dass sein bisheriges Gehalt entscheidend für die Einstellung wird. Wer pokern will, muss deshalb genau hinhören: Fragt der Personaler bloß nebenbei, was er eigentlich vorher verdient hat? Dann kann man ein bisschen dicker auftragen (und notfalls später sagen, man habe sich da vertan und nicht gewusst, dass die Frage entscheidend sei). Hakt ein Vertreter der Unternehmensseite aber mehrfach nach und weist er darauf hin, dass die Forderungen eigentlich das allgemeine Gehaltsgefüge des Unternehmens sprengen, sollte der Anwärter ehrlich sein.
Manchmal fliegt der Schwindel sofort auf
Ob die Mogelei überhaupt lohnt, sollten Bewerber in jedem Fall vorher prüfen - sonst kommen sie damit möglicherweise nur bis zum Ausfüllen des Personalbogens. Denn weil Arbeitnehmer in Deutschland, die ein bestimmtes regelmäßiges Jahresentgelt nicht überschreiten, in der gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert sein müssen, hat der Datenschutz dort seine Grenzen. Die Pflichtversicherung muss der Arbeitnehmer bei Einstellung angeben und damit im Jahr 2017 bestätigen, dass er weniger als 57 600 Euro (monatlich 4800 Euro) verdient hat.
Wer also zuvor behauptet hat, 60 000 Euro brutto pro Jahr zu beziehen, wird als Lügner enttarnt. Die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze wird immer wieder angepasst und sollte unbedingt beim Pokern bedacht werden. Erfahrene Personaler finden anhand dieses Merkmals oft auch heraus, dass bei bisherigen beruflichen Stationen geblendet wurde: Eine Managerposition bei einer großen deutschen Versicherung passt nicht zusammen mit einer Pflichtversicherung. Selbst wenn die Einstellung dennoch erfolgt und der Arbeitsvertrag nicht angefochten wird: Arbeitnehmer sollten sich gut überlegen, welchen ersten Eindruck sie in der Personalabteilung bei ihrem neuen Arbeitgeber hinterlassen möchten.
Wer einmal über die Versicherungspflichtgrenze hinaus ist, muss sich über eine so einfache Enttarnung keine Sorgen mehr machen. Ob jemand 70 000, 80 000 oder 100 000 Euro im Jahr eingestrichen hat, geht aus dem Personalbogen nicht hervor.
Findige Personaler versuchen manchmal trotzdem, über die Krankenkasse das bisherige Gehalt herauszufinden - und haben damit auch gelegentlich Erfolg. Ein einfacher Trick am Telefon: "Sagen Sie, ich habe hier ein bisheriges Jahresentgelt von X vermerkt. Stimmt das mit Ihren Daten überein?" Ein "dusseliger Sachbearbeiter" bei der Kasse widerspreche daraufhin schon mal freimütig und nenne die tatsächliche Summe, verrät einer, der das selbst schon ausprobiert hat.
Viel häufiger als über die Abrechnung und vermeintlich geschützte Daten sickern Gehälter aber von einer Personalabteilung zur anderen durch. Auch Personaler erzählen sich gegenseitig von ihren Zu- und Abgängen, tauschen sich aus, wie man diesen oder jenen Mitarbeiter denn locken konnte - auch wenn sie darüber eigentlich schweigen sollten.

Viele geniale Unternehmer hätten deutsche Konzerne nie entdeckt, sagt der Personalexperte Marcus Reif. Schuld daran sei auch der ewige Notenvergleich.
Während Bewerber die Gehaltsfrage also in vielen Fällen ehrlich beantworten müssen oder dies zu ihrem eigenen Wohle besser tun sollten, steht ihnen bei vielen anderen Fragen im Vorstellungsgespräch das Recht zur Lüge zu. So darf der Arbeitgeber gar nicht erst fragen, ob der Kandidat verheiratet, schwanger, krank oder katholisch ist. Die Religionszugehörigkeit kann für die Anstellung in Tendenzbetrieben wie den Kirchen von Bedeutung sein und darf in solchen Fällen ausnahmsweise erfragt werden.
Konfession und Familienstand sind kaum zu verbergen
Ähnlich wie ein Vertragspoker über die Jahresentgeltgrenze hinweg, bleiben auch die erlaubten Lügen oft nur bis Vertragsabschluss oder kurz darauf unentdeckt. Schwangeren Bewerberinnen ist das bewusst; das Gesetz schützt Frauen in dieser Zeit allerdings vor einer Kündigung. Lückenhafter ist der Schutz bei Familienstand und Konfession: "Diese Lohnsteuermerkmale werden dem Arbeitgeber automatisch vom Finanzamt bereitgestellt, weil die Daten für die Abrechnung erforderlich sind", sagt Steuerberater Oliver Theobald.
Die Religionszugehörigkeit und der Familienstand dürfen zwar kein Kündigungsgrund sein, aber Arbeitgeber müssen sich darauf zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses auch gar nicht berufen: "Die Kündigung kann während einer Probezeit ohne Grund erfolgen", sagt Tatjana Ellerbrock. Der Gekündigte müsse dann seinerseits darlegen und beweisen, dass er aufgrund dieser Merkmale schikaniert wurde - und das sei oft schwierig.
"Wer sich davor schützen will, könnte theoretisch lediglich die Angabe der Steuer-Identifikationsnummer oder des Geburtsdatums verweigern", sagt Theobald. Dann müsse man aber damit leben, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit der Steuerklasse VI abrechnet, er also unterjährig die höchsten Abzüge ertragen muss.
Die Arbeitsrechtlerin Tatjana Ellerbrock rät dazu, unzulässige Fragen im Bewerbungsgespräch vorsorglich in einem Gedächtnisprotokoll festzuhalten, das später als Beweis vorgelegt werden kann und schränkt ein: "In der momentanen Arbeitsmarktsituation sollte der Bewerber in solchen unerfreulichen Fällen aber besser gleich einen anderen Arbeitgeber ansteuern."