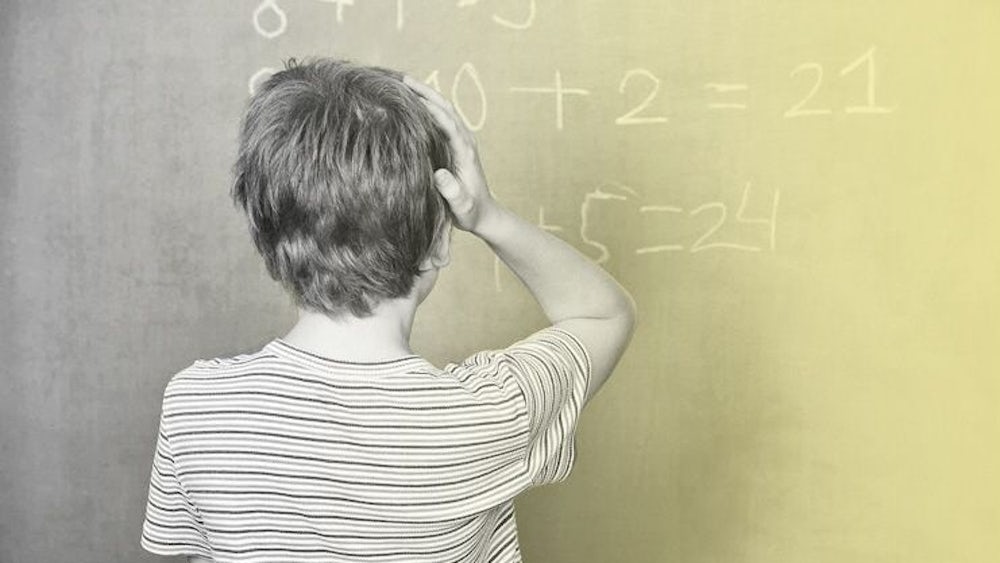Möglicherweise hat Nenad Mihailovic die Fragen einfach nicht verstanden, weil er damals nur Romanes sprach. Trotzdem hat jahrelang keiner seiner Lehrer das Gutachten angezweifelt, das ihm im Alter von sieben Jahren einen IQ von 60 bestätigte - eine geistige Behinderung. Der Sohn einer serbischen Zuwandererfamilie kam auf eine Förderschule. Und er musste dort bleiben, obwohl er immer wieder um Versetzung an eine Regelschule bettelte.
Das Landgericht Köln soll heute entscheiden, ob Mihailovic Schmerzensgeld und Schadenersatz zustehen. Vor zwei Jahren hat ein weiterer Intelligenztest gezeigt, dass der junge Mann durchschnittlich intelligent ist. Ein tragischer Irrtum? Ein Einzelfall? Die Erziehungswissenschaftlerin Lisa Pfahl von der Universität Innsbruck hat Zweifel.
SZ: Frau Pfahl, kann ein Intelligenztest bei einem siebenjährigen Kind eine geistige Behinderung feststellen und voraussagen, wie gut dessen Chancen auf einen Schulabschluss stehen?
Lisa Pfahl: Nein, ein einziger IQ-Test ist viel zu fehleranfällig und erlaubt keine langfristige Prognose. Wenn wir von einem Kind im Einschulungsalter nicht wissen, welche und wie viele Bildungsanreize es bekommen hat, wissen wir auch nicht, wie es lernen kann. Außerdem sagt der IQ-Test ja nur etwas darüber aus, wie ein Kind sein Leistungsvermögen im Vergleich zu Gleichaltrigen darstellen kann.

Die Frau hatte Nachteile für die anderen Schüler befürchtet. Das Bremer Verwaltungsgericht sieht das anders.
Ob ein Kind auf eine Regelschule oder auf eine Förderschule gehen sollte, wird deshalb heute auch von anderen Faktoren abhängig gemacht, zum Beispiel wird das Verhalten des Kindes beobachtet, die Eltern werden befragt. Wie stehen Sie dazu?
Ich kritisiere die sonderpädagogische Diagnostik, weil sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt greift, weil sie einmalig stattfindet und regelmäßig zur Sonderschulüberweisung führt. Damit entscheidet sie über die gesamte Bildungskarriere und steht dem Prinzip der Entwicklungsoffenheit entgegen. Es ist zwar vorgesehen, dass Lehrkräfte an Sonderschulen die Kinder weiterhin beobachten und sie wieder an eine Regelschule zurückführen, wenn sich ihre Leistung bessert. Aber das passiert quasi nie. Für gewöhnlich verbleiben die Kinder an den Sonderschulen und anschließend in Sonderarbeitswelten.
Woran liegt das?
Die Sonderpädagogik ist auf die Existenz von separaten Sonderschulen ausgerichtet. Es fängt damit an, dass zwischen den beiden Systemen kaum kommuniziert wird. Ein weiteres Problem ist, wenn Kinder an Sonderschulen nicht auf allgemein qualifizierende Abschlüsse vorbereitet werden - wie sollten sie da jederzeit die Schule wechseln können? Regelschullehrkräfte fühlen sich schnell überfordert, wenn sie diese Schüler aufnehmen. Noch dazu ist es ja so: Sonderschulen brauchen Schüler, damit sie nicht geschlossen werden. Jeder Schüler, der einmal da ist, wird in der Regel auch gehalten.
Gehen Sie denn davon aus, dass potenziell jedes Kind einen Schulabschluss erreichen kann?
Wir wissen aus international vergleichender Forschung, dass Kinder mit Lernschwächen und niedrigem IQ sehr viel häufiger allgemein qualifizierende Zertifikate erreichen, wenn sie in einem gemeinsamen System unterrichtet werden. Teilweise erreichen Kinder mit Down-Syndrom allgemeine Schulabschlüsse oder nehmen - wie im Fall von Pablo Pineda - sogar ein Grundstudium auf. Solche Entwicklungsmöglichkeiten sind im deutschen System gar nicht mitgedacht. Aber Kinder mit Behinderungen können unerwartet Lernfortschritte machen, wenn sie nicht diskriminiert und angemessen gefördert werden.
Nenad Mihailovic ist nicht behindert. Ein Intelligenztest vor zwei Jahren hat gezeigt, dass der junge Mann durchschnittlich intelligent ist. Er hat seinen qualifizierten Hauptschulabschluss mit Bestnoten nachgeholt. Wie kann es sein, dass das über Jahre niemandem auffällt?
Ich glaube, die Sonderschule ist als System nicht in der Lage, das zu erkennen. Sie schaut schon mit Diagnosen auf die Kinder, anstatt sie als entwicklungsoffene Wesen zu beobachten und nach ihren Interessen und Stärken zu suchen. Der Fall zeigt, dass es dringend notwendig ist, die strikte Trennung zwischen den Systemen aufzulösen und die Kinder zumindest am gleichen Ort zu unterrichten, damit sie einfach die Klasse oder Lerngruppe wechseln können und weitere Lehrkräfte involviert werden.
Die Familie von Nenad Mihailovic war erst kurz vor seiner Einschulung aus Serbien nach Deutschland eingewandert. Möglicherweise hat er die Fragen der Gutachter gar nicht verstanden, die ihn als behindert eingestuft haben. Ist so eine krasse Fehlentscheidung nicht doch einfach nur ein tragischer Einzelfall?
An Förderschulen sind Kinder und Jugendliche nicht deutscher Herkunft deutlich überrepräsentiert. Mit einer natürlichen Verteilung von Intelligenz lässt sich das nicht erklären, eher mit institutioneller Diskriminierung. Die Muttersprache spielt eine Rolle; vor allem aber die soziale Situation, in der die Kinder aufwachsen: Kinder aus ökonomisch benachteiligten Familien sind das Hauptklientel von Sonderschulen, weil die Eltern sich nicht gegen die Schulüberweisungen zur Wehr setzen können oder inklusive beziehungsweise integrative Schulplätze fehlen.
Das verweist auch auf das alte Dilemma, dass Eltern mit niedrigem Bildungsstand ihren Kindern nicht die gleichen Chancen bieten können wie Akademiker. Wie kommen wir da heraus?
Oft verfügen Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund, erwerbslose oder psychisch erkrankte Eltern sehr wohl über emotionale und verwandtschaftliche Ressourcen, ihre Kinder zu unterstützen - diese werden jedoch häufig übersehen und nicht in die Förderung integriert. Dazu braucht es interkulturelle Kompetenzen in der Pädagogik. Eltern können eingeladen werden, die Schule ihrer Kinder mitzugestalten. Zudem kann ein Ganztagsbetrieb mit kulturellen und therapeutischen Angeboten, die Ressourcenlage von Familien kompensieren. Ganz aufheben lässt sich das Dilemma jedoch nicht. Es kommt aber darauf an, es nicht durch schulische Segregation weiter zu verstärken.