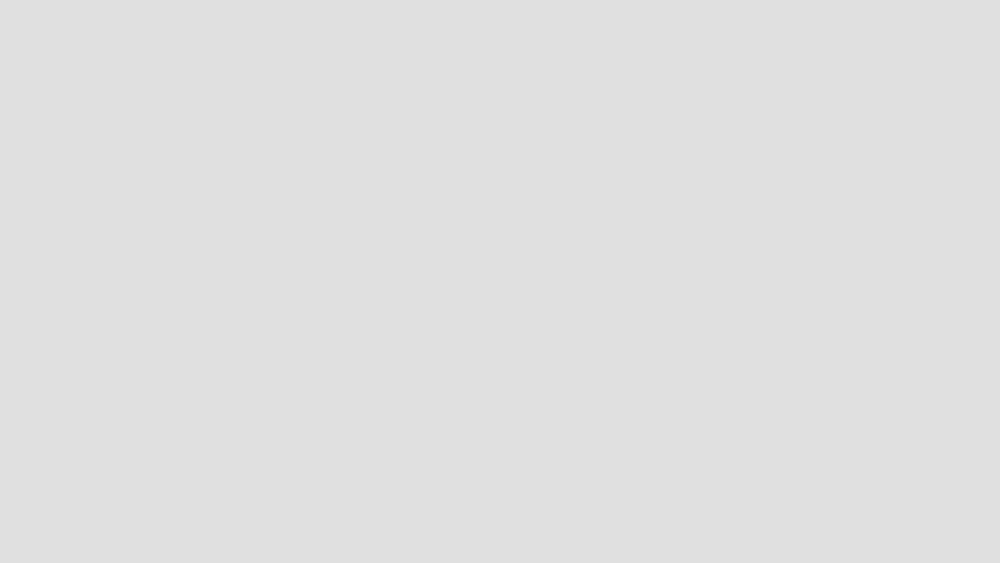Nichts ist leichter, als seine Ernährung zu einer komplizierten mathematischen Angelegenheit zu machen. Das gilt nicht nur für jene Menschen, die penibel ausrechnen, wie viel Gramm Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett auf dem Teller landen dürfen. Sondern auch für diejenigen, die wissen: Was immer man auch isst, man schadet damit auf irgendeine Weise der Umwelt. Jedes gekaufte Nahrungsmittel muss schließlich produziert oder wenigstens angebaut und geerntet werden, außerdem oft noch verpackt, gelagert und in den Laden gebracht. Das alles kostet Ressourcen wie Wasser, Energie und Ackerfläche. Wer sich umweltfreundlich ernähren will, achtet darauf, den Verbrauch dieser begrenzten Güter möglichst gering zu halten. Und damit fängt sie an, die höhere Mathematik der Ernährung.
Denn woran bemisst sich die Umweltverträglichkeit einer Mahlzeit? Ist die benötigte Energiemenge wichtiger als die Menge an Treibhausgasen, die durch die Produktion einer Packung Spaghetti entstehen? Oder sollte es vor allem um das Ackerland gehen, das zum Anbau von Mais und Soja benötigt wird, damit das Rind genug Futter hat, um später zum Steak zu werden?
Stopp. Keiner dieser Faktoren sagt alleine etwas über die Umweltfreundlichkeit eines Lebensmittels aus. Vielmehr braucht es dazu einen - Achtung, jetzt kommt ein reichlich abgedroschener Begriff - ganzheitlichen Ansatz. Doch ganzheitlich bedeutet in diesem Fall: alle Vorgänge, Emissionen und Ressourcen zu erfassen, die relevant für die Umwelt sind. Manchmal spielt dabei der Transport des Produkts die größte Rolle, manchmal seine Herstellung oder die Zubereitung beim Verbraucher. Das alles einbeziehen sollen die sogenannten Ökobilanzen oder, in der Sprache der Wissenschaftler, eine Lebenszyklusanalyse (life cycle assessment, LCA).
Den Startpunkt für diese Berechnungen stellt der Moment dar, in dem die benötigten Rohstoffe entnommen werden. "Für Gemüse kann das zum Beispiel die Gewinnung von Phosphat sein, das für Dünger benötigt wird", sagt Niels Jungbluth. Er ist Geschäftsführer der Schweizer Firma Esu-Services, die für Unternehmen Ökobilanzen unter anderem zu Nahrungsmitteln erstellt. Den Endpunkt einer Ökobilanz-Berechnung bilden Schadstoffe, die in die Luft gelangen oder durch Verbrennung der Abfälle entstehen, oder das, was letztendlich auf der Deponie landet. "Bei einzelnen Produkten wie einem Apfel kann man die Bilanz auch nur bis zum Laden rechnen, der das Obst verkauft, um verschiedene Varianten miteinander zu vergleichen", sagt Jungbluth.
So fließen Hunderte oder gar Tausende einzelne Faktoren in eine sorgfältige Ökobilanz ein. Sie werden gegeneinander abgewogen, miteinander verrechnet und ihre Wechselwirkungen berücksichtigt. Doch selbst dabei gilt noch: "Man muss Vereinfachungen machen", sagt der Umweltingenieur Stephan Pfister von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Das Ergebnis ist eine lange Reihe von Werten, die viele Verbraucher erst einmal verwirren dürften: Angaben zur Feinstaub-Emission zum Beispiel und dem Ausstoß toxischer Substanzen und natürlich dem der Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid, Methan und Lachgas.
Eine komplexe Sache also, die viele Konsumenten vielleicht nicht in allen Details, aber doch grundsätzlich interessiert. Immerhin trägt die Ernährung zu etwa einem Drittel zu allen Umweltauswirkungen bei, die durch privaten Konsum entstehen. Und fast drei Viertel der Verbraucher in Deutschland sind der Meinung, selbst großen Einfluss auf umweltfreundliche Lebensmittel zu haben. Das hat zu Jahresanfang eine repräsentative Umfrage des Umweltbundesamtes und der Verbraucherzentralen ergeben.
Allerdings haben andere Untersuchungen auch gezeigt, dass sich viele Menschen das komplizierte Thema der Ökobilanzen vereinfachen - indem sie das, was gemeinhin als gesunde Ernährung gilt, pauschal auch mit einer umweltfreundlichen gleichsetzen. In vielen Fällen kommt das tatsächlich in etwa hin. Doch bei manchen Lebensmitteln bringen Ökobilanzen erstaunliche Ergebnisse.
Zum Beispiel, wenn es um Wasser geht. Das trinken die Deutschen, verglichen mit den Bewohnern anderer Länder, auffallend gern aus Flaschen anstatt aus der eigenen Leitung. Dem Geschmack mag das entgegenkommen - der Umwelt aber nicht, wie Jungbluths Firma vor einigen Jahren errechnet hat. Demnach ist Trinkwasser aus dem Hahn hundertmal umweltfreundlicher als die gleiche Menge eines Mineralwassers, das aus der Region stammt.
Verglichen mit einem aus dem Ausland importierten Mineralwasser, schneidet das Leitungswasser sogar rund tausendmal besser ab. Den Ausschlag geben dabei der Transport des Getränks, seine Verpackung und eventuell die Kühlung - alles zusammen vermiest dem Mineralwasser die Bilanz.
Auch über die Art, wie er ein weiteres beliebtes Getränk zu sich nimmt, sollte nachdenken, wer es mit umweltfreundlicher Ernährung ernst meint: Kaffee. Auf dessen Produktion und Transport hat der Verbraucher zwar kaum direkten Einfluss. Doch maßgeblich für die Ökobilanz ist, wie eine Tasse zubereitet wird. In der Kaffeemaschine, die vielleicht noch permanent auf Stand-by steht? Ganz schlecht. Viel besser sei es, so hat die Firma Esu-Service analysiert, jede Tasse einzeln und per Handfilter aufzubrühen und das Wasser dafür im Heißwasserkocher zu erhitzen.
Die weiteren Tipps der Experten klingen eher simpel, sind aber dennoch wirkungsvoll: nicht unnötig viel Kaffee oder Wasser nehmen, die Packung der Bohnen oder des Pulvers recyceln - und den Kaffee mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause bringen. Wer für seinen Kaffee mit einem geländetauglichen SUV durch den Großstadtstau zum nächsten Bioladen fährt, setzt die Ökobilanz schon allein damit um einige Punkte herunter.
Apropos Bioladen: Was ist dran an der gefühlten Wahrheit, dass Bio-Lebensmittel grundsätzlich umweltfreundlicher sind als konventionell erzeugte? Die kurze Antwort lautet: Grundsätzlich stimmt diese Daumenregel. Bezogen auf den Landbau zum Beispiel ist die Sache recht eindeutig, wenn es um den Energieverbrauch pro Fläche geht. Der Bio-Landbau benötigt laut dem Bayrischen Umweltministerium knapp sieben Gigajoule pro Hektar Land, die konventionelle Variante hingegen gut 19 Gigajoule pro Hektar. Die Unterschiede ergeben sich zum Beispiel aus dem unterschiedlichen Einsatz von mineralischem Dünger und Futtermitteln.
Doch wie das eben so ist mit Daumenregeln: "Sie gelten nicht für alle Fälle", sagt Michael Bilharz vom Umweltbundesamt. "Letztlich muss man immer den Einzelfall sowie die für die Ökobilanzen zu Grunde gelegten Annahmen betrachten." Und diese Annahmen unterscheiden sich oft zwischen den verschiedenen Berechnungen. "Es gibt zwar eine Iso-Norm für Ökobilanzen, aber die lässt noch einen breiten Spielraum", sagt Niels Jungbluth. "Deshalb können verschiedene Ergebnisse herauskommen, wenn zwei Gruppen eine Ökobilanz für das gleiche Produkt erstellen. "
Das liegt vor allem an der unterschiedlichen Gewichtung einzelner Faktoren, für die es wissenschaftlich keine eindeutige Aussage gibt. Ein typisches Beispiel ist die Haltung von Kühen als Grundlage der Produktion von Milch, Käse und Fleisch. Wie viel des Methanausstoßes der Tiere und des Landverbrauchs, der für den Futteranbau nötig ist, soll man den einzelnen Produkten zuordnen? "Da gibt es kein allgemeingültiges richtig oder falsch", sagt Jungbluth. Hinzu kommt, dass Ökobilanzen ursprünglich für die Industrie gedacht waren - und die hat eigene Interessen, die in die Interpretation der jeweiligen Analyse mit eingehen dürften.
Und es geht noch komplizierter: Mitunter fließt die Jahreszeit in die Ökobilanz ein - und bringt zunächst irritierende, intuitiv nicht verständliche Ergebnisse. Ein Beispiel dafür sind Äpfel. Kann es sein, dass Äpfel aus Argentinien oder Neuseeland ebenso umweltfreundlich sind wie das heimische Obst? Durchaus. Die importierten Früchte müssen zwar mit dem Schiff nach Deutschland transportiert werden. Dafür entfällt bei ihnen die monatelange Lagerung im Kühlhaus, die heimische Äpfel im Sommer benötigen. Was also folgt daraus für alle, die es ganz genau nehmen? Von Herbst bis etwa April sind heimische Äpfel aus Umweltsicht günstiger. Den Rest des Jahres spielt die Herkunft so gut wie keine Rolle. Vorausgesetzt, man bedenkt auch noch die Größe des Betriebes - die schlägt sich nämlich ebenfalls in der Bilanz nieder. Vereinfacht gesagt, benötigen große Unternehmen oft weniger Energie für Anbau, Ernte und Transport als kleine Familienbetriebe.
Kritik an Ökosiegeln
Damit man sich nicht bei jedem Einkauf mit derart komplexen Überlegungen herumschlagen muss, galten einst sogenannte Ökolabel als die beste Lösung. Sie sollen dem Verbraucher auf einen Blick die Umweltverträglichkeit eines Lebensmittels garantieren. Doch schon bald wurde Kritik laut. Unter anderem, da sich die Label stark auf den Kohlenstoff-Ausstoß konzentrieren. "Natürlich ist der wichtig, und oft korreliert er auch mit anderen Faktoren", sagt der Schweizer Experte Pfister. Trotzdem ist er nur ein Faktor unter vielen und damit nur bedingt geeignet, um die Ökobilanz insgesamt einzuschätzen.
Zudem suggeriere ein solches Label für den "Kohlenstoff-Fußabdruck" eines Lebensmittels eine gesicherte Erkenntnis - für die aber oft die Daten fehlen. "Die Resultate einer Ökobilanz sind oft mit großer Unsicherheit behaftet", sagt Pfister. "Das ist schwierig für die Kommunikation gegenüber dem Verbraucher." Und nicht zuletzt fürchten Kritiker, dass vor allem große Konzerne ein Öko-Label als Werbung nutzen würden - weil nur sie es sich leisten können, die Umweltverträglichkeit ihrer Produkte analysieren zu lassen.
Was also soll der Verbraucher tun, der mit seiner Ernährung auf die Umwelt achten, sich aber auch nicht stundenlang mit Fachliteratur und komplexen Berechnungen herumschlagen möchte? Und sich vor allem den Genuss am Essen auch nicht nehmen lassen will? Keine Angst, die Tipps der Experten sind erstaunlich überschaubar und simpel - auch wenn abermals alle betonen, dass es sich auch dabei nur um Faustregeln handelt. Ihnen zufolge beinhaltet eine umweltverträgliche Ernährung:
- Wenig Fleisch: Die Viehhaltung und der Anbau der Futtermittel treiben die Ökobilanz tierischer Produkte in die Höhe. Als umweltfreundliche Eiweißquelle eignen sich zum Beispiel Bohnen. Käse schneidet zwar besser ab als Fleisch, ist im Hinblick auf seine Ökobilanz aber auch nicht ganz ohne. Auch Fisch sollte nicht allzu oft auf den Teller kommen.
- Saisonale Produkte aus heimischer (Bio-)Produktion: Das Beispiel der Äpfel zeigt: Auch wenn die Äpfel aus heimischem Anbau stammen, nützt das für deren Ökobilanz im Hochsommer wenig. Nur wenn man die Kriterien saisonal und regional kombiniert, tut das der Umwelt gut. Außerdem gilt: Egal, ob es sich um ökologischen oder konventionellen Anbau handelt - Obst und Gemüse aus dem Freiland schneiden besser ab als Lebensmittel aus einem Gewächshaus, das beheizt werden muss.
- Keine Flugware: Importierte Produkte sollten am besten mit dem Lastwagen oder allenfalls dem Schiff nach Deutschland gebracht werden - nicht jedoch per Flugzeug. Eingeflogen werden zum Beispiel meist tropische Früchte. Äpfel hingegen kommen per Schiff aus Übersee zu uns.
- Keine Verschwendung: Das gilt sowohl für die Lebensmittel selbst wie auch für die Energie, die für die Zubereitung nötig ist. Ein Drittel der gesamten Nahrungsmittelproduktion landet auf dem Müll, und allein in Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen Nahrung weggeworfen. Wer hilft, diesen Müll zu reduzieren, tut nicht nur der Umwelt einen Riesengefallen.