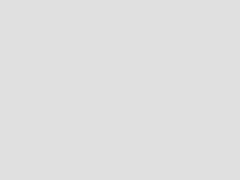So viel Ende war nie. Es wird also feierlich zugehen, wenn Deutschlands letzte Steiger und Hauer kommende Woche unterm Förderturm von Bottrop ihrem Bundespräsidenten ein allerletztes Stück Kohle überreichen. Frank-Walter Steinmeier wird sich wortreich bedanken und von der Ära sprechen, die nach mehr als zwei Jahrhunderten Steinkohle-Bergbau am 21. Dezember ausläuft. Er wird die Schufterei in Staub und Dreck, die Maloche, loben. Und die Tugenden preisen, mit denen man unter Tage überlebte und die die Menschen im Ruhrgebiet bis heute prägen: ihre Gradlinigkeit, ihren Anstand, ihre Solidarität. Dann ist Schicht im Schacht, endgültig.
Genau genommen markiert dieser Freitag das Ende vom Ende. Den Abschied vom Abschied: Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert schließen die Zechen im "Pott". Was die Menschen in der Region davor über Generationen zu Tage gefördert hatten, veränderte die Welt. Die Kohle von der Ruhr war das Fundament für Deutschlands Industrialisierung und seinen Aufstieg auch zur politischen Großmacht. Das schwarze Gold schuf Wohlstand - und befeuerte zwei Weltkriege und Katastrophen, die all dies zerstörten. Die Kohle war Treibstoff für Untergang und Neuanfang, auch für das Wirtschaftswunder der jungen Bundesrepublik. Die Republik dankte mit Milliarden, zeitweise verbrannte jeder Arbeitsplatz im Bergbau 80 000 Euro Staatszuschuss. Jedes Jahr. Niemand sollte abstürzen, also "ins Bergfreie fallen".

Jetzt aber wirklich: 2019 soll in Deutschland der Durchbruch der E-Autos kommen. Fünf Argumente, die für ein elektrisches neues Jahr sprechen.
Und nun? Nun muss das Revier ohne den Rohstoff auskommen, auf dem es gegründet wurde. Die Kohle ist verbrannt, die Region muss lernen, "Asche zu machen" aus dem, was bleibt. Also umdenken und Geld verdienen in neuen Jobs, in anderen Betrieben und Branchen.
Strukturwandel nennt man diesen mühsamen, schmerzhaften Anpassungsprozess. Den durchleben und durchleiden die mehr als fünf Millionen Menschen im Ruhrgebiet seit nunmehr bald zwei Generationen. Vieles gelang, manches scheiterte, fertig ist nichts. Die Arbeitslosenquote dümpelt knapp unter zehn Prozent, in Duisburg und Essen, Gelsenkirchen oder Dortmund lebt jeder Fünfte von Hartz IV.
Was Wunder, dass sich da mancher in Nostalgie flüchtet. Monumente des Erinnerns gibt es genug. Die Denkmäler vergangener Industriekultur - erkaltete Hochöfen, luftige Gasometer, versiegelte Schachtanlagen - sind touristische Attraktionen. Zugleich liegt über der Region der Fluch des Förderturms: Das mächtige Stahlgerüst mit den zwei Seilscheiben von Zeche Zollverein in Essen dient der Region als Symbol ihrer Vergangenheit. Leuchttürme der Zukunft hingegen hat das Ruhrgebiet noch nicht für sich entdeckt.
Hunderttausende Menschen arbeiten hier täglich in modernsten Jobs. Die Mentalität jedoch ist die alte geblieben. Man ist bescheiden, verachtet jeden "Stuss", verabscheut unnötige "Fissematenten". Man genügt sich selbst, in stillem Stolz. Der Schriftsteller Frank Goosen hat dieses Selbstgefühl vor Jahren in einem Satz verdichtet: "Woanders is' auch scheiße." Das klingt sympathisch, weil lakonisch. Aber als ein Motto, das jeder "Ruhri" kennt, ist es eben auch schrecklich fatalistisch. Und bar jeder Ambition.
Gründergeist anstatt Stahlwerken
In Wirklichkeit ist das Ruhrgebiet längst weiter. Vor gut 50 Jahren gab es hier 300 000 Kumpel und keine Studenten - heute ist es umgekehrt. In einer Region, wo einst der Sohn im selben Stahlwerk oder auf demselben Pütt wie Vater und Großvater anfing, weht Gründergeist. Vor allem im Umfeld der 22 Hochschulen gedeihen Start-ups. Bochum etwa erlebt bereits seinen dritten Strukturwandel: Auf jenem ehemaligen Zechengelände, wo Opel von den Sechzigerjahren bis 2015 Kadetts und Zafiras montieren ließ, siedeln sich nun Firmen und Institute für IT-Sicherheit an. In zwei Jahren wird der Standort doppelt so viele Jobs beherbergen, wie Opel kurz vor Toresschluss bot. Dortmund und Duisburg profilieren sich derweil als Logistikzentren, Gelsenkirchen wird gerade digitale Modellstadt.
Das ist die eine, die sonnige Seite. Im Schatten liegen Probleme, die das Ruhrgebiet seit Jahrzehnten plagen, die es nicht selbst lösen kann - und mit denen es bisher alleingelassen wird. Auch das mag an der falschen Bescheidenheit der Menschen liegen: Die Zeiten, da die Regierungen in Berlin oder Düsseldorf das Feuer einer "brennenden Ruhr" befürchteten, sind längst vorbei. Protestiert wird allenfalls "stickum", also heimlich, still und leise: per Votum für die AfD.
Viele Städte leiden unter milliardenschwerer Schuldenlast
Der alte Westen wurde zum Opfer des neuen Ostens. Das spürt jeder, der in NRW über Autobahnen oder Bundesstraßen holpert. Nach dem Fall der Mauer 1989 strömte alle nationale Solidarität in die neuen Bundesländer. Auch die Revierstädte zahlten damals in den Fonds Deutsche Einheit, oft auf Pump. Eine milliardenschwere Schuldenlast erdrückt die ärmsten Städte an Emscher und Ruhr, verhindert ihre Investitionen in die Zukunft, also in Kindergärten und Schulen. Die Regierungen in Berlin und Düsseldorf könnten dem Revier leicht Luft verschaffen und die Altschulden in einen Sonderfonds umschichten. Tun sie aber nicht.
Noch übler im Stich gelassen wird das Ruhrgebiet mit einer anderen Folge des Strukturwandels. Dort, wo nach dem Zechentod die Malocher wegzogen, fanden die Schwächsten ihre Bleibe mit bezahlbarer Miete: Arbeitslose, Hilfsarbeiter, Flüchtlinge. Halbe Stadtteile verkommen zu Zonen inländischer Abschiebung, zu Ghettos. Und diese Armut ist erblich: Kinder, die hier zur Schule gehen, haben kaum eine Chance aufs Abitur. Das ist Klassen-Bildung, mitten in Deutschland.
Deshalb sollte das Ruhrgebiet genau hinhören am kommenden Freitag. Berlin und Düsseldorf dürfen dieses Stück Deutschland nicht abspeisen mit wohlfeilen Worten zu seiner Geschichte. Das Revier will nach vorn, mit Schmackes und Elan. Aber ohne Hilfe zur Selbsthilfe werden die Nachfahren der Kumpel nie in der Zukunft ankommen.