"Das deutsche Heer und das deutsche Volk wollten den Sieg im Westen als den schnellsten Weg zum Frieden." So beginnt in diesem Buch ganz ernsthaft das Kapitel "Ludendorffs Hammer" über die letzte deutsche Großoffensive in Frankreich 1918.
Wirklich?
"Das deutsche Heer" war trotz Verstärkungen aus dem Osten ausgezehrt, Unzufriedenheit und Apathie griffen in den Reihen der Soldaten um sich, wenige Monate später machten sie Revolution.
Die Siegermächte beschuldigt
"Das deutsche Volk" war tief gespalten; eben erst, im Januar, hatten Militär und Polizei einen Massenstreik vieler Hunderttausender in der Kriegsindustrie unterdrückt, dessen Ziel ein Verständigungsfrieden war und ein sofortiges Ende des Gemetzels an den Fronten.
Die Überspitzung hat Methode in Holger Afflerbachs "Auf Messers Schneide". Der in England lehrende Historiker fragt darin, ob die Niederlage Deutschlands gegen die Ententemächte wirklich so unausweichlich war, wie dies im Rückblick erscheint; ob all die gescheiterten Friedensbemühungen, auch aus Deutschland, denn von vorn herein zum Scheitern verdammt waren.
Afflerbach verneint diese Fragen - und beschuldigt die Sieger. Im Nachwort beklagt er "die verbissene und ungeheuer schädliche alliierte Siegfriedensstrategie, die letztlich diese ,wahnsinnige Selbstzerfleischung Europas' zu verantworten hatte".
Vielleicht ist es nur die Lust an der provozierenden These. Solche Sätze jedoch klingen, als habe man sie 1928 verfasst und nicht 2018: Schuld sind "letztlich" die anderen - nicht nur sie, aber vor allem.
Dabei hätte sich mit diesem flüssig geschriebenen Buch eine interessante Chance eröffnet: Es löst die Erzählung des Krieges von der Fixierung auf Deutschland und stellt sie in den europäischen Kontext. Hier prallen ja zwei Sichtweisen aufeinander, die noch immer erstaunlich wenig Gemeinsamkeiten besitzen. So erging es Christopher Clark 2014 mit "Die Schlafwandler".

Am 3. März 1918 endet der Erste Weltkrieg an der Ostfront offiziell. Zuvor verhandeln in Brest-Litowsk zwei skurril unterschiedliche Delegationen.
Clark selber scherzt gern, in Deutschland verteufele man ihn als Rechten, der die Schuld des Kaiserreichs am Kriegsausbruch kleinschreibe (und mit dieser Relativierung indirekt auch den Nationalsozialismus, der Rache suchte für 1918); in Großbritannien dagegen gelte er als unpatriotischer Linker, weil er die Saga vom ersten guten Krieg der freien Welt gegen die "Hunnen", dem 1939 der zweite folgte, nicht mitsinge.
In diesem Kontext lässt sich Afflerbachs Buch eher verstehen. Er lehrt in Leeds, und in der britischen Geschichtswissenschaft lässt eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Empire 1914 bis 1918 noch vieles zu wünschen übrig.
Gewiss war auch die Politik der Alliierten oft fragwürdig - von 1914, als Frankreich und Russland kaum weniger zum Krieg drängten als das Deutsche Reich, über viel nationalistischen Furor bis zu 1918/19, als die Westmächte die neue demokratische Reichsregierung für die Sünden des Kaiserreichs büßen ließen. Und gewiss hat genau dies, wie Afflerbach an etlichen Stellen schildert, der Friedenspartei in Deutschland geschadet.
Genau hier aber zeigt sich eine entscheidende Schwäche von "Auf Messers Schneide". Meist nennt der Autor Fehler der Alliierten als Ursache statt als Folge der deutschen Hybris, diesen Krieg mit einem "Siegfrieden" beenden zu können.
Die sogenannten Eliten des Kaiserreichs aber kümmerte es während der langen Kriegsjahre wenig, was die Feinde wollten und wie man mit ihnen einen Weg zum Frieden finden könnte.
Die Regierenden, die Oberste Heeresleitung (OHL), der Kaiser und der preußische Militarismus, hochaggressive Wirtschaftsverbände und entfesselte Alldeutsche wollten den Krieg schon 1914, als sie die SPD mit der Behauptung köderten, er diene nur der Verteidigung.
Sie stellten jedoch umgehend mit dem "Septemberprogramm" Kriegsziele auf, die das Reich zum Hegemon Europas gemacht hätten. Sie erklärten 1917 wider alle Ratio den unbeschränkten U-Boot-Krieg und trieben damit die USA aus der Rolle des Vermittlers in die jenes Gegners, dessen Eingreifen dann die Schlachten entschied.
Sie zwangen im März 1918 dem geschlagenen Russland in Brest-Litowsk einen Diktatfrieden auf, der Osteuropa faktisch zur Kolonie des Reiches machte und gegen den jede Zumutung verblasste, die Deutschland im Folgejahr durch den Versailler Vertrag ertragen musste. Und noch im Frühjahr 1918 suchten sie die Entscheidung im Westen.
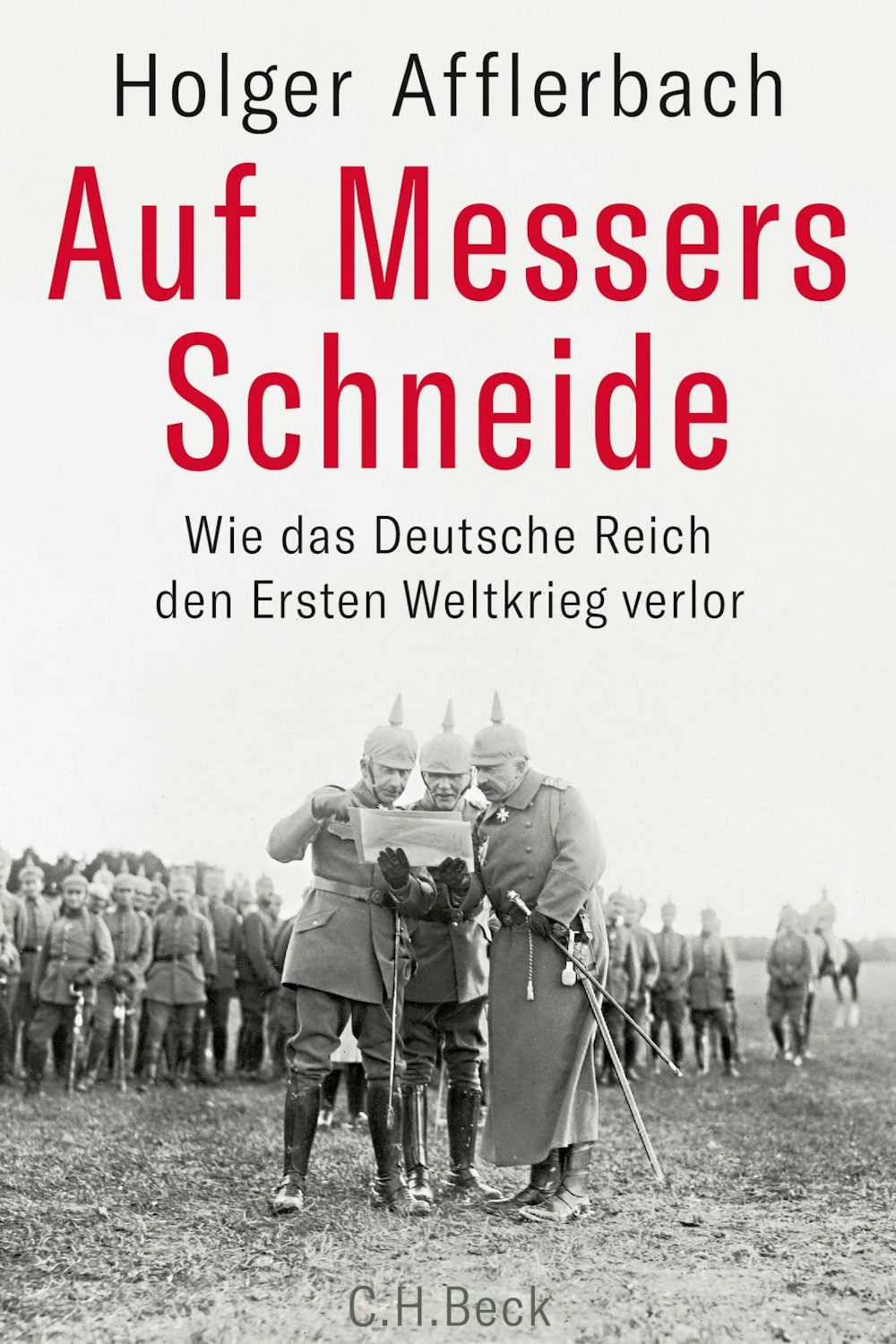
Afflerbach macht dagegen geltend, "nur durch die sehr kräftige Hilfe der Kriegstreiber der Entente" sei in der deutschen Führung, allen voran der übermächtigen OHL, eine verhängnisvolle "Kurzsichtigkeit der in panischer Ratlosigkeit agierenden Personen" entstanden.
Die deutsche Politik der Eroberungen und des Krieges bis zum Sieg war jedoch nicht Panik, sondern Programm; wenn auch kein im Detail kohärentes. Sie war es von der Vorkriegszeit bis zum Herbst 1918, als alle Bündnispartner längst geschlagen waren und die Westfront vor dem Kollaps stand, den man nicht länger durch Durchhalteparolen hinauszögern konnte.
Mag sein, dass es bis 1917 die Option eines militärischen Pattes gab, wie Afflerbach herausarbeitet. Aber es war doch die deutsche Seite, welche diese Option gar nicht wollte und verhinderte. Es war die OHL, die den Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg wegbiss, weil er aus ihrer Sicht ein zum Frieden schwankender Wackelkandidat war.
Es ist nicht so, dass Afflerbach diese Tatsachen verschweigt oder schönredet, er geht hart mit dem kaiserlichen Deutschland ins Gericht. Aber er gewichtet sie zu gering, und warum er das tut, ergibt sich aus einem verräterischen Wort: Er will gegen ein "dominantes Narrativ" anschreiben, eben das patriotische britische und selbstkritische deutsche; letzteres geht auf den großen Hamburger Historiker Fritz Fischer zurück, der 1961 dem Kaiserreich aus guten Gründen bescheinigte, es habe im Krieg den "Griff nach der Weltmacht" versucht.
Vieles, was Fischer beschrieb, ist längst herrschende Lehre unter den Historikern, für Afflerbach aber "Narrativ". Ach - es ist das Modewort der Zeitgeschichte; wer ein Narrativ als solches entlarvt oder dies zu tun behauptet, nimmt den Gestus des großen, mutigen Aufklärers ein, der die Wahrheit findet hinter einer manipulierten, interessengesteuerten Erzählung der Mächtigen und Meinungsmacher. Wozu diese Haltung führen kann, sieht man leider hier - mindestens zu überpointierten, einseitigen Schlüssen.
Was zählt, ist die Ursache der Erhebung
Rätselhaft ist auch Afflerbachs Behandlung der Novemberrevolution in Deutschland, die ja binnen Tagen das Herrschaftsgefüge des Wilhelminischen Reiches davonfegte. Ihr widmet er kaum ein paar Sätze, die in das Urteil fließen: "Das Heer gehorchte nicht mehr; ob man die Vorgänge als Massenkampfverweigerung, Meuterei, Militärstreik oder Revolution bezeichnen will, ist zweitrangig, was zählt, ist das Resultat, nämlich die zunehmende Handlungsunfähigkeit der deutschen Führung."
Aber es ist nicht zweitrangig, ob die Matrosen der Hochseeflotte 1918 "Meuterei" begingen oder sich den Plänen der Seekriegsleitung zu einer Nibelungenschlacht auf See, um "mit wehenden Fahnen unterzugehen", mutig verweigerten.
Und was zählt, ist doch nicht das Ergebnis der Erhebung, sondern vor allem deren Ursache: der Versuch der reaktionären Marineführung, durch dieses letzte Gefecht die Friedensbemühungen der neuen Regierung unter Prinz Max von Baden zu torpedieren, im buchstäblichen Sinne des Wortes. Und den Handlungsspielraum, den die Revolution "verengte", hatten die Verantwortlichen vier Kriegsjahre lang nicht genutzt; im November 1918 war davon ohnehin wenig übrig.
Gewiss, etliche Alliierte fürchteten, die Deutschen würden den Kampf jahrelang auf eigenem Boden fortsetzen und sich zäh verteidigen. Aber die deutschen Truppen waren am Ende; Kaiser und Kriegsherren verloren in jenem Herbst täglich an Autorität. Es war zu spät, und diesen Herren blieb eigentlich nichts mehr, als den Giftcocktail der Niederlage zu leeren.
Nicht einmal das taten sie, die zuerst von Paul von Hindenburg geschaffene Dolchstoßlegende der OHL machte die demokratischen Parteien für alles Elend verantwortlich, das Männer wie er verursacht hatten.
Bei all dem hätte es einen sehr sicheren Weg für die Regierenden des Deutschen Reiches gegeben, diesen Krieg nicht zu verlieren: Sie hätten ihn einfach vermeiden können.

