Klimaklagen sind längst ein weltweites Phänomen, das Sabin Center for Climate Change Law an der Columbia Universität in New York zählt fast 3000 solcher Verfahren, davon gut zwei Drittel in den USA. Das ist eine eher großzügige Rechnung. Mitgezählt werden neben Verfahren, bei denen es um die Reduktion von Kohlendioxid geht, auch Prozesse rund um Biodiversität oder sauberes Wasser. Aber auch ohne Naturschutzklagen gibt es vielfältige juristische Ansätze, mit denen Kläger versuchen, dem Klimawandel per Gerichtsurteil Einhalt zu gebieten.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen meist Klagen gegen Regierungen, die zur wirksamen Begrenzung des Temperaturanstiegs verpflichtet werden sollen. Die weltweit einflussreichste Entscheidung dürfte der Karlsruher Klimabeschluss von 2021 sein, mit dem das Bundesverfassungsgericht zwar nur eine moderate Korrektur des Klimaschutzgesetzes verfügte, zugleich aber die Grundlage dafür legte, wie man den Klimaschutz als Grundrecht zu fassen bekommt. Bereits zwei Jahre zuvor hatte der Hohe Rat, das oberste Zivilgericht der Niederlande, die dortige Regierung spektakulär dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis Ende 2020 um 25 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, statt der angestrebten 20 Prozent. Und 2020 ordnete der französische Staatsrat an, die Regierung in Paris müsse eine wirksame Klimastrategie vorlegen.

Zentraler Maßstab für die Gerichte ist das Pariser Klima-Abkommen von 2015, also die Verpflichtung, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. In Deutschland sind mehrere Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängig. Die Aufmerksamkeit gilt vor allem zwei Verfahren, über die am 1. Februar 2024 verhandelt wird. Die aktuelle Änderung des Klimaschutzgesetzes macht die Klagen aus Sicht der DUH keineswegs obsolet; es müssten lediglich die Anträge an die neuen Regeln angepasst werden.
Auch mit Klagen gegen Unternehmen versuchen Klimaschützer, den Rechtsweg nutzbar zu machen. Hier hatte ebenfalls ein Fall aus den Niederlanden Furore gemacht. Vor gut zwei Jahren hat das Bezirksgericht von Den Haag den britisch-niederländischen Konzern Shell in erster Instanz dazu verdonnert, den Ausstoß von Kohlendioxid bis 2030 um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken. In der Schweiz haben Bewohner einer indonesischen Insel den Zementhersteller Holcim verklagt - als Mitverursacher eines Klimawandels, der ihren Lebensmittelpunkt bedroht. In Deutschland sind ähnliche Klagen bisher gescheitert. Die Landgerichte in Braunschweig, Detmold und Stuttgart sahen keinen rechtlichen Hebel, um VW und Mercedes den Vertrieb von Verbrennern bis 2030 zu untersagen. Die Kläger hoffen hier auf die nächste Instanz. Mit Spannung wird derweil der Ausgang eines Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Hamm erwartet. Ein peruanischer Bergführer hatte den Energiekonzern RWE verklagt, weil sein Haus wegen des - von RWE mitverursachten - Klimawandels von einer Flut bedroht sei. Das OLG war zur Beweisaufnahme sogar nach Peru gereist - was bedeutet, dass es die Klage jedenfalls nicht für gänzlich aussichtslos hält.
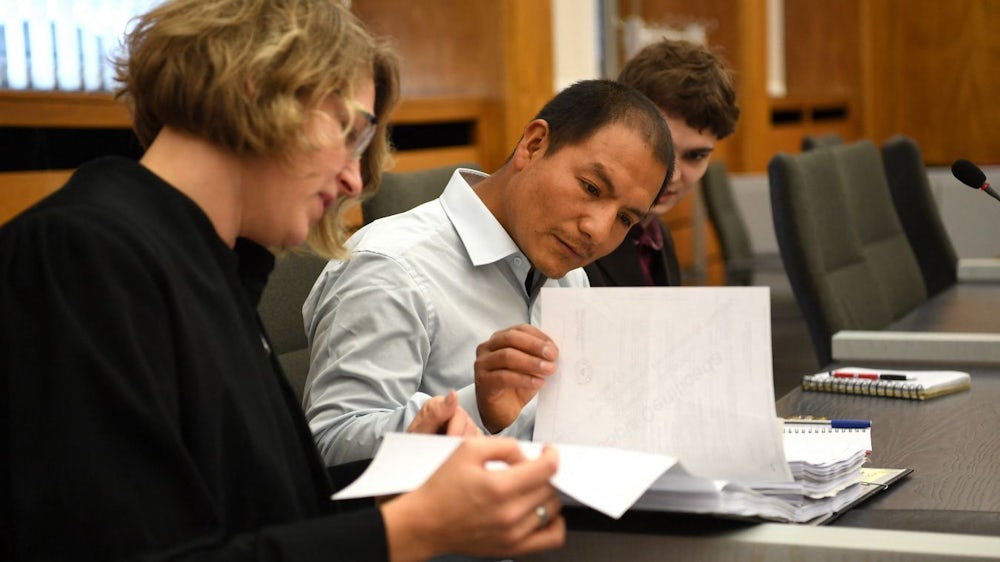
Ebenfalls gegen Unternehmen richten sich sogenannte Aktionärsklagen. Die Umweltorganisation Client Earth hatte Anfang des Jahres die Chefetage des Shell-Konzerns mit dem Argument verklagt, er habe seine Sorgfaltspflichten verletzt, weil er die Unternehmensstrategie nicht auf die Risiken des Klimawandels ausgerichtet habe. Ein Gericht in Großbritannien wies die Klage im Juli ab. In Deutschland sind solche Klagen sehr viel komplizierter, weil einzelne Aktionäre nicht direkt gegen den Vorstand klagen können. Allerdings können sie mit dem Klima-Argument die Entlastung des Vorstands anfechten, was immerhin einen Aufmerksamkeitseffekt brächte. "Bei solchen Anfechtungsklagen geht es vor allem um Symbolik", sagt Marc-Philippe Weller, Professor in Heidelberg.
Ein vergleichsweise neues Genre sind Klagen wegen Greenwashing, also gegen die irreführende Behauptung, ein Unternehmen wirtschafte klimaneutral. "Beim Klima sind die Maßstäbe der Gerichte streng", erläuterte die Wirtschaftsanwältin Juliane Hilf vor einigen Monaten in einem Vortrag. Das Unternehmen müsse eindeutig belegen können, warum ein Produkt klimaneutral sein solle. 2019 warb die Fluggesellschaft Ryanair im Vereinigten Königreich damit, sie sei die "lowest emissions airline", was ihr kurz darauf von der zuständigen Behörde untersagt wurde. Auch in Deutschland sind in zunehmendem Maß solche Klagen zu verzeichnen. Für die Gerichte ist dies vertrautes Terrain, denn die Klagen stützen sich auf das altbekannte Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Im Frühjahr gewann die DUH beispielsweise einen Prozess gegen Total Energies, das Unternehmen hatte mit CO₂-kompensiertem Heizöl geworben. Und vor Kurzem verurteilte das Landgericht Karlsruhe die Drogeriemarktkette dm auf DUH-Klage dazu, künftig auf den Begriff "klimaneutral" für Produkte wie Flüssigseife und Sonnenmilch zu verzichten; die Unterstützung eines Waldprojekts in Peru reiche für diesen Claim nicht aus.

Für europäische Ohren ungewohnt klingt die Idee, Ökosysteme als Rechtsperson anzuerkennen. Dieser Ansatz findet sich vor allem in Lateinamerika. Ecuador stattete 2008 die Mutter Erde - die Pachamama - mit eigenen Rechten aus; Bolivien folgte mit ähnlichen gesetzlichen Vorgaben. In Kolumbien hatte das Verfassungsgericht dem Atrato-Fluss den Status eines "Subjekts eigener Rechte" zuerkannt - zum Schutz vor Ausbeutung. Auch in Kolumbien und Guatemala gab es erfolgreiche Flussklagen. Ähnliches vollzog sich auf der anderen Seite des Planeten, zum Schutze des Whanganui-Flusses in Neuseeland sowie von Ganges und Yamuna in Indien. Und jüngst schlug der juristisch neue Ansatz erste Wurzeln in Europa. Einer spanischen Bürgerbewegung gelang es, die Lagune Mar Menor als Rechtsperson anerkennen zu lassen. Sie hat nunmehr das gesetzliche Recht auf "Schutz, Erhaltung, Instandhaltung und gegebenenfalls Restaurierung". Und weil eine Lagune nicht für sich selbst sprechen kann, wurden mit der Vormundschaft gleich drei Kommissionen betraut.
