Viele Menschen in unserer Gesellschaft haben Angst vor dem Einfluss von Islamisten. Andere warnen vor Evangelikalen in der US-Politik. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Martin Urban warnt in seinem neuen Buch vor einer weiteren, bedenklichen Entwicklung. Es geht um die deutsche evangelische Kirche, die im kommenden Jahr 500 Jahre Reformation feiert.
SZ: Sie sehen einen zunehmenden Fundamentalismus in der evangelischen Kirche in Deutschland. Woher rührt Ihre Sorge?
Martin Urban: Die Fundamentalisten gewinnen innerhalb der evangelischen Kirche immer mehr an Einfluss. Mit Fundamentalisten meine ich jene, die die Bibel wörtlich nehmen und deshalb zum Beispiel die Homosexualität und die Evolutionstheorie ablehnen oder die Prügelstrafe für Kinder für richtig halten.
Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) und evangelische Theologen haben sich in diesen Fragen doch wiederholt relativ liberal gezeigt.
Es findet ein heimlicher Kampf um die Vorherrschaft statt zwischen den aufgeklärten Liberalen in der EKD und den Fundamentalisten. Die Fundamentalisten schaffen es zunehmend auf hohe Posten wie Bischofsstühle. Neben den traditionell Konservativen wie in Bayern und in Württemberg wurde jüngst in Sachsen erstmals ein bekennender Evangelikaler zum Landesbischof gewählt. Mit Michael Diener, dem Vorsitzenden der Evangelischen Allianz - dem Dachverband der Evangelikalen - sitzt seit letztem Jahr ein Fundamentalist sogar im Rat der EKD. Der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, der ihn dort hin brachte, sagt, er erwarte sich viel von den Evangelikalen.
Und was ist mit den Liberalen?
Die Theologen, welche historisch-kritisch arbeiten, sind sehr leise geworden. Wenn einer von ihnen sich laut und deutlich über Erkenntnisse aus seiner Forschung äußert, muss er Konsequenzen fürchten. Der evangelische Theologe Professor Gerd Lüdemann etwa, der die Auferstehung Jesu öffentlich bestreitet und das wissenschaftlich begründet, darf deshalb keine Pfarrer mehr ausbilden.
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Es gehen immer weniger Menschen in die Kirchen. Und jene inzwischen unter vier Prozent der evangelischen Kirchensteuerzahler, die immer noch einen Gottesdienst besuchen, sind eher die älteren und konservativen Gläubigen. Sie bestimmen bei den Protestanten die Kirchenvorstände. Diese wählen die Mitglieder der Synoden, jene dann die Bischöfe. Also werden auch diese immer konservativer.
Deshalb wird immer weniger über die Inhalte diskutiert, die die Kirchen seit 2000 Jahren verkünden. Selbst wenn sie im Lichte heutigen Wissens falsch sind. Nehmen Sie zum Beispiel das Familienbild der Evangelikalen. Jesus selbst hatte eine völlig anderes Bild: Seine Familie waren nach den biblischen Aussagen seine Jünger, nicht seine Mutter und seine Halbgeschwister.
War die protestantische Kirche in der Vergangenheit tatsächlich weniger fundamentalistisch als heute?
Der protestantische Theologe Adolf von Harnack, Gründer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, heute Max-Planck-Gesellschaft, hat schon vor über hundert Jahren erkannt, dass das, was die Kirchen lehren, hinterfragt werden muss. Der Theologe Rudolf Bultmann hat Mitte des 20. Jahrhunderts eine Debatte zur Entmythologisierung des Neuen Testaments angestoßen. Durchgesetzt hat sich aber sein Kollege Karl Barth, der die Erkenntnisse der Historiker über die Bibel als irrelevant ablehnte.
Immerhin gab es damals Diskussionen. Heute wissen wir dank der historisch-kritischen theologischen Forschung und der Naturwissenschaften noch viel besser, dass die Aussagen der Bibel und des Glaubensbekenntnisses neu bewertet werden müssten. Dies geschieht aber nicht. Eine entsprechende Forderung richtet sich übrigens auch an die Muslime in Bezug auf den Koran.
Was für Aussagen in der Bibel meinen Sie zum Beispiel?
Man kann heute nicht mehr von Dingen reden, die biologisch oder physikalisch einfach nicht möglich sind. Etwa von einem Himmel über uns, in dem Gott thront, und mit uns kommuniziert, von einer Auferstehung Jesu von den Toten, von einer leiblichen Himmelfahrt oder einer Jungfrauengeburt. Die Vorstellung von einem Heiligen Geist und damit der Dreifaltigkeit Gottes ist unsinnig. Das erkannte schon Adolf von Harnack.

Schläge müssen weh tun: Kindererziehung mit dem Rohrstock hat in fundamentalchristlichen Kreisen Konjunktur - schließlich steht das so in der Bibel.
Jesus selbst kannte keinen dreifaltigen Gott. Dann hätte er ja sich selbst anbeten müssen. Auch die Vorstellung von göttlichen Offenbarungen sind falsch. Bei einer Offenbarung müsste ein "movens", eine Kraft von außen, auf unser Gehirn wirken, die erkennbar wäre, denn es gelten überall ausnahmslos die Naturgesetze.
Gott sollte es doch möglich sein, die Naturgesetze zu ignorieren. Dafür ist er schließlich Gott.
Er hält sich aber daran. Wenn Naturwissenschaftler versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen, stellen sie Theorien auf und machen Vorhersagen. Wenn diese auch nur einmal nicht erfüllt werden, ist die entsprechende Theorie falsch. Die Theologie kennt solche Vorgehensweise nicht. Die Behauptung, etwas sei offenbart worden, rechtfertigt nicht die Annahme, dass die Naturwissenschaftler sich irren. Schon gar nicht, seit es bessere Erklärungen für das Phänomen gibt.
Und die gibt es?
Ja. Eine Offenbarung ist ein kreativer Akt im Gehirn eines Menschen, der, als ein "Ebenbild Gottes", sogar fähig ist, Unvorstellbares richtig zu erkennen. So etwa Albert Einstein. Aber dabei gibt sich kein Gott zu erkennen, der von außen auf ein Gehirn wirkt. Das sehen auch manche aufgeklärten Theologen so. Doch die Kirchen hören lieber auf ihre systematischen, ihre dogmatischen Theologen, welche die Aussagen der Bibel einfach nur hin und her wenden und Glasperlenspiele betreiben.
Dann gibt es auch keine Wunder?
Der Mensch hat keinen Sinn für den Zufall. Als Wunder werden zum Beispiel unerklärliche Heilungen betrachtet. Es gibt in der Medizin aber immer wieder natürlicherweise Spontanheilungen, unabhängig davon, ob ein Kranker Christ ist oder etwa Buddhist. Dass jemand sogar nach seinem Tod Kranke heilt, wie es Voraussetzung für die Heiligsprechungen der katholischen Kirche ist, ist ein Aberglaube.
Die Menschen erkennen heute vieles, was früher, dem damaligen Erkenntnisstand entsprechend, geglaubt wurde, als Aberglauben. Das gilt auch für viele Regeln und Dogmen in den Glaubensbekenntnissen aller Kirchen. Wenn diese trotzdem daran festhalten, müssen sie gewärtig sein, dass sich jedenfalls die Gebildeten abwenden. Die protestantische Kirche wird so immer mehr zu einem bloßen Sozialverein. Sie hat ihre eigene aufklärerische Vergangenheit vergessen.
Kein Sex vor der Ehe, Homophobie oder der Glaube an den Teufel: Hinter diesen vermeintlichen Moralvorstellungen, die auch an der Münchner Lukasschule für Ärger sorgen, steckt eine Vielzahl protestantischer Freikirchen. Von den Adventisten bis zu den Quäkern ist in Bayern alles vertreten.
Haben die Kirchen nicht immer schon großen Widerstand gegen alles geleistet, was ihren 2000 Jahre alten Lehren widerspricht?
Die protestantische Kirche war tatsächlich auch die Kirche der Aufklärung. Martin Luther hat ja nicht nur die Bibel übersetzt, damit die Menschen sie selbst lesen können und nicht einfach glauben müssen, was der Pfarrer ihnen sagt. Er hat sich ebenfalls erfolgreich dafür eingesetzt, dass in Deutschland Schulen eingerichtet werden. Unter den Protestanten haben sich dann allerdings auch alsbald bildungsängstliche "Schwärmer" gefunden, wie Luther selbst sie bezeichnet hat.
Die Mennoniten zum Beispiel. Von denen sind viele in die USA ausgewandert, wo Mennoniten unter den wichtigen Köpfen der Tea Party zu finden sind. Andere sind nach Russland emigriert. Als "Russlanddeutsche" sind viele ihrer Nachfahren nach Deutschland zurückgekehrt und bilden hier religiöse Ghettos. Ausgerechnet sie protestieren jetzt gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Christliche Intellektuelle haben die Kirche dagegen überwiegend längst verlassen.
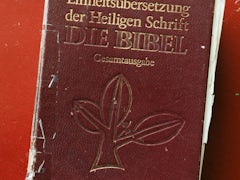
Esoteriker, Islamisten, Okkultisten und jede Menge christliche Gemeinschaften: Allein in Oberbayern stehen 1200 Weltanschauungsgruppen unter Beobachtung, aber nicht alle sorgen für so viel Aufregung wie die "Zwölf Stämme". Ein Überblick.
Nächstes Jahr feiert die protestantische Kirche 500 Jahre Reformation ...
... und tut so, als wäre die Reformation vollendet. Aber die Reformation bedeutet, weiter zu hinterfragen, zu reflektieren, nicht, wie die Lutheraner, "Bekenntnisschriften" wiederzukäuen. Die Reformation hat kein Ende. Sie muss weitergehen. Aber anstatt sie voranzutreiben, freuen sich führende Köpfe wie Heinrich Bedford-Strohm und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann über einen albernen PR-Gag: Martin Luther als Playmobilfigur.
Wieso glauben denn so viele Menschen immer noch an Dinge, für die es keine Beweise gibt, und die den Naturgesetzen widersprechen?
Das hängt mit unserer Natur zusammen. Was wir wahrzunehmen meinen, geht nur zu zehn Prozent auf unsere Sinneseindrücke zurück, die auch noch optischen und akustischen Täuschungen unterliegen. Der Rest ist Verarbeitung und Deutung im Gehirn aufgrund von dessen Vorwissen. So machen wir uns ein Bild von der Welt, das nicht die Welt ist. Wir müssen das, es ist unsere Natur. Und das ist die Ursache für alle Wissenschaft, wie für alle Religionen. Heute lassen sich neurowissenschaftlich zum Beispiel auch die Osterereignisse erklären.
Wenn wir das wissen, woher kommt dann die Hartnäckigkeit, mit der viele an den alten Überzeugungen festhalten?
Wir leben alle mit den Vorstellungen, die uns unsere Umwelt, unsere Familien vermitteln, unsere Ahnen, das geht bis in die Steinzeit zurück. Insofern sind wir selbst, wie auch unsere Institutionen, von gestern. Ein Weltbild, das auf alle Fragen eine Antwort gibt, wie jedes fundamentalistische, macht zwar unfrei, vermittelt aber auch ein Gefühl der Sicherheit. Es ist unglaublich schwer, aus alten Vorstellungen herauszukommen.

Das Lutherhaus in Eisenach dokumentiert den Antijudaismus des Reformators - und die Mühen von Nazi-Protestanten, Juden aus der Bibel zu tilgen.
In den Naturwissenschaften hat das Albert Einstein geschafft, der vor hundert Jahren die Existenz von Schwerkraftwellen postuliert hat, die erst jetzt nachgewiesen werden konnten. Oder bereits vor 2000 Jahren der Wanderprediger Jesus, der Sohn oder vielleicht auch Stiefsohn eines Zimmermannes aus Nazareth, der entgegen den jüdischen Vorstellungen sagte, nicht der Mensch sei für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Er hat gegen den Fundamentalismus seiner Zeit gekämpft. Unsere heutigen Moralvorstellungen können wir zurückführen auf das Gottes- und Menschenbild, das Jesus uns vermittelt hat.
Sie erklären in Ihren Büchern immer wieder, wieso es besser ist, zu wissen als zu glauben, wer und warum er die Bibel verfasst hat und wo die Gläubigen überall falsch liegen. An was glauben Sie selbst noch?
Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Wir sind auf der Suche, wie es selbst Jesus war, der am Ende gefragt hat: "Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" Und der doch darauf vertraut hat: "In Deine Hände befehle ich meinen Geist." Das Konzept Gott kann durchaus einer Wahrheit entsprechen, die der Mensch entdeckt hat. So wie er mit der Mathematik die Sprache entdeckt hat, mit der man die Natur versteht - selbst da, wo man sie sich nicht vorstellen kann. Und mir erscheint es plausibler, dass aus Nichts etwas geschaffen wurde, als dass aus Nichts einfach etwas geworden ist.
Und wieso ist Ihnen die protestantische Kirche so wichtig, dass Sie sich für eine weitere Reformation einsetzen?
Jesus hat uns ein Bild von Gott vermittelt, mit dem die Christen seit 2000 Jahren getrost leben und sterben können. Er gibt keine Sicherheit, aber Hoffnung. Das ist sehr wenig, und diese Hoffnung kann man auch nicht predigen. Aber man kann sie vermitteln und mit ihr Menschen bei Krankheit oder wichtigen Ereignissen ihr Leben lang begleiten. Die Geschichte zeigt, dass die Kirche auch heute gerade in kritischen Situationen gefragt ist. Diese Reputation sollte sie nicht verlieren. Aber ich stelle mir die protestantische Kirche der Zukunft als eine jesuanische und nicht mehr als eine dogmatische Kirche vor.
