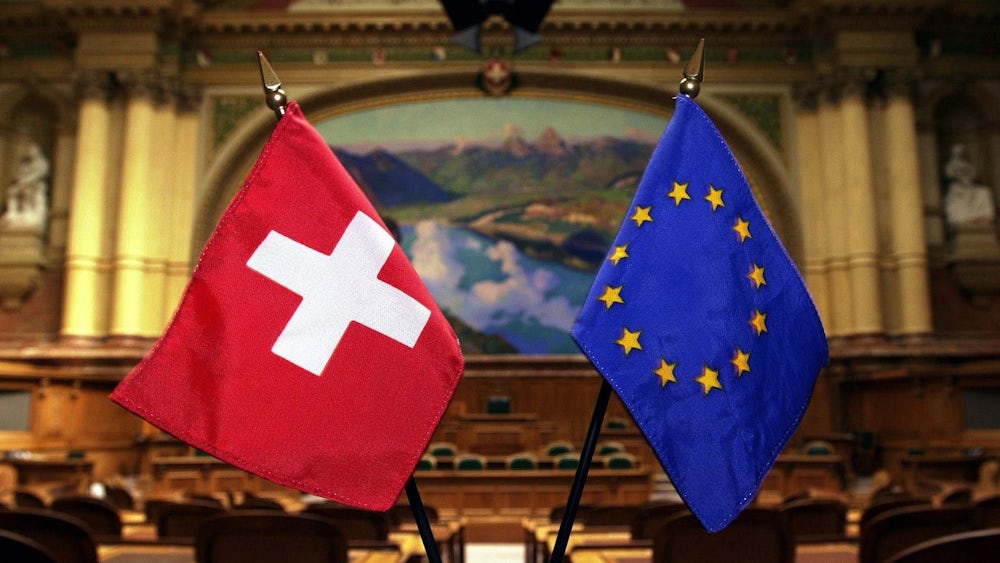In vielerlei Hinsicht könnte man den Eindruck gewinnen, die Schweiz gehöre zur Europäischen Union. Bürger aus der EU können problemlos in und durch die Schweiz reisen und umgekehrt, man kann hüben wie drüben arbeiten, Schweizer Unternehmen nehmen in vielen Bereichen am Binnenmarkt teil, und auch Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeiten eng zusammen. Unterm Strich genießt die Schweiz in vielen Bereichen einen mitgliedsähnlichen Status, ohne Teil der Union, ja selbst ohne Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu sein.
Umso fragwürdiger ist der jahrelange Eiertanz, den die Schweiz im Ringen um das sogenannte Rahmenabkommen mit der EU aufführt. Der sperrig klingende Begriff ist von zentraler Bedeutung für die künftigen Beziehungen. Die Schweiz zählt seit Jahrzehnten zu den engsten Partnern der Union, und damit das auch so bleibt, hat sie am Freitag ihren Bundespräsidenten Guy Parmelin nach Brüssel geschickt - um von dem umstrittenen Abkommen zu retten, was noch zu retten ist.
Der Rahmenvertrag ist die modernisierte Variante des bisherigen Verhältnisses zwischen Bern und Brüssel - nur stärker institutionalisiert. Die EU will nicht mehr jedes einzelne Abkommen mit der Schweiz (es gibt rund 120) separat aushandeln und aktualisieren. Mit dem Rahmenvertrag soll die Übernahme von EU-Recht in den vereinbarten Bereichen quasi automatisch erfolgen. Für Streitfälle sieht das Abkommen einen Schlichtungsmechanismus vor. Unter diesen Bedingungen ist Brüssel bereit, den bilateralen Weg mit Bern weiterzugehen - von dem insbesondere die Schweiz enorm profitiert. Studien besagen, dass kein Land mehr wirtschaftliche Vorteile aus seiner Teilnahme am Binnenmarkt zieht als die Schweiz.
Privilegien: Ja. Zugeständnisse: Nein
Seit 2018 liegt ein fertig verhandelter Entwurf für dieses Abkommen vor, aber in Bern ziert man sich bis heute. Das ist ärgerlich, immerhin hat die Schweizer Regierung, der Bundesrat, den Entwurf mitgestaltet. Es passt allerdings zum europapolitischen Kurs der Schweiz insgesamt: Für einen Beitritt zum EWR war sich das Land 1992 zu schade; zu sehr befürchteten die Eidgenossen Souveränitätsverluste. Ein EU-Beitritt liegt aus denselben Gründen in noch weiterer Ferne. Am liebsten, das haben die endlosen Debatten der vergangenen Jahre gezeigt, würden die Schweizer weitermachen wie bisher: maßgeschneiderte Teilnahme am Binnenmarkt, dazu ein paar Ausnahmeregeln, um ihre hohen Löhne, ihr Sozialsystem und die speziellen politischen Strukturen zu schützen - und vor allem, bitte, keine Anbindung an irgendwelche EU-Institutionen. Kurz: maximale Vorteile bei minimalen Einbußen an Souveränität.

Die Ansteckungszahlen in Indien steigen seit Wochen steil an. Zuerst war es Sorglosigkeit, nun scheint die gefährliche Mutante B.1.617 durch das riesige Land zu rasen. Was bedeutet das für den Rest der Welt?
Das ist aus Schweizer Sicht verständlich - aber akzeptieren muss die EU diesen ungleichen Deal nicht. Dass Bundespräsident Parmelin es nicht für nötig hielt, mit einem ordentlichen Kompromissvorschlag nach Brüssel zu reisen, zeigt: Die Schweiz hat immer noch nicht begriffen, was sie in dem Streit zu verlieren hat. Die EU hat diesem Theater nun lange genug zugesehen. Es ist Zeit, den Verhandlungspartner spüren zu lassen, wie es ist, schleichend wieder zu einem normalen Drittstaat zu werden.
Demnächst laufen wichtige Handelsabkommen aus. Eine Aktualisierung muss an Zugeständnisse auf Schweizer Seite geknüpft werden. Denn letztlich ist es ganz einfach: Wer mitmachen will beim Binnenmarktspiel, muss sich an die Spielregeln halten.