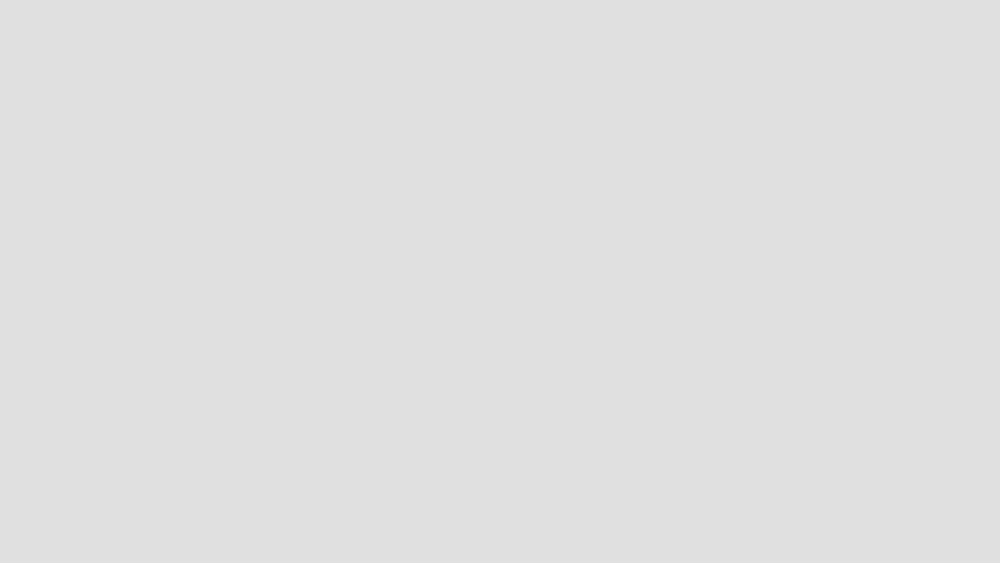Den Tod ihres Bruders konnte die alte Dame aus Detmold nur schwer verwinden, er war ihr letzter naher Verwandter. Zeit, die eigenen Dinge zu regeln, mag sie gedacht haben, sie war schon Mitte 80. Ein paar Monate später, im Juni 2010, nahm sie ein Blatt Papier, schrieb "Testament" darüber und notierte, eines ihrer Häuser solle ihr Nachbar bekommen, der regelmäßig Besorgungen für sie übernommen hatte. Aber war das richtig so? Sie zweifelte. Jahrzehntelang hatte sie sich, kinderlos und unverheiratet, neben ihrer Verwaltungskarriere ehrenamtlich für eine Stiftung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert. Monate später ging sie zum Notar, das erste Testament hatte sie da schon halb vergessen. Alleinerbe sollte nun die Stiftung sein. Es ging um 400 000 Euro.
Es ist einer dieser Fälle, wie sie in Deutschland immer häufiger vorkommen. Alte Menschen, vielleicht nur etwas vergesslich geworden, vielleicht aber auch schon erheblich desorientiert, formulieren Testamente und verwerfen sie wieder, begünstigen heute den Sohn und morgen den in letzter Zeit so fürsorglichen Nachbarn - und wenn sie gestorben sind, müssen Gerichte rekonstruieren, ob sie dabei noch Herr ihrer Sinne waren. Juristen sprechen von "Testierfähigkeit", das ist die Schwester der Geschäftsfähigkeit beim Thema Erbe und Nachlass.
Es gibt dazu keine Statistiken, aber Praktiker bestätigen, dass solche Streitfälle stark zugenommen haben - als Folge zweier Entwicklungen. Erstens wird immer mehr vererbt. In Deutschland sind das 200 oder 300, vielleicht sogar 400 Milliarden Euro - im Jahr, hieß es 2017 in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Zweitens werden die Menschen älter. Damit nimmt auch die Zahl der Demenzerkrankungen zu, derzeit liegt sie bundesweit bei 1,6 Millionen Menschen.
Jeder Mensch ist frei, im Testament auch irrationale Entscheidungen zu treffen
Demenz ist ein besonders heikles Feld, wenn es gilt, die Testierfähigkeit zu bestimmen. Denn der Weg ins Reich des Vergessens ist lang - wann genau der "freie Wille" endet, können nur Fachleute einigermaßen zuverlässig ermitteln. Dabei ist die rechtliche Definition ziemlich klar: Es reicht nicht, dass der Mensch noch irgendeinen Wunsch artikulieren kann, etwa eine spontane Enterbung aus momentanem Ärger. Ein wirksames Testament setzt vielmehr voraus, "dass es ihm bei der Testamentserrichtung möglich ist, sich an Sachverhalte und Ereignisse zu erinnern, Informationen aufzunehmen, Zusammenhänge zu erfassen und Abwägungen vorzunehmen", schreibt das Oberlandesgericht (OLG) München. Jeder ist zwar frei, im Testament auch irrational anmutende Entscheidungen zu treffen. Aber der Mensch muss noch zur Vernunft fähig sein - nur dann wird seine Unvernunft akzeptiert.

In Deutschland gibt es immer mehr Demenzerkrankungen. Der Umgang mit der Hilfsbedürftigkeit der Patienten gestaltet sich oft schwierig, besonders wenn es um deren Pflege und um Rechtliches geht.
Das Gedächtnis ist dafür zentral. Wer die Erinnerung verloren hat, der ist vom "sinngesetzlichen Kontext" der biografischen Lebensentwicklung abgeschnitten, und zwar in beide Richtungen der Zeitachse, schreibt der Psychiater Clemens Cording: Nach hinten fehlt der Zugriff auf eigene Erfahrungen, nach vorne die Fähigkeit, aufgrund dieser Erfahrungen Konsequenzen einzuschätzen. Der Mensch ist, wenn man so will, aus seinem eigenen Leben herausgefallen.
In dem Text, den Cording gemeinsam mit dem Hirnforscher Gerhard Roth verfasst hat, heißt es aber auch: Der allmähliche Gedächtnisverlust ist kein gravierendes Problem, solange der Betroffene sich dessen bewusst ist und ihn kompensiert - etwa, indem er die Details nachschaut. Demenzkranken fehlt dagegen die Einsicht, dass die Erinnerungsfähigkeit schwach wird. "Altgedächtnisbestände" oder emotional besetzte Inhalte drängen sich nach vorne, aktuelle Ereignisse dagegen verblassen sofort. Wer aber nur noch auf Erinnerungsinseln lebt, hat den Überblick über die Realität verloren; der "freie Wille" ist, juristisch gesehen, verloren.
Ganz so schnell geht das allerdings nicht. Nach dem Tod der alten Dame aus Detmold beanspruchte der Nachbar das Haus; sie sei schon arg vergesslich gewesen, als sie ihn enterbte. Das OLG Hamm war anderer Meinung. Gewiss, von einer Herzschwäche über Bluthochdruck bis zu Osteoporose litt sie an so ziemlich allem, was das Alter mühsam macht. Doch der Sachverständige hatte nur eine "leichte kognitive Störung" festgestellt, allenfalls die Vorstufe einer Demenz - sie habe noch selbständig Arzttermine vereinbart und den Alltag im Griff gehabt. Das zweite Testament war gültig. Die Stiftung erbte alles.
Die Diagnose einer Demenz allein, so schreibt der Neurologe Tilmann Wetterling, reicht noch nicht aus, um einen freien Willen auszuschließen. Entscheidend ist der Schweregrad, der sich nicht nur nach dem Gedächtnisverlust bemisst. Manchmal ist es die Unfähigkeit, Wut zu kontrollieren, manchmal die Verarmung der Sprachfähigkeit: Dass ein Mensch nicht mehr frei entscheiden kann, darauf können verschiedene Symptome hindeuten.
In der Praxis zeigt sich, dass Demenz-Patienten oft geschickte Schauspieler sind, die in kurzen Gesprächen ihre Defizite überspielen können. "Ich kann im Zweifel gar nicht beurteilen, ob jemand nur eine Fassade aufrechterhält", räumt der Notar Hubertus Rohlfing ein. Notare verweigern deshalb Beurkundungen nur in offenkundigen Fällen - etwa, wenn ein alter Mensch zu seinem Testament nichts zu sagen weiß und stattdessen nur die Kinder reden. Im Zweifel macht der Notar seinen Stempel darunter. Oft eilt die Angelegenheit, weil die Leute krank sind, außerdem drohen dem Notar Haftungsansprüche, wenn er zu Unrecht die Beurkundung verweigert.
Das heißt natürlich auch: Der Stempel des Notars schützt nicht vor einer späteren Annullierung des Testaments, wie ein Fall aus Nordrhein-Westfalen zeigt. Von 2004 an kümmerten sich zwei Brüder aus Unna um ihre Mutter, doch als einer von ihnen 2007 starb, wurde der andere zum alleinigen rechtlichen Betreuer der Mutter bestellt. Auffallend kurz darauf wurde er als Alleinerbe eingesetzt und mit Geldgeschenken bedacht, zu Lasten der eigentlich ebenfalls erbberechtigten Adoptivtochter seines Bruders. All das war notariell beurkundet. Als die Mutter mit 92 starb, begann der Streit.
Das OLG Hamm gab 2017 dem damals 15-jährigen Mädchen recht: Die Krankenakten, die Dokumentation des Pflegeheims, die Aussage eines Chefarztes - all das belegte, dass die Frau an einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung litt, und zwar schon 2004. Trotzdem notierte ein Notar noch 2008, er habe sich "aufgrund eines längeren Gesprächs" von der Geschäftsfähigkeit überzeugt. War ihm das passiert, was ein Kollege berichtet hatte? Ihm hatte sie munter von ihrer jüngsten Englandreise erzählt - die niemals stattgefunden hatte. Dabei war einem Rechtspfleger im selben Zeitraum aufgefallen, dass sich die Frau alle zwei Minuten danach erkundigte, wer er eigentlich sei und woher er komme. Sogar den Tod ihres Sohnes hatte sie da vergessen.
Angehörige schleppen einen Menschen mit beginnender Demenz eher nicht zum Notar
Stephanie Herzog, Fachanwältin für Erbrecht, hält solche bloßen notariellen "Feststellungen" der Geschäftsfähigkeit deshalb für überflüssig. Stattdessen sollten die Notare lieber ihre Beobachtungen präzise protokollieren - zum Verhalten der Person, zu Verständnisschwierigkeiten, zu Verwirrtheit oder Desorientierung. Das kann später wichtiges Material für Gutachter und Gerichte im Streit um den Nachlass sein. Das Problem ist nur: Wenn Angehörige oder nahestehende Personen einen Menschen mit beginnender Demenz zur Regelung seiner letzten Dinge bringen wollen, dann schleppen sie ihn eher nicht zum Notar. Dann entstehen handgeschriebene Testamente mit krakeliger Schrift und schrägen Zeilen. "Und wenn jemand bei dem alten Herrn oder der alten Dame zu Besuch war, wird hinterher nicht selten ein neues Testament gemacht", sagt Herzog. Gelegentlich dränge sich der Verdacht der Erbschleicherei auf - aber fehlende Testierfähigkeit sei nicht immer leicht zu beweisen.
Manche Fälle riechen förmlich danach. 30 000 Euro wollte eine Frau aus dem Rheingau ihrem Neffen vermachen, 5000 Euro waren für zwei Freundinnen vorgesehen. Aber den großen Batzen, vor allem das Haus, sollten zwei Detektive erben, die schon seit Jahren kräftig kassiert hatten, weil sie das Haus der allein lebenden, von der Angst vor Einbrechern besessenen Witwe mit Kameras bestückt hatten. Einer der Detektive hatte das handschriftliche Testament persönlich zum Amtsgericht getragen, das ihnen dann den Erbschein erteilte. Das OLG Frankfurt dagegen fand, es spreche doch manches dafür, dass die Frau unter einem krankhaften Verfolgungswahn gelitten habe. Es hob den Fall auf.