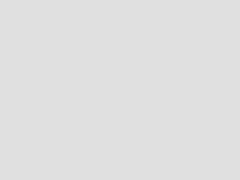Michael Hartmann war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2014 Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Sein Schwerpunkt ist die Elitenforschung. Eliten seien in Deutschland immer weniger durchlässig, schreibt der Wissenschaftler in seinem neuen Buch. Die Folge, so Hartmann: Politikverdrossenheit und Rechtspopulismus.
SZ: Herr Hartmann, wer gehört eigentlich zur Elite?
Michael Hartmann: In der Wissenschaft ist die Definition ganz einfach: Zur Elite gehören die Personen, die gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich beeinflussen können. Verkürzt heißt das: Wer die Macht hat. Je nachdem, wo Sie die Grenze ziehen, zählen dazu zwischen 1000 und 4000 Personen, die allermeisten in Bereichen wie Wirtschaft, Politik oder Verwaltung, einige aber auch im Sport oder in Wohlfahrtsverbänden.
Der Titel Ihres neuen Buchs lautet: "Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden". Das klingt erst einmal sehr ähnlich wie die Standardkritik der Rechtspopulisten am sogenannten "Establishment".
Die Rechtspopulisten verwenden den Elitenbegriff sehr pauschal. Meine Kritik ist viel differenzierter. Ich sage: Die Eliten haben sich - in einem bestimmten historischen Zeitraum - immer mehr von der Bevölkerung entfernt, sowohl was ihre soziale Herkunft angeht, als auch ihr Denken und Handeln.
Wie hat sich die Zusammensetzung der Eliten in Deutschland verändert?
Ich kann das vor allem für die wirtschaftliche und politische Elite sagen. Bei der Wirtschaftselite hat sich nichts getan, die ist nach wie vor sehr geschlossen. Wenn man sich die hundert größten deutschen Unternehmen im Jahr 2018 ansieht, stammen wie seit Jahrzehnten vier von fünf Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden aus Bürger- oder Großbürgerfamilien - also aus den oberen vier bis fünf Prozent der Bevölkerung. Grund dafür ist, dass hier eine sehr kleine Gruppe die Personalentscheidungen trifft und dabei nach dem Prinzip der Ähnlichkeit vorgeht - also Leute auswählt, die so sind, wie sie.
Und wie sieht es mit der Politik aus?
Die Politik war lange der Gegenpol zur Wirtschaft, sie war die sozial offenste Elite. Knapp zwei Drittel der Spitzenpolitiker stammten aus der breiten Bevölkerung, ein beträchtlicher Teil davon aus der Arbeiterschaft. Ein gutes Drittel kam aus dem bürgerlichen und großbürgerlichen Milieu. Zwischen 1999 und 2009 hat sich das praktisch auf den Kopf gestellt. Auf einmal gab es zwei Drittel Bürgerkinder. Aktuell hat es sich wieder etwas normalisiert, jetzt ist das Verhältnis etwa Fünfzig-Fünfzig.
Was sind die Gründe für diesen Wandel?
Da gibt es viele, aber das Erstaunliche ist, dass diese Veränderung in Deutschland nicht - wie in Großbritannien und den USA - beim Wechsel von einer eher linken zu einer konservativen Regierung stattgefunden hat, sondern beim Gegenteil: Wir hatten Helmut Kohl, dann kam 1998 Rot-Grün. In den Jahren davor hatten sich die Strukturen in der SPD sehr verändert. Der Einfluss unterer Parteigremien auf die Spitze hatte nachgelassen und die Mitgliedschaft hatte sich gewandelt - der Arbeiteranteil war deutlich gesunken und der Akademikeranteil gestiegen. Und bei den Grünen war die Zahl der Akademiker ohnehin immer groß.

Was Sahra Wagenknechts Sammlungsaufruf #Aufstehen erreichen könnte - und was er zu zerstören droht.
Die These Ihres Buchs lautet: Soziale Exklusivität und Homogenität von Eliten fördert neoliberale Politik. Wie kommen Sie darauf?
Je reicher Personen in den Eliten aufgewachsen sind, umso unproblematischer sind für sie gesellschaftliche Ungerechtigkeiten. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Studie, die ich 2012 mit durchgeführt habe. Das heißt nicht, dass diese Menschen korrupt sind, die meisten sind leistungsstark und glauben ehrlich, dass das, was sie machen, für ihr Unternehmen, den Staat oder die Gesellschaft das Beste ist. Das Problem liegt darin, dass sie aufgrund ihrer Herkunft die gesellschaftliche Wirklichkeit anders wahrnehmen - und diese Wahrnehmung für die einzig sinnvolle halten. Jemand, der immer in eigenen Immobilien gelebt hat, kann sich den Wohnungsmangel in deutschen Städten schwer vorstellen.
Nun wurden aber gerade die Hartz IV-Gesetze von den Arbeiterkindern Frank-Walter Steinmeier und Gerhard Schröder konzipiert und durchgesetzt.
Solche Ausnahmen gibt es immer wieder, und Schröder ist sicherlich eine große. Ich sage nicht, dass meine These für jede einzelne Person stimmt, aber sie stimmt im Durchschnitt. Unter Schröder sind gerade die zentralen Ministerien, vor allem das entscheidende Finanzministerium, nach und nach in die Hände von Bürgerkindern gekommen und das hat klar Auswirkungen auf die politischen Maßnahmen gehabt.
Haben Sie ein Beispiel für solche Maßnahmen?
Gucken Sie sich die steuerlichen Maßnahmen des letzten Jahrzehnts an: Das sind durch die Bank Erleichterungen für die Wohlhabenden gewesen. Die Politiker profitieren davon selbst, aber das ist nicht der Grund, warum sie diese Entscheidungen treffen. Sie glauben einfach, dass es der richtige Weg ist, um die Wirtschaft anzukurbeln - und alle anderen Varianten werden nicht in Erwägung gezogen.
Sie gehen in Ihrem Buch vor allem auf den Mangel an Arbeiterkindern in den Eliten ein, nicht auf den Mangel an Menschen aus Einwandererfamilien oder von Frauen. Deren Interessen werden doch aber auch nicht ausreichend repräsentiert.
Das stimmt, ich konzentriere mich auf die soziale Herkunft. Das liegt einmal daran, dass das mein Interessenschwerpunkt ist. Aber auch daran, dass es meiner Meinung nach für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zur Zeit das gravierendste Problem ist. Die Zunahme der sozialen Unterschiede bietet die Grundlage dafür, dass etwa die Flüchtlingsdebatte derzeit so schrecklich geführt wird, wie sie geführt wird.
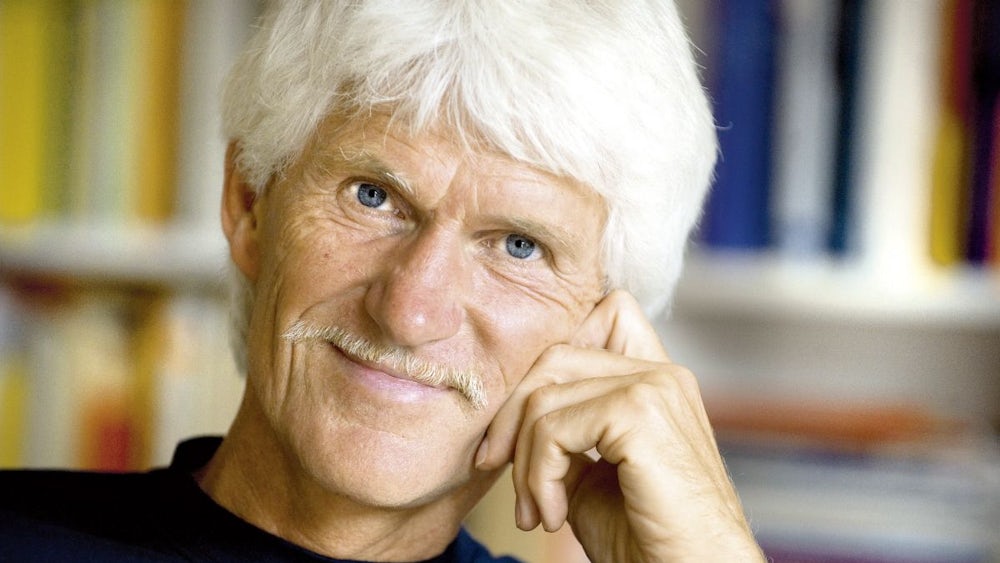
Das heißt, für Sie ist das Verhalten der deutschen Eliten verantwortlich dafür, dass die AfD so stark geworden ist?
Ja, wobei es nicht um das Verhalten Einzelner geht, sondern um die konkrete Politik, die betrieben wurde. Große Teile der Eliten sind sich ja bis heute einig, dass es richtig war, was in den vergangenen zwanzig Jahren passiert ist - ob das Hartz IV ist oder die Steuersenkungen. All das, was zur sozialen Schieflage beigetragen hat, wird im Zeichen der Globalisierung als alternativlos dargestellt.
Es gibt aber Soziologen, die den Zusammenhang zwischen sozialen Problemen und dem Erfolg der AfD bestreiten.
Ich weiß, aber wenn Sie sich Wahlergebnisse anschauen, zeigt sich: AfD-Wähler konzentrieren sich überwiegend in den Regionen, in denen die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Und die Partei findet weit überproportional Anklang im ärmeren Teil der Bevölkerung. Hinzu kommt dann noch ein fester Stamm von rechten Wählern in Deutschland, den es schon immer gab. Aber die AfD hat es eben geschafft über diesen Stamm hinaus zu kommen.
Die Vertreter der AfD kommen allerdings zu großen Teilen auch nicht aus der Arbeiterschaft.
Bei der AfD gibt es zwei komplett gegensätzliche Flügel: Da ist einmal der im Kern wirtschaftsliberale West-Flügel, dazu gehören Weidel und Meuthen. Das sind alles Bürgerkinder. Dann haben Sie die Ost-AfD, da ist kein einziges Bürgerkind. Das findet sich auch in der Politik wieder, zur Rente gibt es zum Beispiel eine Ost- und eine West-Vorstellung, die völlig unterschiedlich sind. Aber Protestwähler interessiert die Zusammensetzung der Parteispitze im Grunde gar nicht. Die wollen einfach, dass ihre Belange endlich mal zur Kenntnis genommen werden. Und das funktioniert aus ihrer Sicht im Augenblick am besten, wenn sie AfD wählen.
Wie ließe sich nun diese Entfremdung zwischen Bevölkerung und politischer Elite verringern?
Was die SPD angeht, müsste man eigentlich einen großen Teil des Spitzenpersonals austauschen, weil die alle mit der Politik der letzten zwanzig Jahre verbandelt sind. Die Partei müsste sich wie Labour in Großbritannien von unten erneuern. Man könnte auch darüber nachdenken, ob Parteien nicht ganz grundsätzlich ähnlich wie Frauenquoten Arbeiterkinderquoten einführen sollten. Das wäre im Übrigen in allen gesellschaftlichen Eliten begrüßenswert - also etwa auch in Wirtschaft, Wissenschaft und in den Medien. Aber es ist natürlich schwer durchsetzbar, denn bei Quoten ist immer klar, wer die Verlierer sind: Die, die von den bestehenden Verhältnissen profitieren.
"Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden" erscheint am 16. August im Campus-Verlag (276 Seiten, 19, 95 Euro).