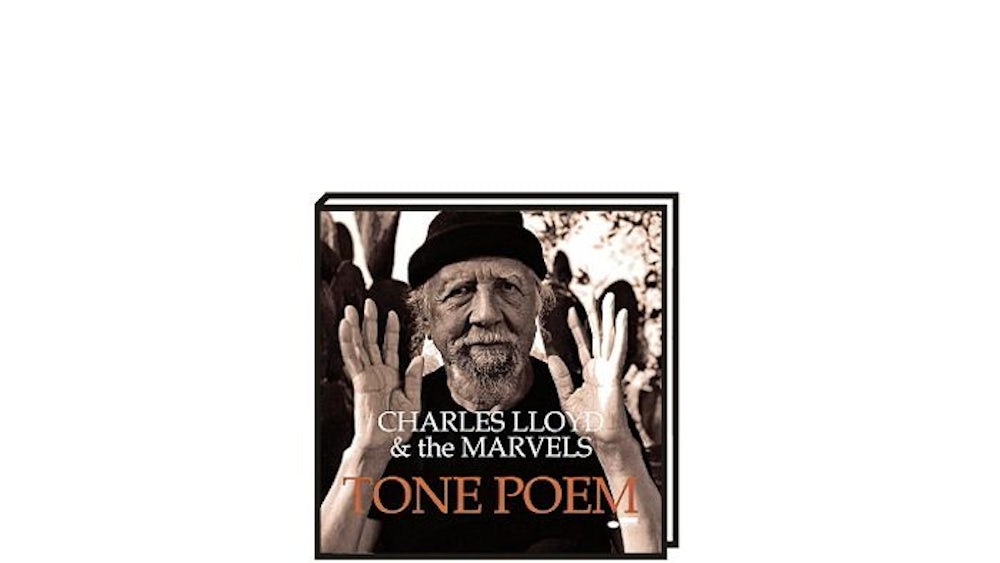Es gab im Jazz immer wieder mal Glaubenskriege, gegen die die Streitereien zwischen Beatles- und Stones-Fans wie reinstes Geplänkel wirkte. Sollte man das Saxofon eher im Geiste von John Coltrane verstehen oder in dem von Sonny Rollins? War Dizzy Gillespie an der Trompete auf dem Pfad der Wahrheit, oder doch erst Miles Davis? Derzeit tut sich bei den Jazzgitarristen eine ähnliche Kluft auf. Das derzeit dominante Ideal ist eine fast schon mönchische Klarheit, bei Wolfgang Muthspiel etwa, bei John Scofield und vor allem bei Julian Lage, dessen Spiel viele für den Goldstandard der Gegenwart halten.
Der Kalifornier hat seinen Klang auf ein so pures Minimum gebracht, dass man immer den Eindruck hat, er hätte selbst die natürlichen Verzerrungen der elektrischen Gitarre weggeschliffen. Lange spielte er eine Fender Telecaster, mit der Rockgitarristen wie Keith Richards, Bruce Springsteen oder Jimmy Page im Klangbild klar machten, dass alles, was sie tun, nur eine Variation von Muddy Waters ist. Inzwischen spielt er eine Sonderanfertigung, die ihm die Firma Collings aus Zentraltexas gebaut hat und die schon optisch wirkt, als seien die letzten siebzig Jahre Musikgeschichte spurlos an ihr vorübergegangen. So klingt das dann auch. Rein und pur und letztlich ist so ein musikalischer Protestantismus ähnlich krafmeierisch, wie die Materialschlachten und Klangwolken so vieler Gitarristen. Bar jeden Schmuckwerkes kann Lage sein ganzes Charisma als Musiker strahlen lassen, das ihn ohne Frage einzigartig macht.
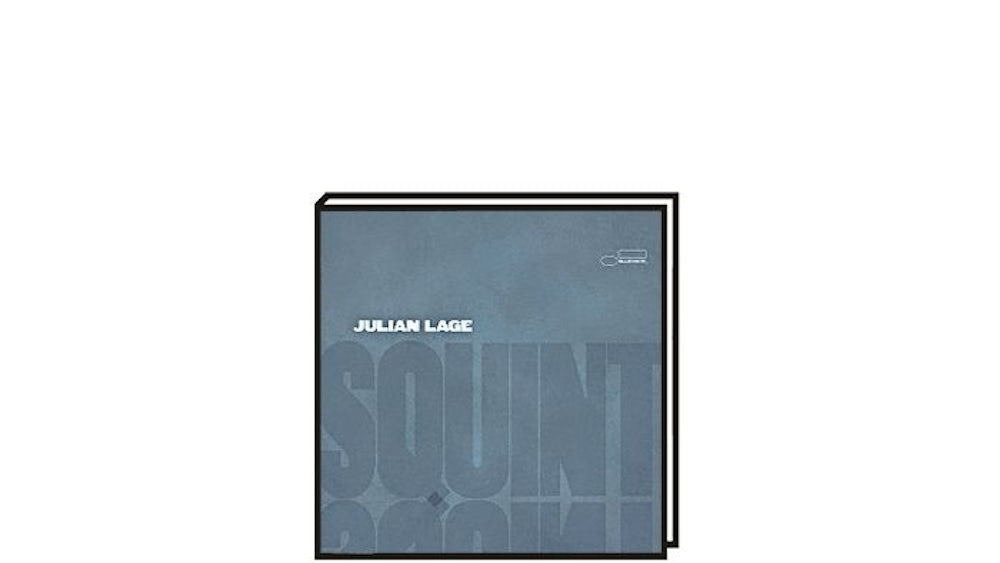
Das Gegenstück, pures Barock voller Überwältigungsmomente aus Schönheit und Klangpracht, ist aber die Musik von Pat Metheny. Der machte noch nie einen Hehl aus seiner Harmoniesucht und seinen ausschweifenden Klangspielen. Nach einem insgesamt doch sehr gelungenen Experiment mit vollem Streichorchester auf seinem letzten Album "From this Place" und einem Exkurs in die klassische Komposition auf "Road to the Sun", führt er mit seinem neuen Trio-Projekt auf dem Live-Album "Side-Eye NYC (V1.IV)" (Modern Recordings) vor, dass dieser Hang zum Barocken wenig mit Studiotechnik zu tun hat und viel mit seinem Sinn für Klangbilder, die so groß und ausladend sind wie der Himmel über der Prärie seiner Heimat Missouri. Kein Wunder, dass er in dem jungen Keyboarder James Francies aus Texas einen kongenialen Widerpart gefunden hat. Sicher haben die beiden keine Scheu, das Maximum an Klangfülle aus der modernen Technologie zu holen. Hatte Metheny noch nie, der vom Guitarsynth bis zum Orchestrion nichts unversucht ließ. Das in einer sonst so puristischen Musik wie dem Jazz hinzukriegen ist natürlich brillant. Das aber würde nicht funktionieren, wüssten die beiden nicht, wie sie auch ohne solche Klangfarben einen Akkord so spielen, dass sich der ganz große Himmel auftut.
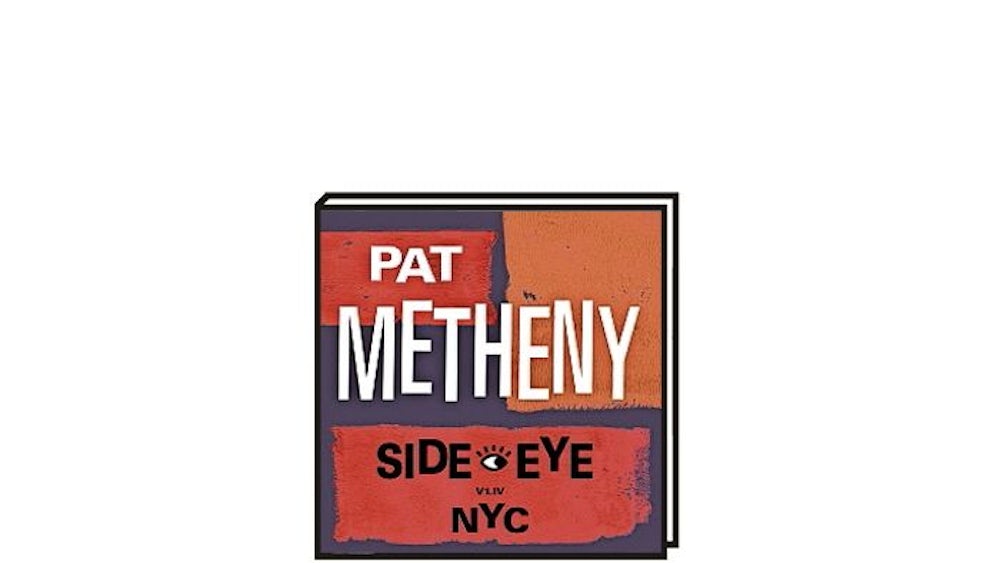
Und dann gibt es in diesen Glaubenskriegen natürlich noch Versöhner wie Bill Frisell, der scheinbar all diese Schulen und Ideale vereinen kann. Der ist so produktiv und ein so viel gefragter Gast, dass man eigentlich eine eigene Kolumne nur über seine Arbeit bräuchte. Auf seinem letzten eigenen Album "Valentine" (Blue Note) kam er seinem Ziel, amerikanische Musik zu spielen, die zwischen Folk, Pop und Jazz keine Grenzen mehr kennt, sehr nahe. Burt Bacharach oder "We Shall Overcome" als Introspektionen? Kann nicht jeder so souverän. Wenn er sich aber mit einem Genie reiben kann, läuft er nochmal ganz anders zu Form auf. Mit dem Saxofonisten Charles Lloyd zum Beispiel, dem er in dessen Gruppe The Marvels beisteht. Auch Lloyd sucht nach der wahren Amerikana, spätestens seit er in den Sechzigern als Jazz-Exot zwischen Rockstars die Hippie-Jugend in die Ekstase spielte. Für die Marvels-Alben wurden bisher immer Leute wie Lucinda Williams, Norah Jones oder Willie Nelson zum Singen eingeladen. Ohne Gesang geht das auf "Tone Poem" (Blue Note) nicht immer ganz so leicht ins Ohr, führt aber deutlich tiefer in die amerikanische Musik. Und die ließ dann in letzter Instanz doch alles zu. Die Askese, die Ausschweifung, die Ekstase und alles was dazwischenliegt.