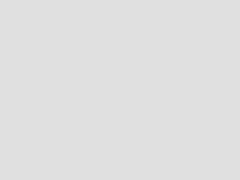Das musste ja so enden. Die letzte in der Reihe der Frauen der Literaturgeschichte, die von Männern herbeigeschrieben worden sind, richtet die Waffe gegen den Künstler. Eine 32er Beretta, Valerie Solanas Pistole, mit der sie auf Andy Warhol schoß, weil er das einzige Manuskript ihres Theaterstücks "Up Your Ass" in seiner Factory hatte verschwinden lassen. "Ich gehe zu ihm," erzählt Feridun Zaimoglu die Szene nach, "ich sage leise: ,Du bist wertlos.' Ich ziele." Die historische Solanas war die Autorin eines Manifests, das so anfing: "Da das Leben in dieser Gesellschaft bestenfalls furchtbar öde ist und die Gesellschaft in gar keiner Hinsicht von Bedeutung für Frauen, bleibt bürgerlich gesinnten, verantwortungsvollen, erlebnishungrigen Frauen nichts übrig, als die Regierung zu stürzen, das Finanzsystem zu beseitigen, die vollständige Automatisierung einzuführen und das männliche Geschlecht zu zerstören." Zaimoglu schreibt (in Versalien): "Jeder Mann soll verrecken; weil er keine Frau ist."
Der gemessen an der Breite seines Werks große deutsche Schriftsteller Zaimoglu, 1964 in der Türkei geboren und nach allem, was man weiß, Angehöriger des hier zur Abschaffung freigegebenen Geschlechts, beendet mit der Solanas-Episode eine Überarbeitung der Weltgeschichte. Sein Buch "Die Geschichte der Frau" ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und will der "Große Gesang" sein, der die "Lügen" großer Männer tilgt. Motto: "Es spricht die Frau."
Und zwar reden in etwa gleich langen Ich-Erzählungen Zipporah, die nach Luthers Bibelübersetzung dunkelhäutige Frau des Propheten Moses, und neun weitere Heldinnen: Antigone, Judith, Frau des Verräters Judas, die von allen Nibelungen betrogene Brunhild, eine der Hexerei angeklagte Hebamme der Lutherzeit, eine von romantischen Dichtern zur Muse gemachte Wäscherin, eine Revolutionärin von 1848, eine Trümmerfrau, Leyla, aus Zaimoglus gleichnamigem Roman bekannte türkische Immigrantin der ersten Generation, schließlich Solanas.

1918 haben sich Frauen erstmals das Wahlrecht erstritten. Warum gibt es über diesen Kampf kaum Filme, obwohl die Vorkämpferinnen so spannende Figuren waren?
Viele dieser Stoffe hat sich Zaimoglu schon in früheren Romanen und Theaterbearbeitungen angeeignet. Er schreibt, erzählt er in Interviews, wie ein method actor spielt. Also in identifikatorischem Nachschöpfen seiner Figuren und ihrer Sprache, zuletzt des Wahnsinns des Bibelübersetzers Luther in "Evangelio" (2017) und ganz früh des kreolisierenden Deutsch der Einwanderer mit "Kanak Sprak" (1995). Es ist ihm also zuzutrauen, dass er aus Frauenperspektive schreiben kann.
Auch wenn in letzter Zeit die Idee populär geworden ist, dass die "Stimme" von durch Geschlecht, Hautfarbe oder Klasse gekennzeichneten Figuren nur denen zusteht, die selbst unter den Nachteilen der jeweiligen "Identität" zu leiden haben. Das würde heißen, dass nur eine Frau "Die Geschichte der Frau" schreiben dürfte. Andererseits ist es eben ein unschlagbares Privileg der Literatur, Empathie unter verschiedenen Leuten herzustellen, damit idealerweise jede mit jedem ihre Geschichten teilen kann. Die Freiheit, alles erzählen und alles verstehen zu können, sollte man sich nicht künstlich versagen.
Und Zaimoglu macht das nicht zum ersten Mal: In "Leyla" (2006) hat er die Lebensgeschichte seiner Mutter aus ihrer Perspektive aufgeschrieben, "Isabel" (2014) war die Geschichte eines Models, das sich Körperdisziplin und männlichem Blick unterwirft. Sympathisch also, dass er dranbleibt, selbst wenn eine "Geschichte der Frau" grosso modo natürlich ein aussichtsloses Unterfangen ist. Die "Geschichte weiblicher Geschichtslosigkeit" wird man nicht rückwirkend korrigieren können.

Jede Woche stellen wir Schriftstellern die Frage: "Was lesen Sie gerade?" Den Anfang macht Feridun Zaimoglu, der seine Lektüre jedoch nicht jedem empfehlen kann.
Das hat Silvia Bovenschen beeindruckend klargemacht, als sie 1979 in "Die imaginierte Weiblichkeit" schrieb, diese Geschichtslosigkeit sei eben nicht nur dem Umstand geschuldet, dass man Frauen von der Kunst ferngehalten hat, damit Männer ungestört "Lügen" verbreiten konnten. Wenn das alles gewesen wäre, müsste man heute tatsächlich nur den Kanon umstellen und die Frauen aus dem Abseits hervorholen - Sappho unterrichten statt Ovid, Madame de Staël statt Schlegel und so weiter. Das gravierendere Problem besteht aber Bovenschen zufolge darin, dass schon immer viel über Frauen geschrieben worden ist. So viel, dass man unmöglich sagen kann, was aus "der Frau" jenseits männlicher Zuschreibungen geworden wäre: "Die Morphogenese der imaginierten Weiblichkeit schiebt sich im Rückblick an die Stelle der weiblichen Geschichte. Die Grenzen zwischen Fremddefinition und eigener Interpretation sind nicht mehr auszumachen." Wenn es so etwas wie eine weibliche Perspektive gibt, dann hat sie mit dieser Dauerkonfrontation des Selbstbilds mit verschiedenen Fremdbildern zu tun.
Selbstverständlich weiß Zaimoglu das, spielt damit und ergänzt die Morphogenese "der Frau", zu der laut Bovenschen traditionell der "gelehrsame" und der "empfindsame" Typus gehören, durch den der Eigensinnigen, Wehrhaften. Er durchkämmt die Weltgeschichte mit der zeitgenössischen Idee, es müsse immer Frauen gegeben haben, die, weil sie auf ihrer Autonomie bestanden, eine alternative Weltgeschichte hätten machen können, wenn man sie nicht unterdrückt hätte. Als ihre Gegen- oder Spiegelfiguren setzt er Frauen ein, die sich anpassen und das Patriarchat stützen. Dass seine Frauen ihre Position im Laufe der Handlung öfter wechseln, ist ein kluger Zug der Geschichten.
Zipporah zum Beispiel hält ihrem Mann Moses den Rücken frei, während er die Gebote des Herrn unter den Stämmen durchsetzen muss. Seine Schwester Miriam dagegen "gilt als Prophetin, die Stätte der Offenbarung aber, das Zeltheiligtum, darf sie nicht betreten". Als Mitgründerin der Weltreligion wird sie verdrängt. Sie kämpft für das weibliche Begehren: "Weshalb, Moses, willst du das Lager nicht mit deinem Weib teilen?" Er verflucht sie wegen der impertinenten Frage, da steht wiederum Zipporah für sie auf: "Wer führt uns Frauen, wenn nicht eine Frau? Stärke sie."
Begehrende Frauen sind in Zaimoglus "Geschichte der Frau" am fatalsten der Männerherrschaft verfallen. So wie Antigones Schwester Ismene ("'Ich wurde begehrt', flüstert sie"), oder das naive Liebchen eines Revolutionsgenossen von Friedrich Engels. Heterosexuelles Glück scheint für die "Geschichte der Frau" irrelevant, die widerständigen Frauen denken verächtlich über die Liebe. Sie hören die misogynen Reden und sehen den immer mit Gewalt verbundenen Sex der Männer.
Noch eine Parallele drängt sich auf: Alle Episoden spielen in Übergangsphasen, in denen ein altes Männergesetz gestürzt, das neue aber noch nicht legitimiert ist - von den Jüngern Jesu nach der Auferstehung, aber vor Himmelfahrt, über die Burgunder nach Siegfrieds Tod und vor Krimhilds Rache, bis zur Stunde null des 20. Jahrhunderts. Gerade in Zeiten der Unsicherheit, hat Silvia Bovenschen beobachtet, erscheinen Frauen gewissermaßen als die typischeren Menschen, denn sie sind "in hohem Maße zivilisatorischen Wirren ausgesetzt. Da das weibliche Individuum nicht über sich entscheiden kann, wird es noch leichter als der Mann mögliches Opfer einer depravierten Kultur."

Yorgos Lanthimos lässt Rachel Weisz und Emma Stone um die Gunst Olivia Colmans wetteifern. "The Favourite" ist ein opulenter, fieser und oscarverdächtiger Zickenkrieg.
Ihren Widerstandsgeist schärfen Zaimoglus Frauen vor allem an der Unvernunft der Männer. Durch den Bechdel-Test, mit dem man die Geschlechterbalance von Geschichten misst, fällt sein Buch spätestens bei der Frage: "Sprechen Frauen hier über etwas anderes miteinander als einen Mann?" Kaum. Ganz anders hat es sich neulich der Regisseur Giorgios Lantimos ausgemalt: Sein Film "The Favourite" über eine lesbische Dreiecksbeziehung der Königin von England legt nahe, dass Frauen unbemerkt von den Historiografen vollauf miteinander beschäftigt gewesen sein könnten. So stellt sich Zaimoglu die "Geschichte der Frau" nicht vor.
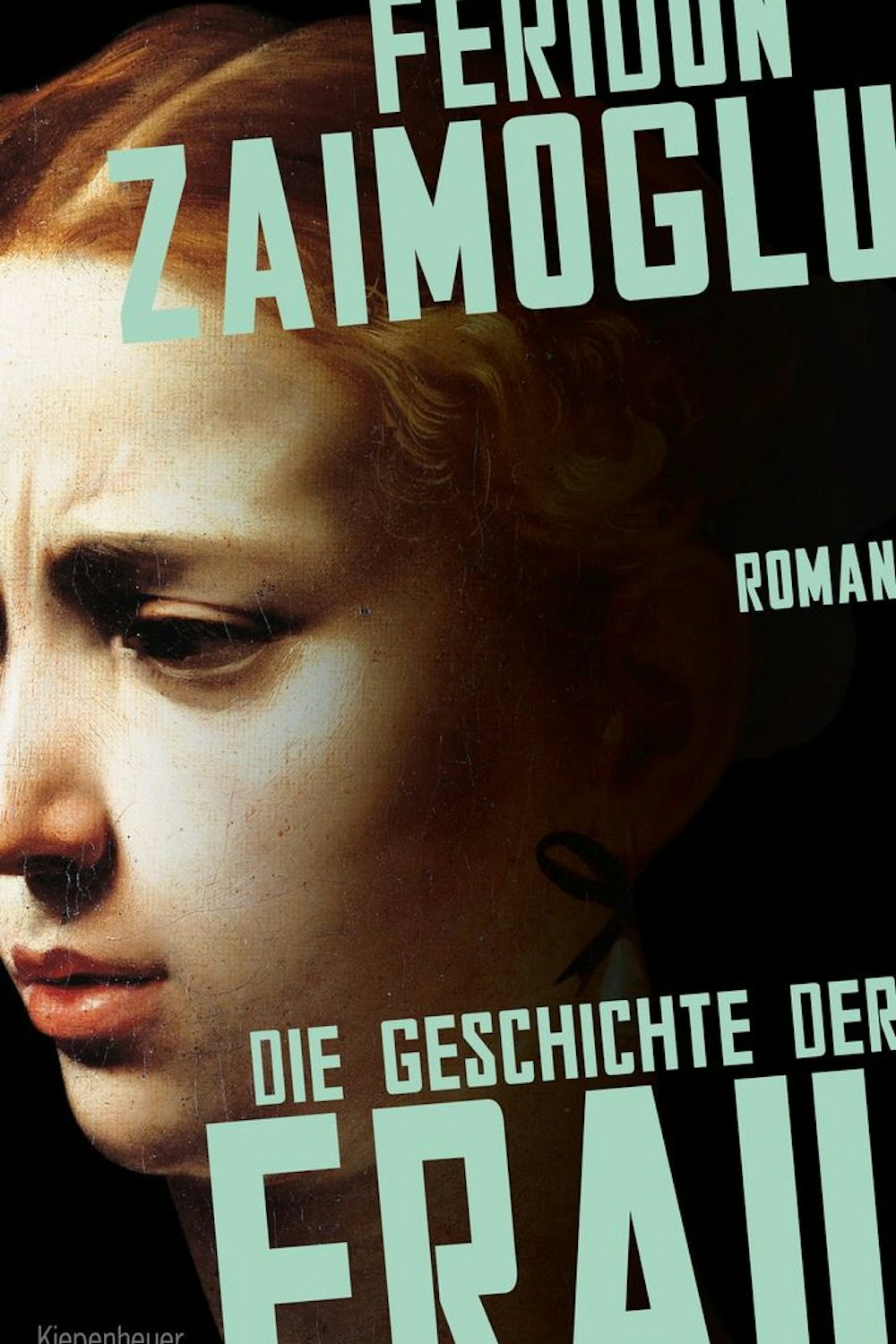
Er redet zwar zuletzt, in der Solanas-Episode, der Abschaffung des männlichen Künstleregos das Wort, aber er selbst als Autor bleibt dabei sehr präsent, sein heftiger Formwillen deutlich spürbar. Obwohl man seinen Erzählungen die Absicht anmerkt, sich verschiedenen Idiolekten anzuverwandeln, lesen sie sich doch erstaunlich ähnlich. Das liegt an der Zaimoglu-typischen Überdeterminiertheit der Sprache: Nichts daran ist konventionell, alles bedeutet. Sogar die Satzstellung dreht er so, dass die wichtigen Wörter zuerst kommen: "Retter Jesus schreibt auf in die brausende Luft klirrende Silben." Dazu kommt eine Liebe zu Alliterationen ("die heiteren Huren. Sie sind schamlos schön"), ausgedachten und altmodischen Wörtern ("Menstruationsmiezen", "seichen") und Bildern, die sich gefährlich der Stilblüte nähern ("Das Land düstert sich ein"). Gerade einer Leserin, die diese Schreibweise trotz allem sehr bewundert, weil sie dem schlaffen Deutschen etwas Scharfes, nie Langweiliges gibt, muss auffallen, wie männlich dieser Stil der Sprachbeherrschung, Sinnkontrolle und Kraftausdrücke ist.
Dass die Selbstwidersprüche, in die sich Zaimoglu mit einer in diesem Ton erzählten "Geschichte der Frau" begibt, kein Missgeschick sind, sondern eher so etwas wie Hingabe an einen Verhängniszusammenhang, macht besonders hübsch die Episode der Wäscherin Lore Lay klar, die sich um einen Sommergast zu kümmern hat. Und oh je, es ist ein Romantiker: "'Was ist der Herr wild bewegt? Was will der Herr?' Ich weiß es schon: Er will, dass ich ihm gespannt lausche." Lore wehrt sich, der Mann kratzt nachts an ihrer Tür, sie sperrt ihn aus, das spornt ihn an, er dichtet und macht sie zum Mythos, zur fatalen Jungfer, die die Schiffer absaufen lässt in wildem Weh. Denn merke, schreibt Zaimoglu mit Mut zur Selbstironie: "Nur das besungene Weib wird unsterblich."
Feridun Zaimoglu: Die Geschichte der Frau. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019. 400 Seiten, 20 Euro.