Die Vereinheitlichung der Studiengänge in Europa, die vor zehn Jahren in Bologna beschlossen wurde, ist mit ihren Bachelor- und Master-Abschlüssen, mit ihren Modulen und Kreditpunkten immer noch heftig umstritten. Unsere Debatte, die von den jüngsten Schüler- und Studentenprotesten neu angestoßen wurde, setzt heute der Politologe Wolfgang Fach fort - er ist Prorektor für Lehre und Studium an der Universität Leipzig.
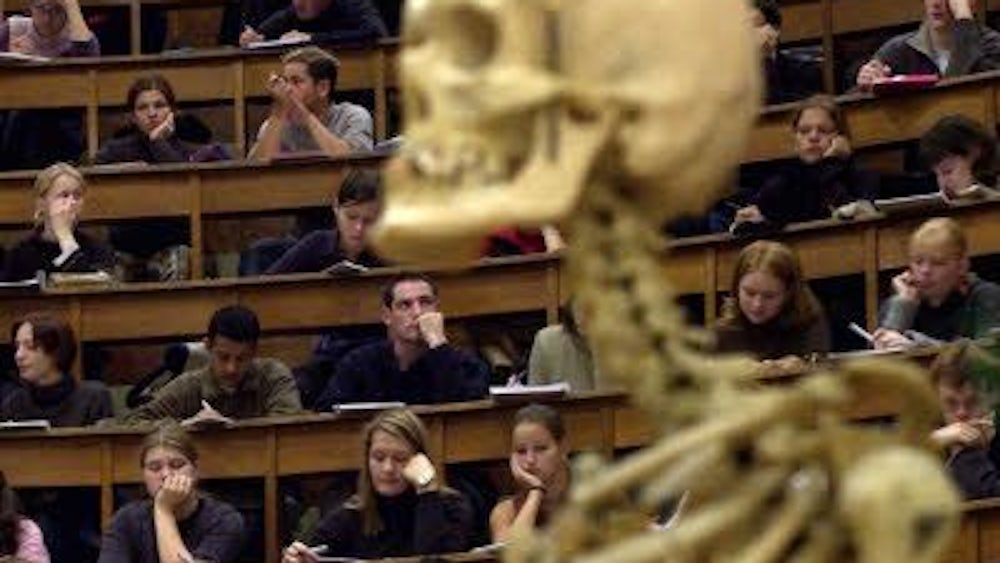
Wenn alle Wege nach "Bologna" führen, weil an der Zukunft niemand vorbeikommt - wie Wolfgang Seibel in der SZ vom 24. Juni geschrieben hat -, dann fragt man sich schon, warum so wenige davon wissen oder daran glauben. Ausstiegswillige schießen wie Pilze aus dem Boden. Nach ihrem Verständnis gibt es Wege in eine andere und bessere Zukunft namens "Vergangenheit". Wes Geistes Kind die Kritiker sind und was man von ihrem Geist zu halten hat: Diese Fragen sind noch lange nicht erledigt. Also stellen wir sie.
Mehr Markt und Humankapital
Die Bologna-Kritik setzt, sofern sie gründlich geschieht, an der Entstehungsgeschichte an. Europäische Gutmenschen wollten ihrem Kontinent noch einen "gemeinsamen Raum" überstülpen und haben, wissensgesellschaftlich beflügelt, dafür die Hochschulen auserkoren. Da dieser Wunsch nach unten durchgestellt werden musste, bot sich für nachgeordnete Akteure eine willkommene Gelegenheit, innovativ an die Reform weitere Reformen anzuhängen.
Jede Ebene addierte einen eigenen Gedanken, je nachdem, wo ihr gerade der Schuh gedrückt hat: Mehr Markt ("Employability") schien einigen das Allerwichtigste, anderen kam es vor allem auf verbesserte Abschlussquoten an (Humankapital), wieder andere fanden es an der Zeit, den ministeriellen Alltag von lästigen Nebenjobs zu befreien (Akkreditierung), und in den Universitäten akzeptierte man gerne die Offerte, durch gesteigerte Anforderungen ins Studieren wieder mehr Ernst zu bringen (Prüfungslast).
Ungewollt Unfug angestellt
Da mehrere Ebenen durchlaufen werden mussten, ist eben eine Mehrebenen-Reform entstanden - wobei jede Stufe für sich genommen etwas Vernünftiges im Auge gehabt haben mag, alle zusammen aber ungewollt Unfug angestellt haben: emergent irrationality. Wer das Dilemma so, also als Verflechtungsproblem beschreibt, wird auf Entflechtung drängen.
Nahe liegt es dann, den Revisionsprozess gegenläufig zu organisieren, weil uns der gesunde Menschenverstand eingibt, dass auf dem lokalen Terrain naturgemäß besonders kurzsichtige, aber auch besonders flüchtige Reformen passieren. Wir sind, danach sieht es aus, noch einmal davongekommen: Den schwachsinnigsten Teil wird man am schnellsten wieder los. Eine Variante der Hölderlin-Formel: "Doch wo Gefahr ist, da ist das Rettende auch."
Gerade jene Hochschulen, die sich vergleichsweise reformfreudig geriert haben, müssen mit dieser Lageskizze rechnen. Aber: Sind nachgeordnete Entscheidungen schon deswegen bornierter, weil ihr Einzugsbereich begrenzter ist? Und werden wir sie schon deswegen einfacher los, weil sie nachgeordnet sind? Könnte es nicht sein, dass man im Überschwang des geplanten (Rückzugs-)Gefechts das, was auf der unteren Ebene passiert, zugleich unter- und überschätzt?
Auf der nächsten Seite: Eine Novelle für jedes Ärgernis - Reformen beginnen einander zu jagen.
Was bedeutet Elite? Stress bis zur Selbstaufgabe, ein reiches Elternhaus - und das Ende der Gleichheit: die besten Studenten-Entwürfe zum Plakatwettbewerb "Elite! Für alle?".
Schöne neue Parallelwelt
In ganz Deutschland gehen heute Tausende Schüler und Studenten auf die Straße. Sie stellten Schulen symbolisch unter Quarantäne, blockierten Straßen und inszenierten Banküberfälle. Der Protest in Bildern
Überschätzt wird die lokale Korrekturmasse: das also, was Hochschulen aus vermeintlichen oder wirklichen Fehlern lernen und im Eilgalopp selbständig ändern können. Denn vieles von dem, was im Namen von Bologna geschehen ist, hat sich umgehend in geltendes Recht verwandelt und damit Ansprüche geschaffen, die nicht mehr so einfach abzuschütteln sind. Bestandsschutz genießt auch der Irrtum; deshalb muss, wer ihn ausradieren will, neben dem (schlecht)laufenden Betrieb schöne neue Parallelwelten kreieren: eine Novelle für jedes Ärgernis. Reformen beginnen einander zu jagen.
Das hält nach kurzer Zeit kein Kopf mehr aus und auch kein Amt und kein "System". Irgendwann wird es heißen: rien ne va plus. Wenn "Wiederverbesserer" laufend Rechtskulissen verschieben und geltendes Regelwerk als lästige Randerscheinung behandeln; wenn Amtsblätter, von der schnelllebigen Zeit überrollt, hauptsächlich (vor)gestrige Aktenlagen dokumentieren, dann ist das Durcheinander perfekt. Ein besser geordneter Rückzug auf dem System der Bologna-Studiengänge würde nur beweisen, dass man vorher kaum vorwärts gekommen war.
Soll sich doch der Apparat kümmern
Was tun? Zumindest lanciert die stabile Verwirrung den starken Auftritt. Man ergreift mutig das Schwert, holt entschlossen aus - und lässt den Knoten entwirren. Roma locuta, Bologna finita - sollen sich doch andere ("der Apparat") darum kümmern, wie dem Willen Wirklichkeit eingehaucht werden kann. Diesen windigen Dezisionismus garniert ein wählerischer Perfektionsdrang, der den Anspruch mit Bedacht in solche Höhen treibt, dass willkommene Enttäuschungen zwangsläufig sind. Alles muss passen - sobald irgendein Teil nicht funktioniert, ist das Ganze nichts wert.
Studierende, so sieht es nun mal aus, sind europamüde geworden - gewiss ein politisches Debakel, auch darüber hinaus bedauerlich, doch für den "Geist" an sich kein Grund zu spektakulärer Trauer; es gibt Schlimmeres. Gleichwohl kapitulieren die Kritiker, bedingungslos, unwiderruflich und stellvertretend. Wir sind gescheitert, wir geben es zu, wir marschieren zurück. Bologna minus Erasmus ist gleich null.
Klüger und cleverer
Wer diese Gleichung aufstellt, unterschätzt wissentlich den Handlungsspielraum an Ort und Stelle. Zum Beispiel: Modularisierung der Studiengänge plus Mut zur Lücke. Daraus ließe sich etwas machen. Man könnte, auf lebensnahe Fallstudien gestützt, einschlägige Theorienbestände und Methodeninventare den Studierenden exemplarisch vor Augen führen. Dann würden sie klüger und cleverer, theoretischer und praktischer in die Welt hinaus ziehen, als es früheren Generationen gemeinhin vergönnt war - deren Erziehung noch darauf abgezielt hatte, leere Köpfe mit kanonisiertem Wissen vollzupumpen, getreu dem Motto, dass niemand von sich behaupten könne, dieses oder jenes Fach studiert zu haben, der dieses oder jenes Faktum nicht wisse. "System" wurde genannt, was in Wahrheit Serie war, eine endlose Sequenz aneinandergereihter "Stoffe". Nicht von ungefähr haben die ratlosen Adressaten dieser seriellen Pädagogik ihren Lehrmeistern Mal für Mal zurückgemeldet, sie hätten "den Zusammenhang der Veranstaltung mit anderen Veranstaltungen" nicht erkennen können. Passiert ist dennoch nichts. Denn man war penibel auf den "gerechten" Ausgleich zwischen akademischen Reservaten und Relevanzen bedacht.
Das Ergebnis der Nichtreform: randvolle Studiengänge, die tradierte Wissensbestände krampfhaft komprimieren, um das gleiche Informationsvolumen in kürzerer Zeit dem überfütterten Publikum näherzubringen; und die, obsessiv darauf erpicht, verdichtete Botschaften in strapazierten Köpfen zu verankern, jahrein, jahraus grandiose Prüfungsfestivals inszenieren. Alles Weitere ist bekannt: Unter solchen Auspizien stresst Studieren derart, dass kein Mensch mehr "mobil" sein will - was man freilich nicht der verrückten Praxis oder dem falschen Ehrgeiz anlastet, sondern listig auf das Konto Bologna verbucht.
Auf der nächsten Seite: Augenscheinlich haben viele Professoren das Gefühl, von liebgewonnenen Fleischtöpfen vertrieben worden zu sein.
Von liebgewonnenen Fleischtöpfen vertrieben
Diese schlechte Gewohnheit bezieht ihr gutes Gewissen aus dem schlagenden Argument, der Modularisierungs- und Entschlackungswahn zerstöre die Integrität von Fächern. Oft ist das prognostizierte Reformelend ein willkommener Popanz - als ob landesweit verstreute Häuflein vor sich hin werkelnder Soziologen oder Orientalisten, Politologen oder Philosophen, Sinologen oder Historiker je die "ganze Breite" dessen abgedeckt hätten, was sie an Themen und Theorien eigentlich diskutieren müssten. Lückenwissenschaften waren solche Disziplinen gerade hierzulande seit jeher, die alteuropäische Sorge ums flächendeckende Wissen sollte daher nicht für bare Münze genommen werden, wie lautstark sie sich auch Gehör verschafft.
Für die intellektuelle Bilanz der Reform hätten Fortschritte auf unteren Ebenen hundertmal mehr bewirkt als europaweite Studienreisen. Dem gelobten Land - der Neuen Universität - wäre man dann einen bemerkenswerten Schritt nähergekommen. Doch wer will diesen Exodus überhaupt? Augenscheinlich haben viele Professoren das Gefühl, von liebgewonnenen Fleischtöpfen vertrieben worden zu sein. Ihre gezielte Enttäuschung resultiert aus gefühlter Entbehrung. Sicher gibt es auch gute Gründe zur Klage, immerhin haben sich über mehrere Ebenen hinweg elende Verhältnisse aufgetürmt. So viel steht fest. Den großen Rest indessen verhüllt ein Schleier des Nichtwissens und Nichtwollens.
So viel lässt sich immerhin sagen: Bolognas Zukunft ist nicht die Vergangenheit.