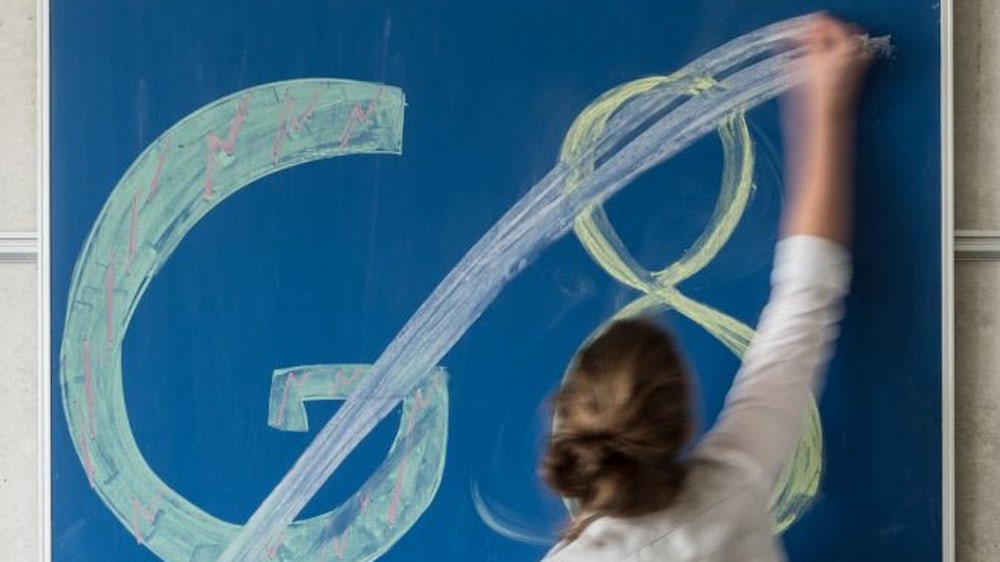Oh doch, Kathrin Wiencek kennt diese Diskussion. Sie ist Lehrerin für Mathe, Physik und Politik an einem Gymnasium in Potsdam, sie weiß, dass es bei diesem Thema hoch hergehen kann - anderswo. Der Streit um G 8 oder G 9, um die Frage also, ob das Abitur nach zwölf oder doch erst dreizehn Jahren absolviert werden soll, wird von Eltern und Pädagogen schnell zu einer Glaubensfrage erklärt. Wiencek, die auch Vorsitzende des Philologenverbands Berlin-Brandenburg ist, lacht. "Das erlebe ich jedes Mal, wenn ich zur Bundessitzung fahre", sagt sie. "Wenn wir Raucher wären, könnten meine ostdeutschen Kollegen und ich da immer rausgehen und eine rauchen." G 8 oder G 9 - das sei überwiegend eine Debatte aus dem Westen für den Westen. An den meisten Ostdeutschen gehe sie komplett vorbei.
In einigen westdeutschen Ländern wird um die Frage gerade wieder heftig gestritten. Viele Eltern in Bayern, in Nordrhein-Westfalen oder hoch im Norden in Schleswig-Holstein sorgen sich, dass ihre Kinder zu wenig Freizeit haben und zu viel Druck. Sie kämpfen fürs G 9. "Das ist hier in Brandenburg kein Thema", sagt Wiencek. "Die eigene Sozialisation spielt da eine große Rolle", glaubt sie.

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Bayern sind beendet. Auszüge aus den Klausuren, von Geschichte über Mathe bis Kunst.
Vier Jahrzehnte lang wurden Schüler in der DDR in zwölf Jahren zum Abitur geführt. So ist der Begriff Turbo-Abi für G 8 im Osten ein Fremdwort: Abi, das ist nach zwölf Jahren. "Es wird als bewährt empfunden", sagt Wolfgang Seelbach vom Brandenburger Landeselternrat. Dafür wird das G 9 eher als unnötige Verlangsamung verstanden. So war es nach der Wiedervereinigung, als drei Länder - Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern - nach westdeutschem Vorbild das Abitur nach 13 Jahren einführten, um Einheitlichkeit herzustellen. Es kam nicht gut an. Als der Trend Anfang der 2000er-Jahre bundesweit in Richtung G 8 ging, kehrten die drei Länder schnell wieder dahin zurück.
Mit dem zwölfjährigen Abi verbanden viele das Gefühl, etwas Gutes, Eigenständiges bewahrt zu haben, wo doch so vieles mit dem Ende der DDR weggeschwemmt worden war. Brandenburgs populäre, 2001 verstorbene Sozialministerin Regine Hildebrandt brachte es mit einem Witz auf den Punkt, der ihr zuverlässig Applaus brachte und ein Klassiker geworden ist. "Warum brauchen die Wessis 13 Jahre bis zum Abitur, ein Jahr länger als die Ostler?" fragte sie. Die Antwort: "Weil ein Jahr Schauspielunterricht dabei ist."
In Sachsen und Thüringen hielten die von der CDU geführten Regierungen stets am G 8 fest, sie vertraten das mit großem Selbstbewusstsein. Dass ihre Schüler in Vergleichstests wie Pisa besonders gut abschnitten, nahmen sie als Bestätigung für ihren Weg. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in Sachsen diese Kontinuität haben", sagt die Christdemokratin Brunhild Kurth, Kultusministerin in Dresden. "Es besteht große Einigkeit von Schülern, Eltern, Lehrern und in der Politik, dass wir keine Veränderung wollen." Dabei spiele Tradition eine Rolle, sagt Kurth, "aber mit Tradition allein ist es nicht getan".
Als maßgeblich sieht sie es an, dass die Jahre in der gymnasialen Oberstufe nicht überfrachtet würden: "Es gibt einen Fächerkanon, der von der Grundschule beginnend bis hin zum Abitur abgestimmt ist." Deshalb gebe es keine Überlastung in den letzten Jahren. "Es ist nicht so, dass der komplizierteste Stoff nur in die Oberstufe geschoben wird und dort wahnsinniger Stress unmittelbar vor dem Abitur aufkommt", sagt Kurth. Die sächsischen Schüler hätten so auch genug Zeit für die Sport AG oder den Besuch der Musikschule. "Sonst hätten wir die Leistungen in Schülerwettbewerben nicht aufzuweisen."
Dabei wird eine hohe Stundenzahl unterrichtet. Sachsen hält in den acht Jahren nicht nur die Mindeststundenzahl ein, die nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz in der Gymnasialzeit unterrichtet werden muss. "Wir liegen sogar darüber", sagt Kurth, "Nachmittagsunterricht ist bei uns nichts Ungewöhnliches, das ist normal."
Auch in den ostdeutschen Ländern gibt es heftige Debatten über die Schulpolitik, aber sie entzünden sich an anderen Fragen. Geht es um die Belastung der Schüler, werde etwa um die organisatorische Gestaltung der Oberstufe gerungen, "zum Beispiel, ob es richtig ist, dass die Schüler Leistungskurse mit hohem Spezialwissen statt solider Allgemeinbildung haben müssen", sagt Kathrin Wiencek vom Philologenverband. "Da stellt man sich schon manchmal die Frage, ob das Sinn ergibt."
Josef Kraus möchte das Zeugnis aus der Hauptstadt am liebsten nicht anerkennen. Wie es um die Vergleichbarkeit der Abiturleistungen in Deutschland steht.
Auch für Petra Zais, schulpolitische Sprecherin der oppositionellen Grünen in Sachsen, steht außer Frage, dass das 12-Jahre-Abi gut ist. "Mir ist das als Thema noch nie begegnet", sagt sie. Eher werde gefragt, wie man die Lehrpläne entschlacken könne. Auch Zais verweist auf die Ost-Sozialisation. Sie denkt außerdem, dass Einstellungen eine Rolle spielen. Die Einstellung etwa, dass die Schule "in den oberen Klassen eben kein Spaziergang sein soll: Ich erlebe selten Eltern, die wollen, dass ihre Kinder in Watte gepackt werden."
Zudem gibt es in einigen Ländern eine Alternative, auf die auch der Landeselternrat in Brandenburg verweist: die Möglichkeit, in 13 Jahren an Gesamtschulen und Oberstufenzentren das Abitur zu machen. "Die Gesamtschule hat hier einen guten Ruf und wird gern gewählt", sagt Elternsprecher Seelbach, "wir finden diese Zweigleisigkeit vernünftig."
Für manche Eltern, im Westen und wohl auch im Osten, mag das Gymnasium schon aus Prestigegründen als einzig richtiger Weg gelten. Sachsens Kultusministerin Kurth hält davon nichts. Wenn eine Familie sich entscheide, "die Autobahn zum Abitur zu nehmen, sollten die Eltern und das Kind sich fragen, ob es so anstrengungswillig sei, diesen Weg zu absolvieren", sagt sie. Schließlich gebe es ja die Option des G 9 an Oberschulen und beruflichen Gymnasien. Brunhild Kurth nennt diesen etwas langsameren Weg zum Abitur "die Landstraße".