Joachim Schultz, 63, Literaturwissenschaftler an der Universität Bayreuth, hätte noch zwei Jahre lehren müssen bis zum Ruhestand. Die Universitätsreform, also der sogenannte Bologna-Prozess mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen, und die Auswirkungen der Studiengebühren auf das Klima an der Hochschule haben ihn dazu bewogen, vorzeitig in Pension zu gehen.
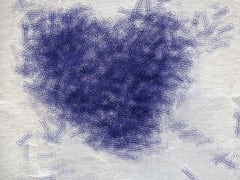
Welche Gefühle haben deutsche Studenten zu ihrem Fach und zu ihrer Hochschule? Diese Frage ließ das Deutsche Studentenwerk Design-Studenten im Rahmen eines Plakatwettbewerbs beantworten. Die Antworten überraschen.
Herr Schultz, Dozent für praxisorientierte Themen rund um den Literaturbetrieb - hört sich wie ein Traumberuf an.
Wissen Sie, ich habe mich in den letzten zehn Jahren, seit der Reform der Universitäten, wie von Bürokratie umzingelt gefühlt. Ich kenne sehr viele Kollegen, die exakt dasselbe empfinden - aber keine Konsequenzen daraus ziehen. Ich wollte das anders machen: Also höre ich auf.
Was genau hat Sie dazu bewogen?
Ich hatte den Eindruck, nicht mehr das machen zu können, was ich als meine Aufgabe empfinde: Studenten zu kreativer Arbeit anzuleiten. Der Stundenplan in den Geisteswissenschaften ist nach der Bologna-Reform verschult und abgezirkelt, die Spielräume sind eng. Zusammen mit den Studiengebühren, die es in Bayern ja immer noch gibt, bleibt den Studenten für Kreatives kaum Zeit. Sie müssen schließlich Geld verdienen.
Nebenher, ja.
Ich lehre berufsbezogene Literaturwissenschaft. Man möchte meinen, dass Studenten Zeit und Interesse an einer Fahrt zum Literaturarchiv nach Marbach haben. Aber sowas ist kaum noch möglich.
Studenten der Literaturwissenschaft haben kein Interesse an einer Studienfahrt ins Marbacher Literaturarchiv?
An einem Werktag, sagen mir Studenten, verpassen sie zu viele wichtige Seminare, und alles ist prüfungsrelevant. Und am Wochenende muss ja das Geld für die Studiengebühren verdient werden.
Also keine Exkursion nach Marbach.
Was ich über Marbach wissen sollte, das finde ich unter Umständen auch im Netz, sagt man mir. Unter Studenten hat sich eine Mentalität entwickelt, wie sie möglichst schnell zu den für sie wichtigen "Leistungspunkten" im Studium kommen. Unter den Gegebenheiten kann man ihnen das nicht mal vorwerfen.
Aber deshalb wirft man doch so einen Beruf wie den Ihren nicht vorzeitig hin.
Natürlich nicht, das sind die kleineren Probleme, auch wenn diese ja merkwürdig genug sind. Das größere Problem ist, dass mir fast alle Kollegen sagen: Was man früher in fünf Jahren gemacht hat, muss man heute in drei machen. Als es alle gesagt haben, wurde der straffe Plan gelockert, aber gut wurde es nicht mehr.
Sorgen Sie sich um das Bildungsideal von Humboldt?
Man muss das gar nicht so hoch hängen. Das primäre Problem ist: Die Studenten bekommen an der Hochschule kaum noch das Rüstzeug, das sie für einen Job brauchen. Also, um Hochschullehrer zu werden, reicht das nicht aus, was heute vermittelt wird. Für Kulturjournalismus, die Arbeit an einem Literaturarchiv auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass wir hier primär nur noch das akademische Prekariat ausbilden. Wenn ich die Berufsbiografien meiner Studenten verfolge: Zeitlich begrenzte Jobs, schlecht bezahlt, das sieht nicht gut aus.
Ziel der Reform war genau das Gegenteil: die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Die beiden Hauptziele der Reform können kaum erreicht werden. Jemand mit einem Bachelor bekommt im Bereich Geisteswissenschaften selten einen guten Beruf mit akzeptablem Gehalt. Das heißt: Die meisten müssen trotzdem noch einen Master dranhängen, dann haben sie wieder fünf Jahre studiert. Ziel eins, die Studienzeitverkürzung, wird so nicht erreicht. Ziel zwei, die europaweite Durchlässigkeit, sollte ja sein: Bachelor in Bayreuth, Master in Montpellier. Auch das funktioniert nicht richtig: Ich hatte eine Studentin, die wollte nach dem Bachelor in England weiterstudieren. 20 Bewerbungen musste sie schreiben, ehe sie irgendwo angenommen wurde.
Viele Dozenten beklagen, dass die Studiengebühren bei den Studenten zu einem Mentalitätswandel geführt haben.

Einfach nur zuhören und mitschreiben: Eigentlich kann man in Vorlesungen nicht viel falsch machen - möchte man meinen. In der Realität rauben Studenten einander mit ihren Macken - und mit ihrer Garderobe - oft den letzten Nerv. Die größten Benimm-Patzer im Überblick.
Stimmt: Sie zahlen, und dadurch erwarten sie offenkundig auch, dass geliefert wird. Bildung aber kann man nicht liefern. Das Wichtigste, das eigene Arbeiten und Forschen, kommt zu kurz. Dafür ist zu wenig Zeit. Und zu wenig Lust.
Übertreiben Sie nicht?
Ich habe ein Seminar gehalten, in dem beleuchtet wurde, wie die Klassiker heute im normalen Leben auftauchen. Also auch im Film. Ich spreche eine Wim-Wenders-Verfilmung an - und das Gemurmel geht los: Wenders? Wer ist das?
Oh. Ist es so schlimm? Das würde ja die Geisteswissenschaften in ihrer Existenz in Frage stellen.
So ist es ja auch. Die Kernfächer der Geisteswissenschaften - Germanistik, Anglistik - werden, befürchte ich, noch so lange in der Form bestehen, wie die Lehrerausbildung an der Uni stattfindet. Es werden sich Leute finden, die fragen: Muss ein Gymnasiallehrer das Nibelungenlied von Grund auf kennen? Kann man Lehrer nicht ausschließlich an Schulen ausbilden? Dann brauchen wir die Ältere Germanistik nicht mehr, die Anglistik auch nicht. Dann beschränken wir das auf 40 Leute an der Universität, die forschen und den kulturellen Hintergrund bewahren. Dann ist das Wissen darüber aber weg. "Bologna" hat das eingeleitet.
Wenn das so wäre, wenn das viele so empfinden würden: Dann müsste es doch viel mehr Protest dagegen geben.
Meiner Wahrnehmung nach klagen praktisch alle an der Uni. Die meisten aber sagen: Es ist sinnlos, dagegen vorzugehen, "Bologna" ist jetzt eingeführt und wird sich nicht zurückdrehen lassen.
Hört sich fatalistisch an.
Wäre die Reform, wären die Gebühren in den 1970er Jahren eingeführt worden, wäre die Uni lahmgelegt worden. Die Studenten heute sind lammfromm, die lassen sich das alles bieten. In einer Stadt wie Bayreuth sowieso. Da passiert gar nichts. Da müssen wir durch, heißt es.
Dann bleiben die Studiengebühren?
Glaube ich nicht. Das wird Bayern nicht mehr lange durchhalten, es ist ja eines der letzten Bundesländer mit Studiengebühren. Zu behaupten: In Bayern sind ja quasi alles Elite-Universitäten, deshalb gehen die Studenten da hin und nehmen die Gebühren in Kauf, das wird man nicht aufrechterhalten können.
Würden Sie noch mal den Beruf des Hochschullehrers ergreifen?
Unter den jetzigen Bedingungen: nein.