
Dinosaurierforscher streiten: Wie intelligent muss man sein, um die Erde Millionen Jahre lang zu beherrschen?

Dinosaurierforscher streiten: Wie intelligent muss man sein, um die Erde Millionen Jahre lang zu beherrschen?

Vor 50 Jahren haben die Menschen eine Botschaft an Außerirdische ins All geschickt. Das war etwas leichtfertig.

Nach Monaten des Schweigens meldet sich "Voyager 1" wieder vom Rand des Sonnensystems. Ingenieure haben ein Update an die seit 46 Jahren fliegende Sonde geschickt. Nachrichten von einer Unermüdlichen.

Viele Arten sind nach wie vor nach Kolonialisten oder anderen problematischen Persönlichkeiten benannt. Manche Ornithologen würden das gerne ändern - aber das Projekt ist sehr umstritten.

Was sagen die Bilder, Gedanken und Eindrücke, die nachts in unseren Köpfen umherschwirren, wirklich aus? Sind sie nur Unsinn – oder eine Fortführung des Wachzustands?

Die Texte von Popsongs werden seit Jahren immer simpler, Wörter und Sätze wiederholen sich zunehmend. Liegt das an der wachsenden Konkurrenz oder der fehlenden Aufmerksamkeit der Hörer?

Familien sind heute schon viel kleiner, als sie es mal waren – und schrumpfen immer weiter. Wie Experten die Zukunft unseres Zusammenlebens sehen.

Forscher können erstmals zeigen, wie Patienten mit einer seltenen neurologischen Störung die Welt wahrnehmen.

Die Bundeswehr soll Deutschland im Ernstfall verteidigen können? Dazu braucht es die Unterstützung der Wissenschaft. Zivilklauseln sollten abgeschafft werden.

Wer gesünder frühstückt, sehe kurzfristig attraktiver aus als andere, berichten Forscherinnen aus Frankreich. Doch hilft das auch längerfristig?
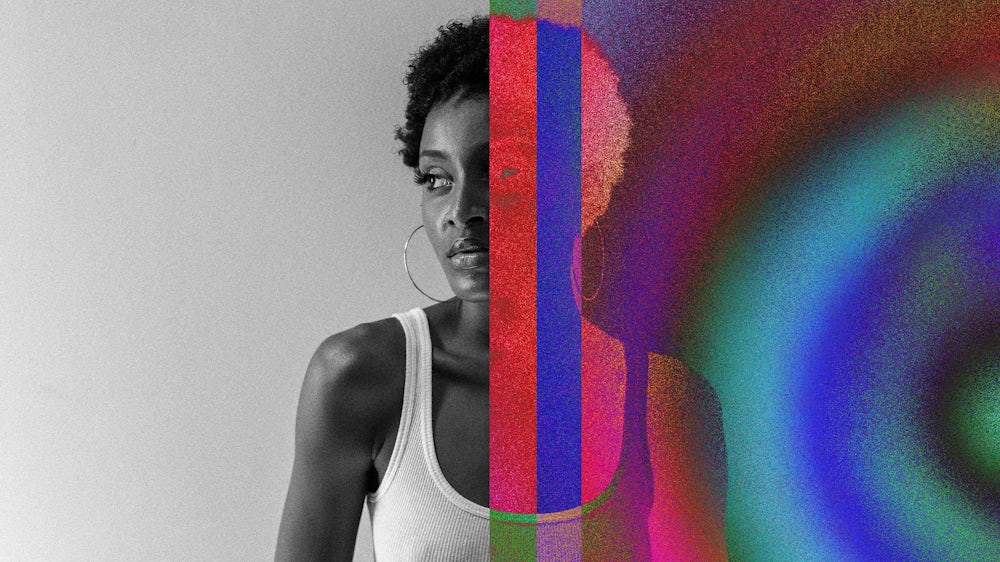
Nachhilfe von Drachen: Die Hinweise häufen sich, dass Psychedelika gegen psychische Erkrankungen helfen könnten. Können viele verzweifelte Patienten nun endlich auf Hilfe hoffen?

Ein versteinertes Reptil aus dem Trentino galt lange als Fossil wie aus dem Bilderbuch. Nun zeigt sich: Da war viel schwarzer Lack im Spiel.

Spätestens von der dritten Klasse an lernen Kinder in der Grundschule eine Fremdsprache. Eltern, Lehrer und Schulpolitiker streiten darüber, ob das sinnvoll ist. Was Experten sagen.

Erstmals im Bild: Ein neugeborener Weißer Hai taucht vor der Küste Kaliforniens auf und löst womöglich ein großes Rätsel der Wissenschaft.

Mit Isotopenanalysen haben Forscher die Wanderungen eines einzelnen Tieres vor 14 000 Jahren in Alaska nachgezeichnet - und festgestellt: Die Menschen waren ihm immer auf der Spur.

Afrikanische Ameisen erkennen infizierte Wunden und versorgen sie mit Antibiotika. Sind die Insekten auch eine Quelle für neue Wirkstoffe in der Humanmedizin?

In vielen Höhlenmalereien sind Hände mit seltsam verkürzten Fingern zu sehen. Künstlerische Entscheidung - oder blutiges Ritual?

Akademische Laufbahnen sind nur etwas für Begabte, findet die Psychologin Elsbeth Stern. Ein Gespräch über die Aussagekraft von IQ-Tests, optimale Förderung und den Zusammenhang von Intelligenz und Erfolg.