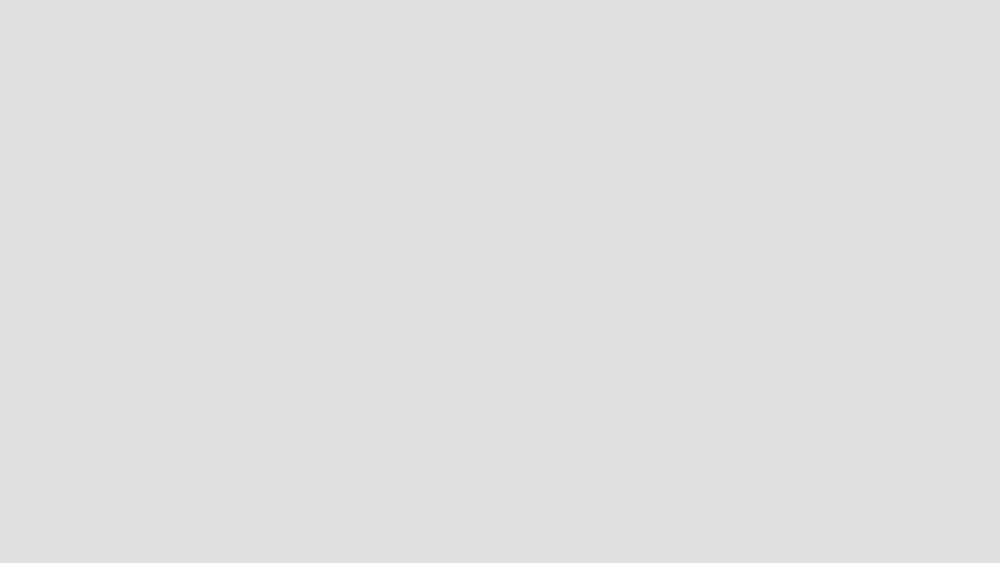Es gibt Geburtstagsgeschenke, die Freude machen und solche, die man am liebsten gleich wieder zurückgeben möchte. Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, ist da bestimmt keine Ausnahme. Das Präsent, das ihm Gegner des Freihandelsabkommens TTIP am 9. Dezember zum 60. Geburtstag schicken wollten, steht ganz sicher nicht auf seiner Wunschliste. Es ist ein Päckchen voller Probleme.
Eine Million Unterschriften haben die Organisatoren der Europäischen Bürgerinitiative "Stopp TTIP" in nur wenigen Wochen gegen das geplante Bündnis zwischen den USA und der EU gesammelt. Die nächste Million hat das Bündnis von 320 Organisationen bereits in Angriff genommen. Das macht die Sache für Juncker und seine Mannschaft nicht leichter - Zeit für eine Zwischenbilanz.
Die Erwartungen sind groß, als Vertreter beider Seiten im Sommer 2013 die Gespräche aufnehmen. Ihr Ziel ist es, Europa und die Vereinigten Staaten noch näher zusammenzubringen. Gemeinsam wollen sie den größten globalen Wirtschaftsraum schaffen, auch um dem mächtigen China besser Paroli bieten zu können. Das "Transatlantic Trade and Investment Partnership", so der sperrige Titel des Abkommens, soll den Geschäften zwischen Alter und Neuer Welt neuen Schwung verleihen. Wirtschaft und Politik versprechen 800 Millionen betroffenen Menschen mehr Wachstum und Jobs.
Nach sieben Verhandlungsrunden ist von der Anfangseuphorie wenig geblieben. Die Zweifel an den Versprechen wachsen. Die Geheimniskrämerei der Verhandlungsführer, die NSA-Spionageaffäre, der Streit um Sonderrechte für Konzerne und private Schiedsgerichte tragen ihren Teil dazu bei. In Brüssel und Berlin stehen die Verfechter des Freihandels inzwischen unter Dauerbeschuss. Der Widerstand hat sich zu einer Bürgerbewegung entwickelt. Rentner, Studenten, Arbeiter, Angestellte und Selbständige ziehen an vielen Orten gemeinsam auf die Straße. Vor allem in Deutschland, Frankreich, Österreich und Luxemburg formieren sich die Gegner.
EU-Kommission unter Beobachtung
Das Reizthema TTIP entwickelt eine Eigendynamik, die so manchem Politiker den Angstschweiß auf die Stirn treiben dürfte. Da werden Erinnerungen an Stuttgart 21 wach, jenes umstrittene Bahnprojekt, das die sonst eher friedliebenden Schwaben vor einigen Jahren auf die Barrikaden trieb. Der Aufstand gegen das milliardenteure Projekt löste ein politisches Erdbeben aus - und es verhalf Winfried Kretschmann zu seinem Posten als erster grüner Ministerpräsident eines Bundeslandes in Deutschland.
Die neue EU-Kommission und ihr Chef Juncker stehen bei den laufenden Freihandelsgesprächen unter strenger Beobachtung. Das wurde bereits bei den Europawahlen im vergangenen Frühjahr deutlich, als TTIP unerwartet auf der Wahlkampf-Agenda landete, was konservative Kräfte gern verhindert hätten. Doch wie konnte es so weit kommen?
Verantwortlich dafür ist nicht allein das geplante Abkommen mit den USA. Die Wurzeln liegen tiefer. Das Paradigma, dass freier Handel automatisch mehr Wohlstand für alle bedeutet, ist ins Wanken geraten. Die Finanz- und Euro-Krisen der vergangenen Jahre haben das Vertrauen vieler Europäer in den Freihandel und die Globalisierung erschüttert. Selbst eineinhalb Jahre nach Beginn der Gespräche ist wenig über den genauen Inhalt und die Verhandlungspositionen der TTIP-Macher bekannt. Das schürt Misstrauen und weckt Ängste - ganz egal, ob die nun berechtigt sein mögen oder nicht.
Die neue Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Makel zu beseitigen. Regierungschef Juncker verspricht mehr Transparenz und Aufklärung über den Fortgang der Gespräche. Die neue Handelskommissarin, die Schwedin Cecilia Malmström, muss das nun umsetzen - und zugleich die amerikanischen Verhandlungspartner besänftigen, die den Proteststurm gegen TTIP in Europa mit zunehmendem Argwohn beobachten. Keine leichte Aufgabe, Juncker und Malmström werden sich an diesem Versprechen messen lassen müssen.
Milliardenschwere Klagen auf Schadenersatz
Der erste große Stresstest steht bevor. Die nächste Verhandlungsrunde ist vom 2. bis 6. Februar in Brüssel angesetzt. Dann sollen unter anderem die besonders umstrittenen Investorenschutzregeln zur Sprache kommen, die einige EU-Länder wie Frankreich oder Österreich am liebsten ganz aus dem Vertrag verbannen würden. Die Bundesregierung sieht die Klauseln zwar kritisch, ist aber zögerlich. Konzerne könnten damit Staaten vor private Schiedsgerichte zitieren und auf milliardenschweren Schadenersatz verklagen, zum Beispiel dann, wenn sie ihre Gewinne durch schärfere Umweltgesetze gefährdet sehen. Die amerikanische Seite hat deutlich signalisiert, dass sie auf diese Regeln nicht verzichten wird.
Doch solche Verfahren können teuer werden für die Steuerzahler, wie eine neue Studie des Netzwerks Friends of the Earth Europe offenlegt. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro Schadenersatz mussten EU-Länder demnach in den vergangenen 20 Jahren an Investoren und Konzerne zahlen. In 60 Prozent der Fälle ging es um Umweltfragen. Basis dieser Klagen waren Investorenschutzregeln in früheren Freihandelsabkommen.
Die Risiken sind schwer kalkulierbar. Friends of the Earth warnt vor einem enormen Anstieg solcher Investorenschutzklagen, sollten die Klauseln auch im europäisch-amerikanischen Abkommen verankert werden. US-Unternehmen sind bekannt für ihre Streitlust. Europäische Konzerne gelten ebenfalls als nicht gerade zimperlich. Das zeigt die Klage gegen den deutschen Atomausstieg. Der schwedische Konzern Vattenfall fordert nach neuen Erkenntnissen knapp fünf Milliarden Euro Schadenersatz von Deutschland, bis vor kurzem war nur von 3,7 Milliarden Euro die Rede. Selbst im Berliner Wirtschaftsministerium räumt man ein, dass dieser Fall ein Paradebeispiel für ein schlechtes Schiedsgerichtsverfahren sei.
Die Sonderrechte für Investoren sorgen auch beim fertig ausgehandelten Ceta-Abkommen mit Kanada für Verstimmung in der Berliner Koalition. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) steht unter dem Druck seiner Genossen, die bei dem Thema gespalten sind. Vor allem an der Basis brodelt es. Die Bundesregierung dürfe dem Vertrag nur zustimmen, wenn die Klauseln gestrichen würden, fordern viele. Doch so einfach ist das nicht, das weiß Gabriel, denn damit stünde das ganze Abkommen infrage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will das Abkommen mit Kanada unbedingt, so wie es ist und ohne Abstriche. Gabriel befindet sich damit in der Zwickmühle und will nun einen Parteikonvent über den strittigen Investorenschutz abstimmen lassen. Ein Termin ist für das erste Halbjahr 2015 angepeilt.
Das kanadische Freihandelsabkommen wird damit zum Wegweiser für TTIP. Inhaltlich sind sich die Verträge ähnlich, das Abstimmungsprozedere wird gleich sein. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Ceta noch viele Hindernisse nehmen muss, bevor es endgültig in Kraft treten kann. Laut Fahrplan aus dem Berliner Wirtschaftsministerium könnten bis dahin noch mindestens drei Jahren vergehen. Die jetzige Bundesregierung hätte dann nichts mehr damit zu tun.
Hintergrund für die Verzögerung ist ein Kompetenzgerangel zwischen Brüssel und den EU-Ländern. Der frühere Handelskommissar Karel De Gucht schien fest davon überzeugt, dass TTIP und Ceta nur die Zustimmung von EU-Rat und -Parlament brauchen. Inzwischen geht man in Brüssel jedoch davon aus, dass die Parlamente der einzelnen Mitgliedsländer ebenfalls zustimmen müssen, weil die Verträge nationales Recht tangieren. Weil das aber noch nicht abschließend geklärt ist, werden wohl der Europäische Gerichtshof und nationale Instanzen wie das Bundesverfassungsgericht das letzte Wort haben.
Die Gefahr des Scheiterns wächst
Der Kampf um das Abstimmungsverfahren macht die Sache kompliziert und langwierig. Außerdem wächst die Gefahr des Scheiterns, weil einzelne Länderparlamente ihre Zustimmung verweigern können - das würde das Aus bedeuten. Eine weitere Auseinandersetzung steht im Frühjahr im Europaparlament an. Die Abgeordneten dort verlangen ebenfalls mehr Mitspracherechte. Bisher ist nur vorgesehen, dass sie über die Verträge als Ganzes abstimmen. Korrekturen wären dann allerdings nicht mehr möglich.
Inzwischen gehen Beobachter davon aus, dass sich auch die Verhandlungen zwischen der EU und den USA länger hinziehen werden als geplant. Ende 2015 sollte eigentlich ein Vertragsentwurf für TTIP auf dem Tisch liegen. Inzwischen erwartet kaum jemand mehr, dass eine Einigung noch in die Amtszeit von US-Präsident Barack Obama fallen wird. Die nächsten Wahlen sind im November 2016.
Eineinhalb Jahre nach dem Start der Verhandlungen steht das europäisch-amerikanische Wirtschaftsbündnis unter keinem guten Stern. Die Schwierigkeiten häufen sich. Das könnte auch daran liegen, dass die Macher zu viel auf einmal wollen. Zu sehr haben sie sich dabei an den Wünschen der Wirtschaft orientiert, ohne andere betroffene Gruppen einzubeziehen. Dazu gehören Sozial- und Umweltverbände, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen und andere Interessengruppen.
Eine Million Unterschriften von TTIP-Gegnern als Geburtstagspräsent mögen EU-Kommissionspräsident Juncker nicht gerade begeistern, aber er wird sie nicht ignorieren können. Sie sind eine Aufforderung, es besser zu machen. Ein Bündnis mit den USA hat nur dann einen Sinn, wenn es Nutzen stiftet und die Europäer dahinterstehen. Doch dafür braucht es mehr als ein paar magere Wachstumsprognosen. Es gibt noch viel zu tun.