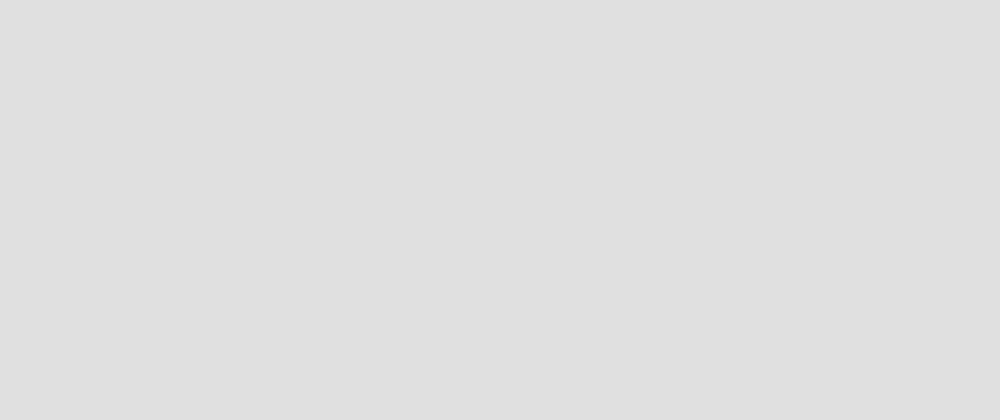Donald Trump wäre wohl ein weit weniger umstrittener Präsident, würde er nicht ständig twittern. All die Beleidigungen, Lügen und sonstigen bizarren Äußerungen, die Trumps Präsidentschaft in den vergangenen zwölf Monaten geprägt haben, fanden auf Twitter statt. Blendet man dieses - zugegebenermaßen sehr laute - Hintergrundgeräusch einmal aus, dann bleibt von Trumps erstem Amtsjahr eigentlich eine recht banale Bilanz. Zugespitzt könnte man sagen: Im Großen und Ganzen hat Trump regiert wie ein ganz normaler Republikaner.
Das wird vor allem dann klar, wenn man Trump mit dem bis dato letzten republikanischen US-Präsidenten vergleicht, mit George W. Bush. Auch Bush war zum Beispiel ein Klimawandel-Skeptiker. Er kündigte das Kyoto-Abkommen, so wie einige Jahre später Trump den Pariser Klimavertrag. Auch Bush glaubte fest an das republikanische Dogma, wonach die Steuern sinken müssen, und sei es um den Preis explodierender Staatsschulden. Er setzte in seinem ersten Amtsjahr eine gewaltige Steuersenkung durch - Trump ebenso.

Mehr als 2000 Lügen, eine boomende US-Wirtschaft, Dutzende Besuche auf Golfplätzen und viele Tweets am Vormittag. Ein Rückblick auf Trumps erstes Jahr im Weißen Haus.
Auch Bush war der Ansicht, dass an Amerikas Gerichten zu viele linke Richter sitzen, die linke Politik machen wollen, anstatt sich an den Wortlaut der Gesetze zu halten. Er nominierte daher für frei werdende Richterstellen dezidiert konservative Kandidaten, so wie auch Trump es in den vergangenen Monaten getan hat.
Die Republikaner waren stets die Partei des Freihandels
Und auch Bush war ein Politiker, dem Investitionen, Unternehmensgewinne, Jobs, steigende Aktienkurse und Wirtschaftswachstum im Zweifelsfall wichtiger waren als Naturschutz und Arbeitnehmerrechte. Bereits er lockerte viele Umweltauflagen, die dann später unter dem Demokraten Barack Obama wieder verschärft wurden - nur um jetzt von Trump erneut gelockert oder gestrichen zu werden. Ein republikanischer US-Präsident, der für weniger Staat und mehr wirtschaftliche Freiheit eintritt, ist also nichts wirklich Neues. Dass Trumps Politik zumindest zum Teil diesem Muster entspricht, ist ja gerade ein Grund dafür, dass viele Republikaner ihn immer noch unterstützen.
Dennoch ist Trump kein traditionell republikanischer Präsident. In zwei politischen Bereichen hat er mit republikanischen Glaubenssätzen gebrochen. Erstens: in der Handelspolitik. Die Republikaner waren stets die Partei des Freihandels, sie sahen darin eine Chance für Amerikas Unternehmen - wenn auch nicht unbedingt für Amerikas Arbeiter. Und sie sahen Handelsbeziehungen und Handelsverträge als strategische Instrumente, um Einfluss in der Welt auszuüben.
Trump ist hingegen der Ansicht, dass Freihandelsabkommen in Wahrheit so etwas wie Freibriefe für andere Länder sind, die USA wirtschaftlich auszunutzen, auszuplündern oder gar - wie er es mit Bezug auf China gesagt hat - zu "vergewaltigen". Trump ist davon überzeugt, dass China, Mexiko und nicht zuletzt Europa den USA die Fabriken und Arbeitsplätze stehlen. Entsprechend scharf war die Wende, die er als Präsident in der amerikanischen Handelspolitik eingeleitet hat: Das Freihandelsabkommen TPP mit einer Gruppe asiatischer Staaten hat er kurzerhand gekippt, das Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko (Nafta) lässt er derzeit nachverhandeln. Notfalls, so droht Trump, werde er es kündigen.
Auch das jüngste Steuersenkungspaket enthält Elemente - vor allem die drastische Reduzierung der Körperschaftsteuer -, die Amerika auf Kosten anderer Länder wirtschaftliche Vorteile bringen sollen.
Trumps Neigung, den Wert einer Beziehung zu einem anderen Staat vor allem anhand der Handelsbilanz zu bewerten, führte auch in einem zweiten Bereich zu einem spürbaren Kurswechsel: in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die globale Wirtschaftsmacht USA ist unter Donald Trump protektionistischer geworden. Zugleich ist die globale Ordnungsmacht Amerika nationalistischer geworden. Trumps "America first"-Doktrin, die den US-Interessen Vorrang gibt, ist sehr ernst gemeint.
Trump glaubt nicht wirklich an den Wert von Allianzen und Bündnissen. Seine abfälligen Äußerungen über die Nato-Partner, die sich angeblich ihre Sicherheit von Amerika bezahlen lassen, machen das deutlich. Für den Präsidenten ist Sicherheitspolitik ein Geschäft: Schutz gegen Bezahlung. Und um seine eigenen Interessen kümmert sich Amerika nicht mit Diplomatie oder "Soft Power", sondern mit militärischer Gewalt. Das Ergebnis ist etwa eine Nordkorea-Politik, die in erster Linie aus scharfen Kriegsdrohungen besteht, weniger aus geduldigen Verhandlungen.
Er glaubt nicht wirklich an Allianzen und Bündnisse
Amerikas Rückzug aus Teilen der Welt begann zwar schon unter Obama, der seinerzeit den Nahen Osten weitgehend sich selbst überließ. Doch Trump hat den Trend verstärkt. Der Ausstieg aus den TPP-Gesprächen mit asiatischen Ländern war ein strategisches Geschenk an die ehrgeizige Regionalmacht China. Trumps Sicht auf Europa, auf die Nato oder die EU ist allenfalls gleichgültig, wenn nicht feindselig. Afrika existiert in Trumps Weltbild praktisch nicht, Lateinamerika ist für ihn vor allem ein Exporteur von armen, illegalen Migranten. Wirklich gute Beziehungen hat der US-Präsident nur zu Autokraten in Asien und der arabischen Welt.
Auch hinter dieser Neusortierung der Außenbeziehungen steht ein Weltbild, das Trump von seinen Amtsvorgängern unterscheidet. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben alle US-Präsidenten den Anspruch erhoben, dass die Vereinigten Staaten eine moralische, historische Mission in der Welt haben; dass sie eine Führungs- und Ordnungsmacht sind, der Magnet, an dem sich die Eisenspäne ausrichten; dass Amerika die Schutzmacht der liberalen westlichen Weltordnung und ihrer Werte ist: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit.
Diesen moralischen Anspruch erhebt Trump nicht. Er will die Welt nicht führen oder ordnen - ganz abgesehen davon, dass die Welt von ihm nicht geführt oder geordnet werden möchte. Amerikas Beliebtheit ist seit Trumps Amtsantritt dramatisch gefallen. Trump interessieren mit Blick auf die Welt zwei Dinge: Amerikas Wirtschaftsinteressen und der Kampf gegen Terroristen. Diese enge Sichtweise, eine Mischung aus Isolationismus und Nationalismus, ist ein fundamentaler Bruch mit einer 70 Jahre alten amerikanischen - und zutiefst republikanischen - Tradition. Und es ist ein Grund, warum Demokratie und Freiheit weltweit an Boden verlieren.
Einen ähnlichen Bruch hat Trump auch im Inneren verursacht. Und damit ist man wieder bei Twitter. Trump, so erscheint es zuweilen, steckt auch ein Jahr nach seinem Amtsantritt immer noch im Wahlkampf fest. Es ist, als sehe er sich nicht als Präsident aller Amerikaner, sondern glaube, ausschließlich jenen Wählern verpflichtet zu sein, die im November 2016 für ihn gestimmt haben. Und seine bevorzugte Waffe in diesem ewigen Wahlkampf ist der Kurznachrichtendienst mit dem zwitschernden Vögelchen im Logo.
Mit dieser Waffe attackiert Trump alle, die er, ob nun zu Recht oder Unrecht, für Gegner hält. Sein erstes Amtsjahr glich über weite Strecken einem Dauerduell gegen die Demokraten, gegen vermeintlich illoyale Republikaner, gegen die Medien, gegen "das Establishment", aber auch gegen ganz normale Amerikaner, die aus irgendeinem Grund die Wut des Präsidenten auf sich gezogen haben. Auf diese Weise erzeugt Trump einen fast pausenlosen Stress, er zwingt ständig seine Gegner, sich über ihn aufzuregen, und seine Unterstützer, eigentlich Unentschuldbares zu entschuldigen und zu verteidigen.
Die politischen Institutionen Amerikas - der Kongress, die Gerichte, die Bürokratie - haben diesem Stress bislang erstaunlich gut widerstanden. Die Gesellschaft aber spaltet der Präsident auf diese Weise mehr und mehr in zwei völlig unversöhnliche Lager: in Trump-Feinde und Trump-Freunde. Wie die später einmal wieder zueinanderfinden sollen, weiß niemand.